Gerd Skibbe
Die Dramen meines Jahrhunderts
Vorwort
Die Umstände - damals war ich Kreisvorsitzender der CDU Neubrandenburg - brachten es mit sich, dass ich dabei war, als Andrzej Szczypiorski der polnische Sejm Abgeordnete und Schriftsteller, vom Rednerrpult aus, in die Runde der mehr als vierhundert Kulturschaffenden schaute. Diese Konferenz fand am 31. Oktober 1990 zu Frankfurt/Oder statt, anläßlich der Eröffnung der Europauniversität. Er sagte wörtlich „Meine Damen und Herren, die Banditen sind nicht unter uns, - sondern sie sind in uns!” Alle schauten auf, auch Bundeskanzler Helmut Kohl, die Präsidentin des Deutschen Bundestages Prof. Dr. Rita Süßmuth und andere Prominente ebenfalls. Niemand protestierte.
König Benjamin bestätigt diese innere Zerrissenheit aller: „Der natürliche Mensch ist ein Feind Gottes!“ Mosia 3: 19, Buch Mormon
Auch Goethe
beklagte unser Hin- und Hergerissensein, mit Worten, die er Faust in den Mund legte: „Zwei
Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, Die eine will sich von der anderen
trennen; Die eine hält, in derber Liebeslust, sich an die Welt, mit
klammernden Organen; Die andre hebt, gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden
hoher Ahnen“
Hier die starken Neigungen, da unser Gewissen. Ich weiß, was ich falsch, und was ich gut dachte und machte. Und du weißt es von dir selbst ebenfalls.
So ist mein Buch ein Dokument vom kleinen Bemühen inmitten hochgefährlicher Zeiten und Zustände denen wir weiterhin ausgesetzt sind. Es ist zeilen- und seitenweise meine Lebensbeichte…
Das Folgende
verfasste ich, gewissenhaft, aus alten Aufzeichnungen, Erinnerungen und
vertrauenswürdigen, jedem zugänglichen Dokumenten aus der Perspektive des
Jahres 2024
Gerd Skibbe, Melbourne 2025
Ein Bengel – mehr nicht
Mir
wurde, als ich knapp 14 war, nahegelegt Pilot zu werden. Und so zog ich bereits
1944 die graublaue Uniform an, die ich trug, bis einen Tag vor dem Einmarsch
der Sowjetarmisten in meine Heimatstadt.
Unvergessen: In der Nacht vom 17. zum 18.
August 1943 riss uns Sirenengeheul aus dem Schlaf: doch wie üblich geschah
nichts. Die Feindflugzuge suchten größere Ziele. So drehte ich mich um und fiel
wieder ins Traumland, bis mich eine gewaltige Detonation weckte. Es krachte
immer heftiger und hörte nicht auf. In Panik raffte ich meine Kleidung und
stürzte gleich anderen Bewohner des Hauses Langestraße 17 in den Keller.
Jeden Augenblick konnte uns die nächste Bombe
töten. Ich war gewiss, dies ist mein Ende. Aber es traf Peenemünde, wo die
Nazis ihre Raketen produzierten. Die Luftlinie betrug 8 km. Doch die Luft einer
windstillen Nacht kann über Wasserflächen Geräusche ungemindert übertragen. Es
waren 600 Lancaster- und Halifax – Bomber die ihre Lasten auch als
Phosphor-behälter abwarfen, alles in der Hoffnung Hitlers Raketenprogramm, das
vom Westen als schwere Bedrohung wahrgenommen wurde, empfindlich zu stören.
Im Nachhinein schien mir, dass es die Schreie
der französischen, britischen, russischen Kriegsgefangenen waren, die wir in
den winzigen Pausen platzender Bomben durch das offene Kellerfenster vernahmen.
Frau Müller, unsere Hauswirtin, die in
Peenemünde als Sekretärin arbeitete, berichtete uns später, wie grauenvoll der
Anblick jener war die von Phosphor überschüttet zu Tode verbrannt in den
Maschen der sie umgebenen Drahtzäune hingen.
Wir wurden evakuiert. Mit weit geöffnetem Mund
stand ich nur wenige Tage später auf dem Vorplatz des Berliner – S-Bahnhofs
Alexanderplatz, den ich bereits kannte, da meine Eltern, 1937 eine
Großkonferenz mit Präsident Heber J. Grant besuchten. Ich sehe ihn immer noch
in kleiner Entfernung dasitzen, umgeben von Missionaren.
Statt der Häuser sah ich nun nur rußgeschwärzte
Ruinen.
Mutter ging mit uns – mit meinem Bruder Helmut und
meiner Schwester Helga sowie mir - nach Oberschlesien, wo ich 6 Monate lang weder
die Schule besuchte, noch irgendwelche religiösen Zusammenkünfte, sondern
lediglich mit einem ebenfalls verwilderten „Mormonenbengel“ allerlei
Schabernack trieben, wo ich ellenlange polnische Flüche lernte. Vater kam im
März 44 vom Genesungsurlaub zu uns nach Ratibor. Er verlangte unsere umgehende
Rückkehr nach Wolgast. Er sah voraus, dass die Rote Armee bald als Sieger
kommend in Schlesien einmarschieren würde. Zuvor hatte die deutsche Wehrmacht
die Schlacht am Kursker Bogen, unter sehr hohen Verlusten an Menschen und
Material, kriegsentscheidend verloren.
Wieder in Wolgast absolvierte ich, nun als
Voll-Mitglied der „Flieger – Hitler- Jugend“ meinen ersten Start mit dem
Schulgleiter SG 38. Ich flog in fünf, sechs Meter Höhe etwa 80 Meter weit.
Mir wurde anschließend nahe gelegt mich den
Schülern meiner Klasse in Groß-Mölln in Hinter-Pommern anzuschließen.
Dort wurden wir straff vormilitärisch ausgebildet.
Splitternackt paradierten die wir im Strandsand und
übten Stechschritt, lernten Kriegslieder, aber wenig mehr. Frauen oder Urlauber gab es nicht.
Nun gut 14 Jahre alt erhielt ich eines Herbsttages
eine saftige Ohrfeige von einem SA-Mann, der das große Hakenkreuzenblem als
Armbinde über seinem braunen Oberhemd trug. In einem Großzelt hinter dem
heruntergekommenen Hotel Böttcher, indem wir bis kurz vor Weihnachten wohnten,
wurden wir geschult. Wir sollten verinnerlichen, dass unser Leben Adolf Hitler
gehört. Bis dahin war zumindest mir nicht bewusst, dass es dem großen „Führer“
darum ging, uns Heranwachsende bald als gut vorbereitete Reserve und Kanonenfutter
an die Front zu schicken.
Wir sollten keine eigene Meinung haben, sondern
Gehorsam lernen.
Der kleine Nazi-Mann ereiferte sich, uns zu sagen,
dass an allem Unglück die Juden schuld seien. Dabei fielen aus seinem Mund die
Worte: „Schlau sind sie schon immer gewesen. Und ein besonders schlauer
schrieb die Bibel…“ Ich meldete mich, aber keineswegs, weil ich etwa
irgendwie fromm war, sondern das wusste ich besser. Er kam zu mir. Ich saß im
Schulungszelt hinten. Er hörte mich sagen: „Nein, das ist nicht korrekt, die
Bibel entstand im Verlaufe von Jahrhunderten.“
Peng! Das saß und brannte eine Weile. Auch wenn ich
weit zurückliegend in meiner Heimatstadt Wolgast selten Missionaren unserer
Kirche begegnete und ihnen noch seltener zuhörte, war doch einiges haften
geblieben. Zudem besuchte ich gelegentlich die „Gottesdienste“ der
evangelischen Gemeinde. Ich kann mich, bis heute, an gewisse Passagen der
Predigten und Unterrichtsstunden erinnern.
So erfuhr ich schon früh, dass die Bibel ein Buch
vieler Bücher zahlreicher Schreiber war. Das wenigstens war in meinem
Gedächtnis haften geblieben. Gebetet habe damals ich nicht.
Gott kam in meinem Leben, zu dieser Zeit, nicht
vor.
Da erstürmten Russen im Oktober 44 die Kleinstadt
Gumbinnen in Ostpreußen, während die Alliierten Aachen, im äußersten Westen
Deutschland, belagerten.
Wir wurden, wegen der rasant vorrückenden
russischen Front, nach Ahlbeck, nahe Wolgast verlegt.
Im Winter 1945 begegneten wir dort wieder Mädchen.
Sie marschierten in Blöcken, wie wir, zum
Fahnenappell.
Ihr Anblick entzückte nicht nur mich.
In ihren schwarzen Röcken sahen sie bezaubernd aus.
Außer mir trugen die Jungen ebenfalls schwarze Uniformen. Ich ging blaugrau
gekleidet in der Tracht künftiger Piloten und sah so aus wie ein
Sechzehnjähriger. Das sagte mir jemand.
Eines Tages steckte man mir einen Brief zu. Ich
öffnete ihn erst, als ich allein war. Von einem postkartengroßen Foto lächelte
mich ein liebliches Mädchen an. Eine strahlende Schönheit. In harmonischen
Kurven geschrieben leuchteten für mich die Worte: An Gerd – deine dich ewig
liebende Inge Zühlsdorf. (Später sah ich sie oft. Wir wechselten zu keiner Zeit
irgendein Wort. Ich wusste nicht, was ich hätte sagen können)
Anfang März nach Hause und aus der Schulpflicht
entlassen, erhielten wir unsere Zeugnisse. Meins gehörte wohl zu den
Schlechtesten. 16 Vieren und eine Zwei, und die ausgerechnet in Betragen, dass
mir selber selten oder nie gefiel.
Warum mein Klassenkamerad Gerhard Schröder gerade
mich und meinen Freund Richard Schwenk, samt dessen Schwester Gerda zur
Konfirmationsfeier eingeladen hatte, blieb mir ein Rätsel.
Gerda, eine in meinen Augen, ebenfalls schöne
Blondine, ein Jahr älter als ich, kam an jenem späten Nachmittag zu mit,
nachdem wir Tortenstücke genossen hatten – etwas völlig Unbekanntes für uns,
die keine reichen Bauern zur Verwandtschaft zählen konnten, und gleich nachdem
Wein! herumgereicht wurde -: „Gerdi, Gerhard will immer wieder Brüderschaft
mit mir trinken, aber ich würde lieber dich küssen!“
Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Wir genossen
es sozusagen harmlos einander gern zu haben.
Überhaupt, dass Gerhard Konfirmand sei, blieb mir,
wann immer ich daran dachte, unverständlich.
Keiner von uns Abgängern der Volksschule glaubte an Gott. Selbst noch ein, zwei Jahre später glaubten stattdessen viele Deutsche klammheimlich und wehmütig an Adolf Hitlers beste Seiten. Schließlich brach er den Fluch jahrelanger, allgemeiner Arbeitslosigkeit in ganz Deutschland. Er gab den Mutlosen, nach der demütigenden Niederlage nach dem Ersten Weltkrieg 1918 und der folgenden Hyperinflation wieder Hoffnung, allerdings gewürzt mit deftigen Parolen, deren Schändlichkeit zu viele nicht erkannten. Er zog - angeblich - einen Schlussstrich unter die Pflicht fortlaufender Reparationszahlungen in erheblicher Milliardenhöhe, die gemäß dem Versailler Vertrag von 1919 geleistet werden musste. Heutige können sich kaum ein Bild von der Lage deutscher Eltern in der Zeit zwischen 1919 und 1933 machen: Bereits während des letzten Kriegsjahres breitete sich Angst vor einer galoppierenden Inflation aus. Das plötzliche
Misstrauen des Mittelstandes, die staatliche Finanzpolitik sei auf Täuschung der Öffentlichkeit aufgebaut, reizte und peitschte die Nerven aller. Vorsicht trieb die Händler zu überzogenen Reaktionen. Das künstliche Finanz-gefüge brach zusammen. Eine Schachtel Streichhölzer, 1910 für einen einzigen Pfennig zu erwerben, kostete im November 1923 schließlich fünfundfünfzig Milliarden Mark. Der Preis für eine einfache Briefmarke betrug 20 Milliarden.
Selbst kleinere Fabriken mussten, um das Geld zur
Löhnung ihrer Arbeiter transportieren zu können, Pferdefuhrwerke zu den Banken
schicken. In sechzig deutschen Notendruckereien spuckten die insgesamt 1723
Druckmaschinen pausenlos Geldscheine mit astronomischen Zahlen aus. Tag und
Nacht liefen die Aggregate der Papierfabriken. In dieser Zeit der Verschärfung
der Konflikte warnte der Utah-Senator Reed Smoot, der zugleich als Apostel der
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage amtierte, den amerikanischen
Kongress davor, den Bogen zu überspannen. Smoot erklärte, Deutschlands Bürger
könnten durch die maßlosen Forderungen der Alliierten ihren Reparationszahlungen
pünktlicher nachzukommen, in die Arme von Chauvinisten getrieben werden. Genau
das sollte geschehen. Und auch ich wurde in den Strudel mit hineingezogen.
Hitler-Jugend-Führer gaben uns Mitte März 45
den Befehl, zur Unterstützung der Rote-Kreuz-Schwestern. Wir begaben uns zum
Wolgaster-Fähre Bahnhof. Es würde, am späten Abend, ein Verwundentenzug aus
Swinemünde erwartet.
Während wir dem unvorstellbaren Ereignis mit
Erregung entgegensahen, hockte im kleinen Wartesaal ein beinloser Landser
inmitten einer beachtlichen Anzahl von Seesäcken und sang Heitschi-bumbeitschi.
Seine wunderschöne Stimme war leise und drang mir doch ins Herz.
Eine grobe Stimme raunzte dazwischen: „Los!
Der Zug kommt!“ Wir stürzten ins
Freie. Ich weiß nicht, was ich erwartete, doch war in mir noch das Bild aus
einer der deutschen Wochenschauen von eleganten, blitzsauberen
Verwundetenzügen. Aber schon, als sich die dunkle Silhouette der
funkenschnaubenden Lok über der grauschwarzen Mahlzower Anhöhe abzeichnete,
beschlich mich ein Gefühl des Jammers. Als wir das Bremsen vernahmen, rannten
wir den Viehwaggons entgegen. Es war noch nicht völlig dunkel, sondern gerade
hell genug, um mit Entsetzen die zerfetzten Planken zu sehen. Trotz des
Fauchens der Lokomotive hörten wir die Hilfeschreie. Plötzlich war mir das ganze Ausmaß des Elends
des Krieges bewusst. Meine Beine wurden weich, meine Glieder schlotterten.
Jemand schrie mit hoher Stimme der Empörung. „Sie
haben den Zug beschossen!“ Aus anderer Richtung kam die Bestätigung: „Ja.
Gerade jetzt, kurz vor Zinnowitz.“ Blitzschnell kam mir die Frage:
Russische Ratta oder britische Spitfire? Da wollten sie nochmals zeigen, was
sie können. Und das, obwohl wenigstens von einigen Dächern das aufgemalte
Zeichen des Roten Kreuzes hoch heraufgeleuchtet haben musste.
Als die Schiebetür, die sich unmittelbar vor mir
befand, von einem hünenhaften Waffen-SSler geöffnet wurde, schlug mir Gestank
entgegen. Der erste Mann, der vor mir lag, war tot. Ein Zweiter tastete sich
mir entgegen, fiel mir um den Hals: „Kamerad, Kamerad!“ Sein Kopf war, bis auf den Mund umwickelt,
der Verband schwarz. Ich konnte ihn geradeso auffangen. Mich durchströmte ein
Gefühl von brennender Liebe und ohnmächtiger Wut.
Wir legten ihn und
die anderen so schnell und so behutsam wie möglich auf Handkarren, um sie zum
Behelfslazarett „Wolgaster Zellmehlfabrik“ zu transportieren.
In einer der letzten
Nächte unter deutscher Herrschaft, nachdem wir weitere Schwer- und
Schwerstverletzten entgegennahmen, ertappte ich meine Mutter dabei, dass sie
BBC-London lauschte. Gebeugt stand sie vor dem braunen Volksempfänger, ihre
grüne Wolldecke um Kopf und Radio gewickelt. Unsere Schulungsoffiziere hatten
uns gelehrt auf Volksverräter zu achten. Beispielsweise wenn wir das
Bum-bum-bum-bom des Todfeinds hörten, müssten wir handeln und die NSDAP -
Ortsgruppenleiter informieren, sei es Vater oder Mutter.
Als ich den Raum
betrat drang genau dieses Signal bis auf mein Trommelfell.
In meinem Zorn fuhr
ich sie hart an.
Sie kam ebenso
zornzischend hoch. Ihre Augen funkelten herrschsüchtig. Sie wünsche nicht
gestört zu werden. Ihre weichen brünetten Haare zerzaust, drückte die helle,
nun verkniffene Stirn die ganze Kraft ihrer Persönlichkeit aus.
Ich war genügend
empört und so bereit sie anzuzeigen: “Ich rette Leben und du, du glaubst
deren Feind!”
Sekundenlang dachte
ich: Geh! Tu deine Pflicht als guter Deutscher!
Es war ein lautes
Tosen in mir. Es bestimmte mich: Strafe muss sein!
Eine leise, klare
Stimme konterte sofort: „Nein!“
Zu meinem ewigen
Glück, zögerte mein besseres Ich.
Ich stutzte, da ich
mich so widersprüchlich wahrnahm. War das die Stimme meines Gewissens? In
meiner Hilflosigkeit und aus Wut wegen der Einsicht, dass dieser, mein Krieg,
verloren war, knallte ich die Tür ins Schloss.
Immer mehr
Ostflüchtlinge trafen ein. Ihr meist kleines Gepäck wurde von uns in die
umliegenden Dörfer auf kleinen Wagen gefahren. So schritt, eines nachts eine
hochgewachsene Frau, eine ganze Stunde neben mir her, ohne ein einziges Wort zu
sagen, bis wir in Hohendorf ankamen. Was in ihrem Innersten vorging wollte ich
wirklich nicht wissen. Vielleicht war ihr Mann gefallen und sie schaute nur in
ein endloses schwarzes Loch.
Ihren zum Turban
gewickelten Schal sehe ich immer noch. Die Stadt füllte sich mehr und mehr mit
unversehrten Soldaten aller Waffengattungen. Chaos.
Zurecht drückte sich
jeder so lange wie möglich vor der immer noch eisern verlangten Pflicht mit
einem Karabiner gegen erbarmungslos rollende Panzer zu fechten. Noch nie sahen
wir so viele Uniformierte. Die Jüngsten bettelten uns an für sie ein Mädchen zu
finden und wir knapp 15-jährigen wussten sehr wohl um was es ging.
Mein
Gestellungsbefehl zum Volkssturm kam am Morgen des 22. April. Die Russen hatten
gerade bei Stettin die Oderlinie durchbrochen. In meinem Wahn, den deutschen
Sieg mittels der Wunderwaffe, doch noch für möglich zu halten. wäre ich nur
einen Monat zuvor noch töricht und sorglos losgezogen. Zumindest wollte das
mein Wunschdenken.
Die immer noch
tönende Goebbelspropaganda zeigte Wirkung. Aber nachdem ich die blutjungen,
verstümmelten Landser in meinen Armen gehalten, ihren Jammer wie meinen eigenen
empfunden hatte, war ich nicht mehr wütend zu sehen, dass meine kleine,
energische Mutter die Faust auf den Küchentisch schmetterte und beeindruckend
laut ihr kategorisches: “Nein!” herausdröhnte. Sie drückte ihr Kreuz durch und
konnte doch nicht das Angstflackern in ihren schönen grauen Augen verbergen.
Vor all diesen furchtbaren Erlebnissen hätte ich ihren Befehl nicht
respektiert. Nun aber war mir bange geworden. Die Furcht, ich könnte wirklich
vernichtet werden, hatte ein schreckliches Gesicht bekommen.
Zwei oder drei Tage vor dem totalen
Zusammenbruch der deutschen Front, abends, suchte ich meinen Freund Richard
auf. Gerda kam mir entgegen. Sie schaute mich sonderbar an, aber sie
interessierte mich zu dieser Zeit nicht. Ich hatte andere Sorgen. Es brodelte
in mir. Vor dem großen Fall müssten wir noch etwas unternehmen. Wir liefen zur
Saarstraße, wollten sehen ob Dabbert sich schon, wie zuvor die Plogs, in
Richtung Westen zu den Amis abgesetzt hatten. Dann gab es da etwas zu klauen.
SA - Dabbert war schon auf und davon. Noch
vor wenigen Tagen hatte er posaunt: “die Wunderwaffe kommt – der Endsieg!“
Breitbeinig stand er, noch vor 14
Tagen, vor uns, oben auf dem kilometerlangen, fünf sechs Meter breiten
Panzersperrgraben, den wir mit vielen Tausenden gemeinsam ausgehoben hatten.
Die Kaninchen auf die wir es abgesehen hatten waren
ebenfalls geflohen oder noch zuvor in den Dabbert-Töpfen gegart worden.
Wir standen da und ärgerten uns. Mit seinem dicken
Hintern, saß er wahrscheinlich neben seiner dürren Emma im rollenden Auto. Er
musste überlaufen, zu den Amis statt von den Russen gefasst zu werden Kein
Wehrmachtsoffizier, kein SSler wird es wagen ihn aufzuhalten, solange er seine
Dienstmütze trug.
Plötzlich kam ein Polizist angeradelt.
An den Umrissen seines Tschakos erkannten wir
das. Ein enorm schwacher Lichtstreifen fiel durch den vorgeschriebenen Verdunklungsschlitz
seiner Fahrradlampe schräg vor ihm auf die schwarze Erde.
Aus unserer miesen Stimmung heraus, bewarfen
wir ihn provokativ mit kleinen Steinen, Steinchen. Wir trafen ihn. Sofort
sprang der große Mann vom Rad und dann über den niedrigen Zaun hinter dem wir
uns befanden. Ich rannte den
Hauptweg des Neuen Friedhofs hinunter. Wenigstens bis hinter den riesigen
Komposthaufen musste ich gelangen. Da pfiff zeitgleich mit dem Knall eine Kugel
nahe an mir vorbei. Er schoss noch einmal, ich stellte mich, zu Tode
erschrocken, hinter den nächsten Baum. Da fand er mich: „Wer war der
andere?“ Ich wollte noch den Helden
spielen, erhielt ein Ohrfeige und sagte die Wahrheit.
Eine knappe Stunde später saß ich mit
Richard, den sie meines Verrates wegen von zuhause abholten auf dem Wolgaster
Rathausturm. Zur Strafe sollten und wollten wir Panzerwache halten. Waren die russischen Panzer noch
dreißig oder nur drei oder zwei Kilometer von uns entfernt? An diesem späten
Abend gab es nur diese eine Frage, die uns alle bewegte.
Gegen elf Uhr muss Gerda auf die Idee gekommen
sein, zu meiner Mutter zu rennen und ihr zu erzählen, was sie wusste und
vermutete. Mutter machte sich sofort auf den kurzen Weg zur Polizeistation, die
sich im Rathaus befand. Sie war von meiner absoluten Unschuld überzeugt. Wer weiß, was sich die Polizisten letztendlich
ausgedacht hatten. Unschuldige Kinder einsperren war das Einzige, was die
Herren sich in ihrer Ratlosigkeit noch einfallen ließen. In dieser Überzeugung
betrat sie - wie sie mir später erzählte - wutentbrannt die verqualmte Bude im Erdgeschoss, des Rathauses.
Infolge dieser Überzeugung regte sie sich auf und
griff die bösen Buhmänner mit scharfen Worten an. Es sei unerhört, in letzter
Minute ihrer Machtausübung noch einmal die Muskeln spielen zu lassen. Sie
verlange die sofortige Freilassung ihres
Sohnes, der niemanden auch nur ein Haar krümmen könnte. Herrn Wallis, den
Oberen, kannte sie persönlich. Der besuchte die Baptistenstunden und so seine
Kinder. Das hätte sie von ihm nicht gedacht.
So ein frommer Mann! Die anderen vier oder fünf Männer
pafften dicke Zigarren. Angesichts des Umstandes, dass binnen weniger Stunden
die Russen sie festnehmen werden, waren sie hoch nervös. Sie saßen in der
Todesfalle, wegen der berechtigten Vermutung, falls sie zu früh fliehen würden,
könnten sie von den noch anwesenden fanatischen
SS-Soldaten geschnappt und aufgehängt werden.
Wolgaster Rathaus
Fahnenflucht galt als todeswürdiges Verbrechen. Ihr Schicksal war besiegelt Stöhnend und pustend setzte sich der rotköpfige Wallis den Tschako (Helm) auf und bestieg die schmale Treppe zum engen offenen Raum, wo wir nichtsahnend vor uns hinstarrten. Wir hockten da inmitten des schweigenden Nachthimmels und wunderten uns über die Ruhe.
Warum hörten wir nicht das Wummern der feindlichen
Geschütze oder das Getöse von Frontkämpfen? Noch dachten wir illusorisch.
„Schert euch nach Hause!“ Verwundert und verwirrt, wie ich war, warf
ich noch einen Blick auf das im Sternenlicht blinkende Wasser des Peenestroms
und des Spitzenhörn, wo ich gerne geangelt hatte.
Am nächsten Morgen fiel mir ein, dass die
Conseurs und Schmidts ebenfalls geflohen seien. Nahe dem Gaswerk hielten sie in
kleinen Buchten ebenfalls Kaninchen. Der Schmidtsohn hatte mir am Vortag einen
Tipp gegeben.
Nichts, gar nichts warnte mich. Die kleinen
Ställchen waren natürlich leer. Missmutig machte ich mich auf den Heimweg,
wählte den kürzesten Weg. Der führte über die Schienen des Hauptbahnhofes zu
dem des Hafens.
Fast am Ziel angekommen wurde ich heftig
angeschrien: „Stopp!“
Gewohnt zu gehorchen, wenn ein Militär oder
Uniformierten befahl, erstarrte ich. Ein blutjunger Soldat stand am schmalen
Bahnsteig Er schlug die Hand vor seinen Mund. Dann wiederholte er scharf „Steh!“
Mein instinktiver
Gehorsam rettete mein Leben.
Ich
befand mich mitten in einem Minenfeld.
In meiner Verspieltheit sprang ich bislang
von einer Schienenbohle zur nächsten, die ich gerade verlassen wollte. „Siehst
du nicht die Hügel? Minen! Die hätten dich zerfetzt!“ Die Minen mussten sie gerade verlegt haben,
denn nun konnte ich erkennen um was es sich handelte.
Wäre der Landser nicht gewesen…
Der Erste Russe
Am 30. April um acht Uhr morgens heulte
etwas. Gleichzeitig bebte das alte Fachwerkhaus Langestraße 17. Die feindliche
Granate flog vermutlich nur wenige Meter an den oberen Fenstern unserer Wohnung
vorbei. Bevor ich nachdenken konnte, krachte es. Zwei Menschen, die auf der
Straße in der Nähe des Rathauses standen und hinausschauten, wurden in Stücke
gerissen.
Gegen zehn Uhr vormittags radelten zwei
Soldaten die Wilhelmstraße entlang, wo Gerda und Richard wohnten. Ein Offizier
der Marine und ein Unteroffizier der Wehrmacht. Sie zeigten ihre
Maschinenpistolen und prahlten damit, 50 weitere Soldaten der Roten Armee
„niedergemäht“ zu haben. Sie schauten auf ihre Uhren. Das musste etwas
bedeuten.
Ein Fenster öffnete sich. Zu den vielen
weißen Fahnen, die bereits an zahlreichen Fenstern um uns herumhingen, kam noch
eine weitere hinzu. Dann schrie der
Unteroffizier. „Das ist Feigheit. Wir halten immer noch die Stellung!“ Sie
fuhren weg in Richtung Hafen.
Richard zog mich mit sich. Gerda sah mich
wieder seltsam an. Ihr Blick regte mich zu neuen Gedanken an: Was sagten ihre
Augen?
Hat sie mich wortlos gefragt? „Du und nicht
die Russen?“
Richard ging irgendwohin durch die Küchentür.
Wir blieben. Wie schön sie aussah. Gerda sagte nun flüsternd: „Wenn dich
keine will, nehme ich dich.“
Angst öffnete ihren Mund. Aus vielen
Zeitungsberichten der nationalsozialistischen Presse wussten wir, dass die
brutalen unter den Eroberer Frauen wie wilde Tiere jagten.
Sie standen bereits an der Schwelle
Meine Fantasie übernahm kurzfristig die
Oberhand. Mein Freund kam binnen Sekunden zurück und schimpfte vor sich hin.
Ein Ungeheuer überfiel uns jäh. Eine Detonation die nur eine Riesenbombe
erzeugen konnte warf uns zu Boden.
Es musste in unmittelbarer Nachbarschaft
gewaltiger Schaden entstanden sein. Langestraße 17 war nur einhundert Meter
entfernt.
„Mutter!“
Meine Geschwister Helga und Helmut.
Sofort
wollte ich mir Gewissheit verschaffen und sei sie noch so schrecklich. Wie ein
Irrer warf ich mich gegen die Haustür, die sich nicht öffnen ließ. Und wenn ich
sie aus den Trümmern herausholen muss, ich will es wissen. Erst als Richard und
Gerda mir halfen die verklemmte, nach außen öffnende Tür zu überwinden sollte
es gelingen. Mit fliegenden Beinen kam ich an.
Unser Haus stand unversehrt da. Aber die großen Schaufenster der uns
gegenüberliegenden Reuscheldrogerie waren zerborsten.
Gottseidank. Wenn das alles war. Kaum
getröstet, rief eine hohe Stimme: „Sie haben die Peenebrücke gesprengt.“
Ich ging nicht hinein in unser Haus. Mich
trieb es nun vorwärts. Wohin ich auch kam, überall dasselbe, es betraf weniger
die kleinen Fenster.
Irgendwie wuchs, alledem zum Trotz, in mir die Lust zu leben. Wolgast war mit diesem Schlag, wenn auch vielleicht nur für wenige Stunden zur gesetzlosen Zone geworden. Niemandsland. Es gab weder die Polizei noch eine andere Ordnungsmacht mehr. Die glassplittrigen Öffnungen der Lebensmittelläden und des Gaugergeschäftes für Konfektions- und Schuhwaren am Marktplatz luden mich, nachdem ich umherstreunte, zur Selbstbedienung ein.
Ich widersprach mir nicht, ging die wenigen
Schritte eiligst und betrat ungeniert den Bereich für Herrenkleidung zur
Rechten. Ich gehörte nicht zu den Ersten, sah die magere Ausstattung des
Ladens. Im Begriff schamlos zuzugreifen und zu klauen was mir begehrenswert
erschien, beeinflusste mich ein schon früher erlebtes Gefühl das mir im
Klartext sagte: Tu es nicht! Das erstaunte und lähmte mich, zunächst, -
bis ich mir dreist herausnahm zu sagen: Ach was. Sei nicht so dumm. Es strömten
immer mehr Leute ins mittlerweile sperrangelweit geöffnete Geschäft hinein.
In kurzem Moment sah ich. im Geist, das noble
Gesicht des Besitzers Heller vor mir, wie er an der Kasse sitzt, während meine
Mutter den Betrag entrichtet für meinen neuen Anzug mit den Knickerbockerhosen,
den ich mehr oder weniger stolz ab 1943 sonntags trug. Die feine, leicht
gezogene Nase verlieh diesem ruhigen Gesicht eine selten anzutreffende
natürliche Vornehmheit. Mir schien, er
schaute zu, wie ich eine leichte, grüne Alltagshose an mich nahm. Die
herumwirbelnden Menschen kamen mir nun sekundenlang vor wie irrsinnig Tanzende.
Einige zankten sich. Alles raste, die Gedanken, das Blut, die Frauen. Mein
Lebensgefühl wankte. Meine Wünsche wechselten hin und her.
Jetzt ist jetzt. Eine gute Zukunft wird es
nicht geben.
Dennoch blieb das Licht der Hoffnung
hartnäckig, während andere Wolgaster in tiefem Pessimismus sich und ihren
Kindern Steine um die Hals banden. um miteinander in die Peene zu springen.
Mir schien, auch ich sei verrückt geworden.
Es war ein stetes hin und her. Man muss doch ordentlich handeln. Und dann
wieder: Mache ab jetzt mehr aus deinen Chancen, falls es noch mehr geben
sollte. Die Hose noch in der Hand verließ ich den schrecklichen Ort. Ich wollte
sie nicht mehr haben und legte sie auf die offene Luke zum Kellereingang, von
wo sie bald verschwand. Inkonstant, wie ich war, kam nur Minuten später freche
Furchtlosigkeit über mich: Mundraub ist erlaubt! Zum Kuckuck, es muss doch bei
Anderson versteckte Schokolade oder wenigstens Bonbon geben. Von Ersterem gar
nicht zu reden hatte ich seit Jahren edle Süßigkeiten entbehrt.
Während der Zeit vor unserer Verschickung
nach Groß Mölln bin ich an der Fassade das Hauses hochgeklettert und durch das
obere, immer offenstehende Fenster in die sonst verschlossene Wohnung
eingedrungen um Mutters Zuckerdose um einige Gramm zu erleichtern.
So rannte ich los um nur nicht der
Allerletzte zu sein. In der Tat, mindestens zwanzig Frauen suchten dasselbe wie
ich, oder nur Margarine, Zucker oder Grieß. Natürlich, wegen der zunehmenden
Ungewissheit, mussten sie etwas heimtragen, das die Kinder benötigten. Fast
rücksichtslos mischte ich mit. Ich wusste noch nicht, dass ein verletztes
Gewissen mit der Verkleinerung seines Potentials einhergeht, und, dass es durch
stete Misshandlung sogar zu seinem Verstummen gebracht werden kann.
Ich fand ein verstecktes Margarineregal. Über
meinem Kopf schrie jemand: „Ich habe es gewusst!“ Jemand griff danach.
Frauen rissen dem Mann der auf der Leiter stand den Pappeimer aus den Händen.
Der Karton zerbrach und die Kaffeebohnen fielen auf meinen Kopf und rieselten
zu Boden. Eine schwanger gehende Frau fing an, Gläser durch die Luft zu werfen,
voller Wut, weil sie nur Rote Bete enthielten und nicht gewünschtes Obst. Wo
immer die Gefäße landeten, wurde der Boden dunkel gefärbt.
Höllisches Spektakel. Der Ladenbesitzer, Herr
Anderson, erschien am Tatort. Er war ein kleiner 50-jähriger Mann mit großem
kahlem Kopf. "Meine Damen! Meine Damen!" klagte er und rang
seine weißen Hände. Eine der Frauen kam auf ihn zu: „Ich bin nicht ihre
Dame!“ Sie warf ihm eins der Gläser vor die Füße. Der arme Mann, jetzt mit
Saft bespritzt, schnappte nach Luft.
Doch wie sollten Männer jemals die Ängste der Frauen in dieser Zeit, der
auf uns zu rückende russische Invasion, wirklich verstehen? „Die Feindarmee
wird kommen und wir sind deren Opfer!“
Im Durcheinander hatte ich es geschafft, 16
Stücke Margarine einzusammeln, die ich, verpackt in einer Schachtel, mit nach
Hause nahm. Dann kehrte ich zurück, um einen weiteren Diebstahl zu begehen,
ohne mich mehr um mein Gewissen zu kümmern. Als ich um die Ecke unserer Straße
bog, sah ich meinen 9-jährigen Bruder Helmut mit einem großen runden Käse, der
fast so hoch war wie er selbst. Er kam den sanften Hang der Straße hinunter und
rollte das Raubgut, das ja einem Rad glich direkt auf mich zu. Nicht viel weiter die Straße hinauf befand
sich der aus mehreren Stockwerken bestehende Großvorrat an Lebensmitteln von
Herrn Kriwitz. Dort, wie überall sonst, beging die Bevölkerung aus Panik
Ladendiebstahl in erheblichem Umfang, in der möglicherweise zutreffenden Annahme
alles würde sonst in Russenhände fallen.
Es wäre leicht gewesen, einem 9-Jährigen
solchen Besitz wegzunehmen. Doch das geschah nicht Das Bild meines kleinen
Bruders und des riesigen Käselaibs wird für immer in meinem Gedächtnis haften
bleiben. Der kleine blonde Wuschelkopf lachte mich an. „Warte“, dachte ich,
„warte. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht.“Die Erkenntnis, dass das, was wir getan hatten,
doch nicht richtig war, und die Forderung, den Käse zurückzugeben, fielen im
selben Atemzug. „Das ist Diebstahl“, schnappte ich. Er erwiderte meine
Reaktion mit einem unbekümmerten Grinsen. Für ihn hat es einfach Spaß gemacht.
Schließlich erforderte das Rollen eines so großen Objekts einiges an Geschick.
Er gehorchte.
Allerdings entwickelte sich in mir nun ein völlig
anderes Konzept. Ich kam zu dem Schluss, dass ich alles, was wir mitgenommen
hatten, zurückgeben musste, und genau das habe ich auch getan, denn schlagartig
wusste ich: Selbst die schlimmsten Russen würden uns nicht verhungern lassen.
Aber, wenn wir alles vorzeitig aufteilen wird es zu selbstverschuldeten
Engpässen kommen.
Plötzlich wollte ich wieder ein guter Deutscher
sein.
Neugierig verließ ich den Keller, in dem die Frauen
angsterfüllt, vor dem was ihnen nun drohte, dasaßen. Ein paar Minuten später
sah ich den ersten russischen Soldaten.
Er bog von der Breiten Straße kommend in die Lange Straße, wo ich vor
dem Besch-Uhrenmacher-geschäft so gut wie sorglos abwartete. Der große Mann kam
die Waffe auf mich gerichtet näher und ich schaute in den höchstens drei Meter
entfernten schwarzen Lauf seiner Armeepistole. Ich war erstaunt, weil ich eine
ganz andere Vorstellung vom Feind hatte, und, weil ich keine Angst empfand.
Jahrelang hatte ich der Nazi-Propaganda zugehört,
die von den Sowjets, das Bild von minderwertigen Menschen zeichnete. Zudem
hatte ich die halb verhungerten, zerlumpten, elend dahin taumelnden Kreaturen
gesehen. Wie Vieh wurden sie durch Wolgast in weiter westwärts liegende
Gefangenenlager getrieben. Erbarmungslos, wie ich damals noch war, erkannte ich
in ihnen nicht meine Mitmenschen. Mir
kam jetzt jedoch der Gedanke: „da befindet sie ein Held vor dir!“ Er
trug einen hohen Hut aus dunklem Lammfell und über seiner Uniform einen weiten
schwarzen Umhang.
Er verzog keine Miene. Rundherum
gab es Fenster, Türen und Ecken, aus denen ein tödlicher Schuss abgefeuert
werden konnte. Er ging leichtfüßig weiter als sei ich Luft, zeigte keine Eile
und schaute beim Weitergehen weder nach links noch nach rechts. Meine Augen
folgten ihm nachdenklich. Lange nachdem er verschwunden war, blieb ich stehen,
und fragte mich: „Sind sie wirklich so?“
Mir war noch nicht klar, dass es nicht die Uniform,
nicht das Aussehen war, das Gut vom Böse trennte. So habe ich in nur wenigen
Augenblicken eine der wichtigsten Lektionen meines Lebens gelernt. So seltsam
es auch erscheinen mag. Irgendwie fühlte ich mich zu diesem Fremden hingezogen
– wenn auch nur für ein paar Sekunden. Mir wurde klar, wie falsch meine
Einstellung mein bisheriges Leben hindurch gewesen war.
Nur etwa eine dreiviertel Stunde später sah ich
einen deutschen Fallschirmspringer, der seinen runden Stahlhelm in der Hand
trug, und einen jungen russischen Offizier in Uniform. Ich ging etwas näher
heran. Sie diskutierten, vor dem Gaugergeschäft, über die Zukunft und die
Frage, was aus Deutschland werden würde, nachdem das Dritte Reich der Ära Adolf
Hitler zusammengebrochen war. Die überraschende Antwort des fließend
deutschsprechenden russischen Journalisten lautete: „Wir brauchen etwas, das
alle Nationen zusammenhält.“
Da traf es mich! „Wir brauchen etwas, das
alle Nationen friedlich zusammenhält.“
Mir
schien ich würde Zeit überspringen. Ich sah Zusammenhänge. Ich vernahm noch,
dass der gefangene Fallschirmjäger die implizite Einladung nicht ablehnte… „Es
muss eine neue Ideologie geben!“
Das war es…Es betraf uns allesamt. Aber dann! Nur eine Stunde später rollten auf zahllosen primitiven Panjewagen hunderte vielleicht tausende neue Soldaten ganz anderer Art in unsere Stadt hinein. Horden hemmungsloser, wilder Männer füllten die Straßen. Ich überredete den alten Herrn Gottschalk, auch „Leller“ genannt, unseren Helfer in unserer kleinen Firma, mit mir die neue Szene zu erkunden. Zuerst war er überrascht, dass ihn die Russen nicht belästigten. Es dauerte jedoch nicht lange, bis ein sehr junger Soldat der Roten Armee, gekleidet in ein dünnes, dunkelgrünes Baumwollhemd, dem gebeugten, rheumatischen alten Mann seine goldene Uhr abnahm. Zwei große Tränen rollten über seine faltigen Wangen, als er sich umdrehte und gestützt auf seinem Stock, nach Hause humpelte.
Was er verloren hatte, war außer seinem Bett,
sein einziger Besitz gewesen. Schreiende Frauen stürmten an uns vorbei, Soldaten
verfolgten sie. Ein Schuss fiel und wir traten beiseite, um die wütende Menge
von Räubern und Vergewaltigern an uns vorbeizulassen. Meine Verwirrung über
alles, was ich gesehen hatte, war so groß, dass ich reflexartig meine rechte
Hand hob und „Heil, Hitler“ rief, als ein älterer russischer Offizier
auf mich zukam. Der Mann in seiner grünen Uniform muss meinen Schock bemerkt
haben.
Er hätte über einen
solchen Ausbruch verärgert sein und mich auf der Stelle erschießen können –
schließlich befanden wir uns immer noch im Krieg! Fast Erwachsene wie ich
standen noch unter Verdacht, im Dienst des „Werwolfs“ zu stehen, einer Gruppe
die seit 44 unter diesem Geheimzeichen in Russisch eroberten Gebieten
weiterkämpfen sollte: Und ich Narr, habe meinen faschistischen Hintergrund
gezeigt.
Er sah mich, zum Glück, lediglich
kopfschüttelnd an, hob den Zeigefinger mahnend wie ein weiser Vater, lächelte
überlegen, und legte denselben Finger an die Stirn, drehte sich um und ging
weiter. Später traten mir andere Soldaten mit ihren Stiefeln in den Hintern,
nur weil ich sie auf meine zugegeben etwa dreiste Weise anschaute. Als die
Schießereien zwischen Deutschen und Russen erneut begannen, flohen wir in
unseren Keller. Dort saßen wir zwei Tage und Nächte lang in völliger Dunkelheit
auf Holzbänken und lauschten dem Artilleriefeuer und den Explosionen.
Deutscherseits kamen die Geschosse von der nahegelegenen Insel Usedom. Die
Frauen achteten voll zusätzlicher Angst auf jedes Geräusch, das von oben kam.
Wurde die Haustür geöffnet? Würden deren Schritte in den Keller führen? Würden
Bestien in Menschengestalt sie angreifen?
Am dritten Tag kam eine große junge Dame
hinzu. Sie setzte sich neben mich, weinte und erzählte den anderen Frauen in
meiner Gegenwart, dass sie vergewaltigt worden war, wie sie geflohen sei und
sich versteckt hielt.
Ich erfuhr Dinge die mir neu waren. In ihrer Verzweiflung erinnerte sie sich an
die Langestraße 17 und Frau Stolp, unsere Nachbarin. Sie hoffte, dort Schutz zu
finden, denn die alte Dame war Mitglied der Kommunistischen Partei und eine
persönliche Freundin von Rosa Luxemburg gewesen. Sie musste Sonderstatus
genießen. Nur Frau Stolp konnte sie beschirmen Wie es das Schicksal wollte, war
die Altkommunistin zwei Tage zuvor verstorben. Sie stürzte die steile Treppe
herunter die zu ihrer Wohnung führte. Da die junge Dame Angst hatte, sich noch
einmal auf die Straße zu wagen, saßen wir nebeneinander im kalten, dunklen
Keller. Ich fand es äußerst angenehm zu wissen, dass mein Schoß zu einem Kissen
für ihren Kopf geworden war. Völlig erschöpft weinte sie sich in den Schlaf.
Mehrmals in der Nacht zuckte ihr Körper vor Angst. Sanft fuhr ich mit meiner
Hand über ihren Kopf und ihre Wange, um sie zu beruhigen, und sie hatte nichts
dagegen.
In der fünften oder sechsten Nacht schienen
die Geräusche von draußen nicht mehr so heftig zu sein, also beschloss ich,
wieder nach oben zu gehen, um in meinem Bett zu schlafen. Der alte Freund
„Leller“ tat dasselbe. In der Ferne, einige hundert Meter entfernt, hörten wir
noch immer das Grollen von Granaten. Im Handumdrehen fielen wir in den tiefen
Schlaf.
Nach dem Krieg
Die Schießerei wurde am 8. Mai endgültig
eingestellt. Ich wagte mich wieder auf die Straße. Überall, wo ich hinschaute,
sah ich betrunkene russische Soldaten. Sie hatten eine Kuh an einen alten
Bauernkarren gebunden, auf denen weinselige, jubelnde junge Soldaten saßen und
durch die Straßen rollten. Das um ihren Hals gebundene Seil erstickte das Tier
nicht ganz und gar, obwohl es gefallen war.
Es wurde gnadenlos über das Kopfsteinpflaster geschleift und hinterließ
eine Blutspur. Meine Augen folgten der gemarterten Kreatur und die Gedanken,
die mir in den Sinn kamen, waren: „Dies ist ein Sinnbild für Krieg und Sieg. So
sieht es aus.“
Auffallend viele junge Frauen gingen
schwanger. Ich vernahm mancherlei, wenn wir gemeinsam in langer
Menschenschlange um Brot vor einer der noch intakten Bäckerei anstanden.
Eine alte Frau fragte: “Wie konntet ihr
euch entschließen in diesen Zeiten ein Kind zu haben?“ Die Antwort lautete: „Oma, weißt du, was
Soldaten uns sagten, wenn sie vom Fronturlaub heimkamen? Mädel, ich komme nicht
wieder. Sie wussten es. Ich wollte etwas Lebendiges von ihm behalten!“
Sie hatten verwüstete Orte gesehen. Völlig
verstört hatten sie zu viel erlebt. Ihre Ehemänner, Väter und Brüder waren nun
Gefangene im unwirtlichsten Land der Erde, tot oder verkrüppelt. Es gab keine
andere Hoffnung, keine andere Zukunft. Aber, wir sahen auch Männer der Roten
Armee, die aus der rasenden Menge herausstachen, disziplinierte, gebildete wie
der erste Russe, dem ich begegnete.
Ich erinnere mich an den Tag, als ein Konvoi
installierter LKW-Raketen (Stalin Orgeln) vor unserem Haus anhielt. Inmitten
disziplinierter Soldaten saß mein kleiner Bruder. Auf seinen strohblonden Kopf
hatten sie einen riesigen, dunklen Stahlhelm gesetzt. Lachend reichten sie ihn
herum wie eine Stoffpuppe und gaben ihm Kekse. Was sie amüsant fanden, war,
dass der kleine Kerl ein braunes und ein blaues Auge hatte. Diese Männer waren
äußerst zivilisiert, da keiner von ihnen das Fahrzeug verließ, um in unser Haus
einzudringen um es auszurauben. Viele Einheimische beleidigten wahllos alle
Russen. Das war wirklich nicht fair. Es gab Soldaten, die zu uns nach Hause
kamen und versuchten, auf unserem Klavier zu spielen, aber sie waren fast immer
freundlich. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir noch nicht erklären, warum
Menschen aus der gleichen Umgebung aus demselben Hintergrund kommend sich gut
oder grottenschlecht aufführten.
Im Juli 1945 arbeitete ich für die Rote Armee
auf der noch heute bestehenden Wolgaster Werft. Damals wurde dort Zellmehl
hergestellt. Ein kleines, kohlegetriebenes Kraftwerk befand sich dort
ebenfalls. Wir mussten brikettgefüllte Waggons entladen. Mir schien, dass viele
Leute die hier arbeiten mussten, sich häufig in den riesigen Hallen
versteckten. Pärchen schliefen zwischen den tausenden Säcken Zellmehl. Auch wir
hatten es nicht besonders eilig mit unserer Schaufelei. Hin und wieder wurden
wir von bewaffneten Rotarmisten kontrolliert. Dann legten wir los, dass es nur
so staubte. Abends mussten wir unsere ehemaligen Schulranzen öffnen. Am Eingang
schauten die Soldaten hinein. Wir nahmen stets ein paar Brikett mit nach Hause.
Wir meinten, dass sei gerechten Lohn für die Zeit die wir zu opfern hatten.
Ähnlich dachten die jungen Russen, die stets Machorka qualmten. Einmal zählte
der Kontrolleur sieben kiloschwere Briketts und fluchte entsetzlich. Mit
erhobenen sechs Fingern bedeutete er mir, wo die Grenze war. Ich sei ein Dieb.
„Zapzarap nix karascho.“ Wir lernten, wir verstanden: Schließlich hätten wir
uns an russische Gepflogenheiten zu orientieren. Es gab auch
Zuckerrübenschnitzel aus denen wir Sirup kochten. Ich akzeptierte, dass etwa
vier Kilogramm Schnitzel als tägliche legitime Beute galten. Da gab es Leute
wie den 50-jährigen Friseur Bikowski, der zuvor Tabakwaren auf dem Schloßplatz
verkaufte, wo sein kleines, schönes Haus einst, in unmittelbarer Nähe zur
Peenebrücke stand. Die Druckwelle infolge der Brückensprengung hatte es dem
Erdboden gleich gemacht. Er saß stets auf einem Tor Steg der Kohlewagen und
rauchte. Sobald die russischen Aufpasser auch nur in Sichtweite kamen, klopfte
er seine Schippe geräuschvoll gegen die Metallwand des Waggons und stöhnte
laut. Ich fand ihn nie anders.
Aus Langeweile und Torheit schwammen meine
Freunde und ich, während einer Mittagspause etwa 150 Meter auf die andere Seite
der Peene, an das Ufer der Insel Usedom. Niemand durfte dieses kleine Stück
Land betreten. Nur teilweise durch
Stacheldraht geschützt, lagerte dort eine riesige Ansammlung zurückgelassener
deutscher Waffen. Denn dort befand sich eine der letzten Hauptkampflinien des
Krieges: Dutzende große Holzkisten mit Munition aller Art warteten nur auf uns.
Große Warnschilder die uns die Todesstrafe androhten beeindruckten uns nicht.
Jungs bleiben Jungs – und manchmal sind sie einfach nur dumm! Innerhalb weniger
Minuten schnappten wir uns Gewehre und begannen in die Luft zu schießen.
Munition, die wir gefunden und verwendet
haben, war Leuchtspur-munition! Was für eine wunderbare Lichtshow!
Wir malten die erstaunlichsten Lichtstreifen
in den endlosen blauen Himmel. Dass andere nun genau wussten, wo wir uns
befanden, störte uns zunächst nicht. Schließlich konnten wir schnell schwimmen
und uns verstecken. Ich für meinen Teil fühlte mich wie Robinson Crusoe auf
seiner abgelegenen, freien Insel – einer Welt, die niemandem außer ihm gehörte.
Allerdings lag Klein-Zinnowitz nicht im Pazifik – es war nur einen halben
Kilometer von Wolgast entfernt.
Zu diesem Zeitpunkt ignorierten wir, dass die
Russen immer noch rachsüchtig und wütend auf die Deutschen waren, dass sie uns
packen und wirklich an die Wand stellen würden. Wir haben es mutig und
mutwillig gewagt, ihre Gesetze zu brechen. Plötzlich hörten wir das typische
Summen eines Tieffliegers. Bald sahen wir einen riesigen Doppeldecker auf uns
zukommen. Wie ein bunter Käfer schwebte er heran. Nicht mehr als 80 Meter über
unseren Köpfen. Wir starrten auf den großen roten sowjetischen Stern auf seinen
hellblauen Flügeln. Wir sahen den Kopf des Piloten. Er aber konnte uns nicht
entdecken. Sieben Gewehre waren auf dieses riesige Ziel gerichtet. Und unsere
Mütter hielten uns allesamt für brave Jungs. Denn jeden Abend brachten wir
Nützliches heim. Zu unserem ewigen Segen hat keiner von uns den Kopf verloren
und geschossen.
Was oder wer hat uns vor diesem tödlichen
Spiel gerettet? Ich weiß nur, dass es keiner von uns war. Der Name unseres
rettenden Engels war Buena Bergemann. Er erschien plötzlich. Auch er war wie
wir früher Mitglied der Hitlerjugend gewesen. Er tauchte unversehens hinter dem
Stacheldrahtzaun auf und schrie: „Was zum Teufel macht ihr Idioten?“
Sieben besiegte, sonst so clevere Jungs legten beschämt ihre neu entdeckten
Spielzeuge auf den Boden.
In diesem Moment bemerkten wir, dass in
einiger Entfernung, nämlich in der Nähe der großen Brücke, etwa 800 Meter
entfernt, ein Boot der Militärpolizei kreiste. Wenn die Militärpolizei uns
erwischt, wäre das definitiv unser Ende. Wir mussten so schnell wie möglich
fliehen. Zu viele Augen hatten unser Spiel gesehen. Zu viele Ohren hatten das
Abfeuern unserer Pistolen und Karabiner gehört. Als wir, nach heftigem kraulen
die Leiter zum Pier hinaufstiegen, dachten wir: „Wir sind außer Gefahr.“ Doch
dort warteten die russischen Soldaten auf uns und zogen uns über die Böschung.
Niemand kann alle Konsequenzen seines Handelns vorhersehen, selbst wenn seine
guten Absichten auf Steintafeln geschrieben stünden, geschweige denn, wenn
seine Motive böse wären. Wir standen fast nackt da, umgeben von Soldaten, die
ihre Maschinengewehre auf uns gerichtet hatten.
Zitternd in unseren abgewetzten schwarzen Badehosen schauten wir auf die
reglosen Bewaffneten. Alles in uns und
um uns herum erstarrte – sogar die Zeit. Endlich! Ein Jeep kam mit hoher
Geschwindigkeit auf uns zu, gefolgt von einer Staubwolke. Ein riesiger Mann in
grüner Uniform erhob sich, „der Stadt-kommandant“! Seine Brust war mit vielen
Medaillen geschmückt. Neben ihm saß ein junger, dürrer Fahrer.
Sobald der Jeep zum Stehen kam, sprang der
Offizier von seinem Sitz. Mit breiter Brust und schweren Schritten, den
riesigen Kopf zum Boden gesenkt, schritt er auf uns zu, wie ein gereizter
Stier. Er war zum Racheengel für alles geworden, was die SS und die deutsche
Wehrmacht seinem Volk angetan hatten. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Er
war offensichtlich bereit, alles zu vernichten, was ihm ungut erschien. Er
kontrollierte die Szene vollständig. Ein Wort, eine Handbewegung seinerseits
und alles, was wir zuletzt gesehen hätten, wäre das Blitzfeuer aus den
„Spagin“-Maschinengewehren. Der Riese brüllte wie ein verwundetes Tier. Doch je
länger er schrie, desto mehr hofften wir, dass die auf uns gerichteten Waffen
nicht abgefeuert würden. Irgendwie hatte ich für ein paar Sekunden sogar die
leise Hoffnung, dass sie uns gehen lassen würden. Wir wussten nicht, dass
zwischen Leben und Tod die gefrorenen Ebenen Sibiriens oder Karagandas liegen
und nur auf Kriminelle wie uns warteten. Viele Gedanken schwirrten in meinem
Kopf herum und verursachten letztendlich das totale Chaos. Ich bin überhaupt zu
keinem Schluss gekommen. Am Ende konzentrierte sich meine ganze Sehnsucht auf
einen verrückten Wunsch: dass ein Wunder geschehen würde. Unser Arbeitsleiter
Herr Kell ein bekanntes Mitglied der Kommunistischen Partei wagte es sich dem
grimmigen Kommandanten entgegen zu stellen, während die Soldaten schweigend mit
ihren Waffen dastanden und immer noch auf die Weisung ihres Kommandeurs
warteten. In scharfem Ton sprachen drei Männer laut und schwangen ihre langen
Arme hin und her, während der Wortfluss übersetzt wurde. Zuerst haben wir
überhaupt nichts verstanden. Mr. Kell, mit der roten Schleife um den Arm, ein
ruhiger, freundlicher Mann, schwor sein eigenes Leben, um uns zu retten. Er
garantiere, dass so etwas nie wieder passieren wird. Das Unglaubliche geschah.
Der russische Offizier mit seinem grimmigen
Gesicht und der übergroßen Nase erwies sich uns gegenüber barmherzig.
Vielleicht hatte die SS seine eigenen Söhne erschossen, vielleicht hatten sie
das gleiche jüdische Aussehen wie ihr Vater. Am Ende entschied er: „Lauft
ihr Banditen!“
Wir rannten in alle Richtungen davon. Ich
kroch in einen kleinen Raum im Maschinenraum, wo ich lange Zeit wie gelähmt
saß. Zu Hause gab es kein einziges Wort darüber. Die schlimme Nachricht
erreicht die Familie irgendwann, wenn alles der fernen Vergangenheit angehört.
Was war wirklich passiert? Hunderte, ja, Tausende von Menschen, die weniger
begangen hatten als wir, wurden in die Todesfallen von Konzentrationslagern wie
Waldheim zum Sterben geschickt oder ihrer Gesundheit für immer beraubt. In den
Gulag-Gefangenenlagern von Irkutsk litten Zehntausende die weitaus weniger als
wir verbrochen hatten. Die meisten von ihnen kehrten nie wieder nach Hause
zurück. Zwei meiner Freunde sollten ein ähnliches Schicksal erleben.
Kurz darauf machte ich mich auf die Suche nach einem
geeigneten Ort, um die Kamera meines Vaters vor den Russen zu
verstecken. Sie hatten angeordnet, dass alle Fahrräder, Kameras und
Radios abgegeben werden müssen. auch Klaviere usw. Ich entdeckte auf unserem
Dachboden eine verschlossene Kiste, die ich öffnete, und fand antimormonische
Literatur. Bücher, die jeweils von Pastor Zimmer und Pastor Rößle
verfasst worden waren. Vater hatte diese Werke offensichtlich gelesen, um eine
Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Wenn er die Literatur unten im
Bücherregal gelassen hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht von Neugier
angetrieben worden. Aber jetzt reizte mich das Verborgene. Etwas
Magisches erwartete mich. Etwas, das nur darauf wartete, entdeckt zu werden.
Ich machte es mir unter einem der kleinen Fenster bequem und las hoch
konzentriert beide – das des Pfarrer G. A, Zimmer: „Unter den Mormonen in Utah“
1907 veröffentlicht, sowie das Werk Rößles „Aus der Welt des Mormonentums“
1930.
Und das geschah, während draußen noch große Unsicherheit
dominierte. Die Berichte dieser beiden Pastoren hatten eine seltsame, aber
starke Wirkung auf mich. Sie waren fesselnder geschrieben als die Romane von
Karl May, von den ich zuvor 5 oder sechs Bücher geradezu verschlungen
hatte. Mein Gefühl, dass hier etwas von großer Bedeutung für mein
zukünftiges Leben vorlag, wuchs.
Mit jeder Seite, die ich umblätterte, kam mein Wunsch
auf, die Religion und Kirche meines Vaters, der ich nur nominell angehörte,
gründlich zu erkunden.
Allerdings wollte und konnte ich mich erinnern.
Wenige Tage vor dem Ausbruch des 2.
Weltkrieges wurde ich, auf Wunsch meines Vaters von einem sehr jungen
Mormonenältesten in Wolgast, im Peenestrom getauft. Um was es ging begriff ich als damals
neunjähriger nicht, außer, dass es sich um etwas Gutes handelt.
Es war mein Geburtstag. Geschenke erhielt ich
nicht. Aber, als ich aus dem Wasser wieder auftauchte, fühlte ich pure Freude,
die längere Zeit anhielt.
Ich staunte wenige Tage danach, dass mich
gleichaltrige auf dem Schulhof spottend umrundeten und mich höhnisch einen
„Heiligen“ nannten. Mir war damals keineswegs bewusst, dass ich nun der „Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage“ angehörte. Welch ausfallender Name.
Erst einige Jahrzehnte später erfuhr ich,
dass es um das Jahr 160, im vorderasiatischen Raum eine gewisse
Urchristengruppe gab die sich ebenfalls die „Gemeinde der Heiligen der Letzten
Tage“ nannte und dass Kirchenvater Tertullian Teil von ihnen war. F. Loofs, Dogmengeschichte, Halle
Saale-Verlag 1950
Im Verlaufe der Kriegsjahre nahm ich nur
kleine Bruchstücke von jener Religion auf,
die mein späteres Leben erfüllen wollte. Vater, ein Pazifist durch und durch, bedauerte, dass er wegen Hitlers
ungerechtfertigte Kriege, seinen Einfluss auf mich verlieren würde. Die nächste
Mitgliederfamilie lebte in 100 km Entfernung. Er ahnte es schon:
Mutters Einfluss würde ich selten zulassen, und so stand ich bald eigenständig im Denken und Wollen da. Kurz vor Vaters Einberufung gab es noch ein mich vorübergehend be-rührendes Ereignis. Am Strand von Zinnowitz verfolgte ich passagenweise ein längeres Gespräch, das die Missionare
Ältester Dzierzon, rechts Ältester Wächtler mein Bruder Helmut im Hintergrund neben unserem Vater.
Dzierzon und Rudolf Wächtler mit meinem Vater
führten. Irgendwie ließ ich einiges, was sie sagten, in mein Herz sinken – und
doch vergaß ich es, im Trubel der Kriegsjahre.
Einer der beiden Männer sagte sinngemäß: „Schließlich
haben wir uns in der vorirdischen Welt. nach Ewigkeiten unserer Gottesschau,
ziemlich gelangweilt. Gottes
Herrlichkeit war uns zur Selbstverständlichkeit geworden. Irgendwann
fühlten wir Geistkinder Gottes uns einfach leer. Wir konnten keine Freude
empfinden, weil wir Traurigkeit nicht kannten. Uns fehlte ein Maßstab, ähnlich
so wie es Kindern superreicher Eltern ergeht.“
Die Lehre von unserem vorirdischen Dasein sei
verloren gegangen. In den Theologien der Kirchen kam dieses Thema nicht mehr
vor.
Die Erschaffung des Weltalls und Planeten
Erde – all diese Dinge hätten einen großen Zweck.
Zufälle alleine hätten nur Chaos zustande
bringen können.
Ich hatte somit
schon den berühmten Ariadnefaden flimmern gesehen, um ihn wieder aus den Augen
zu verlieren.
Nun Rößles Werk in der Hand dachte ich
lange nach. Erstens setzte ich bis dahin voraus, dass Pastoren keine
leichtfertig gefassten Meinungen äußern dürfen. Zweitens, dass Unwahrheiten aus
Geistlichenmund sich von selbst verbieten.
Rößle jedoch widersprach sich selbst und drittens, der Tonfall ließ auf
Hass schließen, der Sachlichkeit kaum zulässt: Auf einer Seite behauptete er: „Unzählige Deutsche werden mit Lehren
befleckt, die sie glauben machen, das sei alles himmlische Nahrung für ihre
Seelen… Diese gottlose Priesterschaft,
die Tausende verführt hat, das Wort Gottes mit Füßen zu treten und die das
Heilige durch den Staub zerrt... müsse entlarvt werden... Aber dann glaubt Rössle, dass Joseph Smith vielleicht ein
ehrlicher Mann war: „Sein Charakter ist
sehr umstritten. Mormonen halten ihn für den größten Märtyrer des Jahrhunderts
und den größten Mann, der in unserer Zeit gelebt hat. Seine Feinde nennen ihn
einfach einen Lügner. Andere sagen, dass Joseph Smith selbst an seine fantastischen
Offenbarungen glaubte und glaubte, er sei ein Instrument in den Händen Gottes. Mit all diesen Fakten entwickelte er eine
erstaunliche Fähigkeit, die Zukunft zu planen. Darüber hinaus verfügte er über
Kenntnisse in Arbeits- und Geschäftsangelegenheiten. Seine Freundlichkeit und
Liebe gegenüber allen Menschen wurde immer geschätzt, insbesondere von den
bescheidenen und ungebildeten Menschen, die ihn verehrten.“ Rößle schlussfolgerte: „Staat und Kirche müssen sich vereinen, um
den Mormonismus auszurotten. Ich kann es nicht laut genug betonen: Das Ziel der
Mormonen ist es, die ganze Welt zu bekehren und damit die gesamte Menschheit zu
versklaven. Das gesamte System ist auf dieses Ziel ausgerichtet. Dies ist der
Zweck ihrer umfangreichen missionarischen Bemühungen. Man muss sich auch
darüber im Klaren sein, dass der Mormonismus im Gegensatz zum Islam steht,
obwohl er in vielerlei Hinsicht die
gleiche Fähigkeit besitzt, sich an alle Traditionen, Situationen und Ansichten
anzupassen, sogar bis zu dem Punkt, alle Glaubensrichtungen zu
übernehmen.“
Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, fügte
Pastor Rößle hinzu: „Diese nominell noch
kleine, völlig andere Kirche wird eines Tages globalen Status erlangen. Diese
amerikanische Kirche ist ein gefährlicher, oberflächlicher Glaube mit einem
völligen Mangel an biblischem Wissen, unterstützt durch die Macht Satans. Unter
dem Banner des Evangeliums verbreiten sie ihre Lehren. Aufgrund ihrer
satanischen Kräfte wird die Mormonensekte zu einer Weltmacht und einer großen
Gefahr für die Nationen der Erde werden.“ Ende der Zitate
Pastor Zimmer fand noch schlimmere Worte, obwohl er viele Mitglieder dieser Kirche persönlich kannte. Zwei Jahre lebte er mit ihnen gemeinsam. Sein Urteil wog also.
Wenn die bissigen Autoren geahnt hätten,
welche Wirkung ihre Behauptungen auf Menschen meiner Art haben könnten, würden
deren Feder immer noch unberührt in ihren Tintenfässern stecken.
Wusste Rößle nicht, welche typischen
Voraussetzungen eine religiös- oder ideologisch ausgerichtete politische
Bewegung von Weltrang haben muss, um den Rest der Menschheit zu versklaven?
Hitler, Lenin und Stalin, die tatsächlich
die Versklavung der Menschheit anstrebten, mussten zunächst zu ihrem eigenen
Schutz, einen militärisch ausgestatteten,
hochdotierten Überwachungsapparat um sich herum aufbauen. Der nächste
Schritt, den sie unternehmen mussten, bestand darin, Armeen, die aus Massen
gekaufter, geistloser Menschen bestanden, mit Waffen auszurüsten. Sobald diese
Strukturen deutlich sichtbar wurden, und Unschuldige willkürlich verhaftet
wurden, konnte allseitig Angst auf Harmlose einwirken. Angst ist das
Schlüsselwort zur Unterwerfung potentieller Opfer.
Aber Mormonismus erzeugt Freiheit des
Denkens und Handelns.
Die Pastoren Rößle und Zimmer zeichneten
leichtfertig Zerrbilder die tatsächliche Angst vor den Mormonen bewirkte. Bis
ins 21. Jahrhundert hinein herrscht diffuse Ablehnung selbst unter sonst hoch
Gebildeten, zumindest aber Desinteresse.
Während des Lesens der „Werke“ Zimmers und Rößles war mir klar geworden: Beide
Pastoren empfanden sehr wohl großen Respekt vor der, dieser Religion
innewohnenden Kraft. Zum anderen: Sie wollten ihrer Kirche dienen, die sie als
perfekt und absolut gut betrachteten, und scheuten sich dennoch nicht etwas, eine
Religion und ihre Menschen die ihnen lediglich als fremd und unbequem erschienen,
vernichtend zu beurteilen. Charles Dickens (1812-1870) der scharfblickende,
berühmte Autor von „David Copperfield“, „Oliver Twist“ und „A Christmas
Carol“ hörte von den berüchtigten, auswanderungswilligen Mormonen – den
englischen, walisischen, schottischen Mitgliedern der Kirche Jesu Christi. Dickens 38-jährig
der Heiligen
der Letzten Tage. Auch er wollte sich ein Bild vom Wesen dieser Leute machen: „An
einem Junimorgen im Jahr 1863 bestieg Charles Dickens das Segelschiff Amazon an
einem Londoner Dock, um mit eigenen Augen zu sehen, was zu dieser Zeit ein
bekanntes Phänomen geworden war: eine Gesellschaft von Mormonen, die nach
Amerika und schließlich über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinausgingen
zu den Wüsten des Great Basin. Bis 1863 hatten bereits buchstäblich Tausende
von Briten diese Reise und Wanderung unternommen, und die unkonventionellen
Methoden der Mormonen waren bekannt geworden. Die Mormonen waren organisiert
wie keine andere Gruppe. Sie hatten ihre eigene Schifffahrtsagentur, sie
charterten Schiffe, sie hatten erfahrene Anführer, sie sorgten für die
Überlandausrüstung, nachdem der Auswanderer an der Grenze angekommen war, und
sie hatten eine Methode, den Armen durch die Selbsthilfegesellschaft Perpetual
Emigrating FundCompany zu helfen. Diese einzigartigen Merkmale der mormonischen
Auswanderung erregten die Aufmerksamkeit vieler, einschließlich Charles
Dickens. Andere (darunter Lord Houghton, der in der Edinburgh Review vom Januar
1862 schrieb) hatten gesagt, die Atlantiküberquerung sei normalerweise nichts
weniger als ein Albtraum gewesen, bemerkten aber, dass Mormonenschiffe wie eine
Familie seien „mit starker und akzeptierter Disziplin, mit jeder Vorkehrung für
Komfort, Anstand, und inneren Frieden." Diese Faktoren machten die
Überfahrt eher zu einer humanen als zu einer gefürchteten Erfahrung, und
Dickens bestätigt in seiner typisch beschreibenden Art die Ansicht, dass eine
mormonische Auswanderung deutlich besser als die Norm war.
“Achthundert was? „Gänse, Bösewichte?“ ACHTHUNDERT MORMONEN. Ich, (Charles Dickens), war an Bord dieses Auswandererschiffs gekommen, um zu sehen, wie achthundert Heilige der Letzten Tage aussehen, und ich fand sie (zur Niederlage all meiner Erwartungen) so, wie ich es jetzt beschreibe. (Ich sprach mit) dem Mormonen-Agenten, der aktiv daran beteiligt war, sie zusammenzubringen..., um sie auf ihrem Weg zum Großen Salzsee bis New York zu bringen. Ein kompakt gebauter, gutaussehender Mann in Schwarz, ziemlich klein, mit sattem braunem Haar und Bart und klaren, leuchtenden Augen. Ein Mann mit einer aufrichtigen, offenen Art und einem unbeugsamen Blick; dabei ein Mann von großer Schnelligkeit. Ich glaube, er hatte keine Ahnung von meiner Unkommerziellen Individualität und folglich von meiner immensen unkommerziellen Bedeutung: „Das sind sehr gute Leute, die Sie hier zusammengebracht haben.“ „Ja, Sir, das sind sehr feine Leute.“ (Charles Dickens) der UNKOMMERZIELL schaut sich um: „In der Tat, ich glaube, es wäre schwierig, irgendwo anders 800 Menschen zusammen zu finden und unter ihnen so viel Schönheit und so viel Kraft und Arbeitsfähigkeit.“ Geschichtssektion der BYU, Provo
Anders als Rößle kannte ich bereits eine Anzahl Missionare
dieser Religion, deren Erscheinung ich als angenehm empfand. Ebenso missfiel
mir nicht was sie lehrten, soweit ich wusste und es verstand. Es ging um eine
Weltanschauung die nun, wenn auch sehr, sehr langsam meine eigene werden wollte.
Bereits 1936 kamen die ersten unserer Missionare in meiner
Heimatstadt an. Das erfuhr ich später. Johannes Reese, der Freund meines
Vaters, erklärte zunächst seine Abneigung:
Sommer 1937. Links: Elder
Larson, mein Vater, Wilhelm Skibbe, Johannes Reese, Frau Schmidt und Elder
Holt.
„Wenn ihr missionieren wollt, warum geht ihr dann nicht nach
Afrika? Wusstet ihr nicht, dass Europa schon vor mehr als 1000 Jahren
christlich wurde?“
Als Antwort stellte ihm Elder Holt die Frage: „Glauben Sie,
dass alle Christen, Christen sind?“ Das erschütterte Johannes‘
Selbstvertrauen. Diese wenigen Wort
fielen auf fruchtbaren Boden. Reese las statt Antimormonen-Literatur
fortan die ganze Palette neuzeitlicher Offenbarungen und war sowohl verblüfft wie
erfreut. Sechs Jahre danach,
nur wenige Monate bevor die russischen Streitkräfte in Wolgast
einmarschierten, sagte Herr Johannes Reese, in einer meiner Klavierstunden in
geradezu feierlichem Ton: „Ich fühle es deutlich, deine Kirche verbreitet
weitaus mehr Wahrheiten als jede andere.“ Und dann, wenig später,
irgendwann, fügte er hinzu: „Joseph Smith ist ein wahrer Prophet!“ Er
schaute mir direkt in die Augen nachdem er mit seinen langen, eleganten Fingern
die letzten Akkorde eines neuen Stückes gespielt hatte, Jetzt, oben auf dem
Hausboden, als ich noch Zimmers Hassbuch in den Händen hielt, berührte es mich.
Reeses Bekenntnis gehörte nun zu den ersten farbigen Steinen eines riesigen
Mosaiks, das ich bislang nur flüchtig und in groben Umrissen sah. Aber, der
Alltag sollte bald meine gegenwärtige Sichtweise verdunkeln und meine zeitweise
erhabene Stimmung dämpfen.
In jenen Tagen des intensiven Studiums feindlicher Stimmen,
dachte ich an weit Zurückliegendes. Fast Vergessenes sah ich wieder, und es war
mir nicht unangenehm: Ich erinnerte mich, ich war wahrscheinlich erst 5 Jahre
alt und hielt eine kleine Papierfahne mit einem aufgedruckten Hakenkreuz in der
Hand. Ich war sehr stolz. Die braun gekleideten SA-Männer mit ihren glänzenden
goldenen Instrumenten hatten mich glücklich gemacht. Was für eine Freude war es
gewesen, dem Tambourmajor, mit seinem reich verzierten, mit Kordeln bestickten
Taktstock, zuzusehen! Wie er ihn herumwirbelte, ihn dann hochwarf und
wieder auffing. Mir kam es so vor, als wären alle Zuschauer genauso fasziniert
wie ich. Immer noch verzaubert von allem, was ich gerade gesehen hatte, kehrte
ich nach Hause zurück. Als ich ankam, saß Vater wie eine Statue mit seiner
großen Bibel auf seinem Lieblingssitz. Als ich vor ihm stand, schüttelte er
seinen kahlen Kopf. Er sah mich und meine bunte Flagge deutlich unzufrieden an
und forderte mich auf, näher zu kommen. Er nahm mir einfach die schöne Fahne
aus der Hand, was mich traurig machte. Kurz darauf, vielleicht auch erst ein
Jahr später, erhielt ich meine einzige Tracht Prügel von ihm. Das lag daran,
dass ich zuvor die Haustür unseres Vermieters, Herrn Eckdisch, geöffnet und ihm
frech gesagt hatte, er sei ein „Judenschwein.“ Dieser pummelige,
fröhliche kleine Mann, Vater von zwei erwachsenen Kindern, muss direkt zu
meinem Vater gerannt sein und ihm gesagt haben: „Ihr Sohn hat mich beleidigt.“
Ich wurde von Vater herbeigerufen. Er legte mich mit dem Gesicht nach unten auf
sein Knie, zog einen Filzschuh aus und schlug mich! Es tat nicht wirklich weh.
Die Worte hallten immer wieder in perfekter Harmonie mit dem Rhythmus des
Pantoffels: „Vergiss es nie, mein Sohn: Alle Menschen sind Kinder Gottes!
Verstehst du? Alle Menschen sind Kinder Gottes!“
Mutter erzählte später, dass es um 1936, viele Gespräche zwischen
Vater und unserem Vermieter, Herrn Eckdisch, gab. Vater versuchte ihn vor der
miserablen Zukunft und den bevorstehenden Ereignissen zu warnen. „Sehen Sie,
Herr Eckdisch, lesen Sie es selbst“, und er zitierte Hesekiel 37:21:
„Und so spricht der Herr, Gott; Siehe, ich werde die Kinder Israel aus den
Nationen herausführen, wohin sie gegangen sind, und ich werde sie von allen
Seiten sammeln und ich werde sie in ihr eigenes Land bringen.“ „Seien Sie
weise, verkaufen Sie Ihre Häuser, nehmen Sie das Geld, kehren Sie in das Land
Ihrer Vorfahren zurück.“
Er hätte Herrn Eckdisch auf andere ähnlich lautende Verse
hingewiesen. Dazu gehörten Prophezeiungen von Joseph Smith, der 100 Jahre zuvor
vorhersagte, dass Juden aus den entlegensten Winkeln der Erde in ihrem
Heimatland Palästina versammelt würden. Mein Vater soll gesagt haben, dass ein
jüdischer Konvertit namens Orson Hyde, den Joseph Smith berufen hatte, 1838
nach Palästina reiste, um das Land für die Rückkehr der Juden zu weihen.
Die Bemühungen Vaters waren erfolglos; Herr Eckdisch hätte nur
mit den Schultern gezuckt. Dieser kleine „Mormone“ konnte ihn nicht davon
überzeugen, alles aufzugeben, wofür er gearbeitet hatte. Sein Leben in
Deutschland sei gut. Vater wies Herrn Eckdisch auf Hitlers Programm, bezüglich
der Juden, hin. „Nein“, beharrte unser Vermieter: „Wir Juden haben
alles überlebt, was die Vergangenheit uns angetan hat. Wir werden auch Herrn
Hitler überleben. Ich bin Jude polnischer Nationalität. Deutschland ist
heutzutage ein zivilisierter Ort.“
Die Einwanderung hätte die Familie Eckdisch nur 4 000 Dollar
gekostet.
Die fünfte Aliyah (Einwanderungswelle) brachte zwischen 1933 und
1936 etwa 170.000 Juden nach Palästina. Die Prophezeiungen und die falsche
Hoffnung standen in scharfem Kontrast zueinander. Nur wenige Monate später
stürmte die schwarze SS das große Haus in der Wilhelmstraße 53. Innerhalb
weniger Minuten löste sich der vermeintliche Schutzstatus in völlige Verwirrung
auf.
Ja, ich kann in etwa sein Gesicht sehen – ich kann mich sogar an
seinen Namen erinnern. Der starke Mann mit der schwarzen Mütze, auf deren
Vorderseite ein silberner Totenkopf prangte hieß P.
Die Blicke, die er mir kleinem Wicht zuwarf, waren kalt.
SS-Männer, Bürger von Wolgast, schoben die vier verängstigten Mitglieder der
Familie Eckdisch schnell auf einen wartenden Lastwagen.
Irgendwann müssen diese polnischen Juden Warschau erreicht
haben, denn im Oktober 1944 traf eine Postkarte aus einem polnischen Ghetto
ein. Die Wahrheit ist, dass ich, Gerd, diese Post, abgestempelt in Warschau, in
meinen Händen hielt:Sie bestand aus nur sieben Worten: „Vater tot, Mutter
tot, Lotte tot. Jakob.“
Jakob, der kräftige Sohn unseres Vermieters, hielt mich oft auf
dem Schoß, als ich noch ganz klein war, ebenso wie Lotte, die etwa 20 Jahre alt
war. Irgendwann fragten wir uns, wie oft dieser Familie die gut gemeinten Worte
eines Mormonen namens Wilhelm Skibbe reumütig in den Sinn kamen.
Nach den Erlebnissen des Sommers 1945 war ich gegenüber Mutter
höflicher.
Ich befragte sie wiederholt Und so erfuhr ich mehr Wichtiges:
1937, als sie gerade 29 Jahre alt war, diagnostizierte man bei ihr
fortgeschrittene Tuberkulose. Sie wurde in die Universitätsklinik Greifswald
eingeliefert. Ihre Röntgenaufnahmen zeigten sieben bohnengroße Löcher in der
linken Lunge. Die Chirurgen beschlossen, die betroffene Lunge still zustellen.
Vater, der das Schlimmste befürchtete, schickte eine Karte nach Demmin, weil
dort die Missionare stationiert waren. In seiner Post bat er sie, in die Klinik
zu kommen, um Mutter einen Segen zu geben.
Als Bruder Latschkowski das Zimmer betrat, in dem Mutter neben
anderen Frauen lag, winkte sie ihm zu. Er zuckte mit den Schultern und ging zu
ihrem Bett, wobei er zum Ausdruck brachte, dass er keine Ahnung hatte, wer sie
sei. Mutter klärte die Situation schnell: „Ich hatte einen Traum, in dem ich
Sie bereits kennengelernt habe.“ Vater kam herein und dankte Bruder
Latschkowski für die prompte Antwort auf seine Bitte, worauf hin der Älteste
verwundert antwortete, dass er von einer solchen Karte nichts wüsste. Sein
Besuch kam aus einem unbestreitbaren Gefühl zu Stande. Es wäre sozusagen ein
deutlicher Hinweis gewesen in diese Stadt zu reisen, zu dieser Klinik, um
Julianne Skibbe zu finden. Der Schleier bisheriger Unsicherheit fiel sofort.
Drei Seelen wussten, dass Großartiges geschehen wird.
Der Älteste gab ihr einen Priestertumssegen. Am nächsten Tag
beschlossen die Chirurgen, vor der Operation eine zusätzliche Röntgenaufnahme
zu machen. Verblüfft, nahezu ungläubig untersuchten sieben Ärzte das neue
Röntgenbild. Immer wieder. Kopfschüttelnd hieß es: „Das ist ein
medizinisches Wunder! Wo sind die Löcher, der ersten Röntgenaufnahmen?“
Keine Verwechslung. Auf beiden Platen stand ihr Name
geschrieben.
Mutter und wir wurden nach diesem Ereignis viele Jahre lang
untersucht. Sie lebte dann über 50 Jahre lang ein Leben in vollkommener
Gesundheit.
Auf Befehl der sowjetischen Militäradministration
Bereits im Oktober 1945 mussten wir unser Geschäft wieder
eröffnen um Holzpantoffel herzustellen. Niemand wies mich ein. Ich legte eins
der 5 m langen Sägeblätter auf die gummigepolsterten Räder unserer riesigen
Bandsäge und los ging es. Zum Glück bekam Vater vor Jahren Arbeitsurlaub um
mehrere tausend „Keile“ anzufertigen. Diese Rohlinge standen mir nun zur
Verfügung. Ich legte die vorhandenen Schablonen auf und schnitt täglich 60
Stück Holzsohlen aus, höhlte sie von Hand und verlieh ihnen Hacken. Mutter war
stolz auf mich. Die Kunden – zumeist Kleinbauern - sahen darüber hinweg, dass
es keine Kunstwerke waren die sie erwarben. Nahe 16 geworden hatte ich
Fortschritte gemacht. Das Geschäft blühte. Bauern bezahlten mitunter in
Naturalien: Kartoffeln und Mohrrüben. Das war ein großes Plus in Zeiten
zunehmenden allgemeinen Hungers. Es kam auch unseren Angestellten gut, denn
sonntags nahmen sie an unsren Mahlzeiten teil und die waren dann unbegrenzt.
Frau Behringer wirkte als Hausgehilfin. Sie zeigte mir sehr bald ein
Foto. Zwei bildschöne Mädchen posierten dort. „O, sagte ich, die Rechte
sieht aus wie eine Filmschauspielerin.“
„Mein Dorchen!“ erwiderte
sie stolz. Anderntags erschien “Dorchen“ die blonde neunzehnjährige Schönheit
in meiner Werkstatt. Strahlend aus Lebenslust stand sie da. Sie kam ohne viel
Umwege auf das für sie Wesentliche zu sprechen: „Ich habe eine sturmfreie
Bude im Gaugerwohnhaus. Besuche mich mal.“
„Wann?“
„Heute Abend, wenn du willst!“
Was sturmfreie Bude bedeutete wusste ich noch nicht.
Der Abend wurde wunderbar. Schnaps und Zigaretten wurden mir
angeboten...
aber bei aller Dummheit verzichtete ich auf Alkohol. Ich
versuchte zu rauchen. Hustete und so weiter. Sie wohnte zusammen mit ihrer
Freundin in einem gut eingerichteten Zimmer mit Ehebetten.
Aber dann richtete sie im Beisein ihrer Freundin an mich die
Frage: „Soll ich mich mal ausziehen?“ Meine Seele im Begriff laut zu
jubeln: „Ja, bitte“, streifte mich ein Wort Vaters: „Rühre niemals
eine Frau an, es sei denn sie ist deine eigene!“
Das hatte er mir während seines letzten Fronturlaubs eingebläut.
Innerlich lachte ich damals, nun wusste ich um den Sinn seiner Warnung.
Wochen später fragten mich einige Jungen wie es mir geht,
Dorchen habe sie mit der Pest infiziert.
O, mein guter Vater!
Ich kann mich nicht erinnern ob ich damals auch Gott dankte. Und
dennoch, mein Glaube wuchs. Rößles und Zimmers Hassschriften waren es, die mich
zu Besserem bewegten.
Im Juni 1946 wurden wir von den Missionaren zur Bezirkskonferenz
nach Schwerin eingeladen. Mutter fühlte sich nicht gut. Helmut, nun 10-jährig,
bot sich an mit zu kommen. Normalerweise dauerte die Zugfahrt von Wolgast aus,
etwa fünf Stunden. Aber nichts war in den ersten beiden Nachkriegsjahren so
ungewiss wie eine Reise mit der Reichsbahn.
Die Menschen kamen aus dem Süden um im Norden bei Landwirten
Teppiche oder Gemälde gegen Kartoffeln einzutauschen. Oft waren die Züge
heillos überfrachtet.
Wir fanden glücklicherweise nach jedem Umsteigen Sitzplätze.
Natürlich hatte ich vergessen, wo in der großen Stadt das Treffen stattfand.
Vielleicht hatte mir niemand die Adresse genannt. Später sah ich die Plakate in
der Stadt hängen, die zu diesem Fest einluden. Doch im momentanen Umfeld
gab es keine Hinweise.– Das Plakatieren wurde von den örtlichen Behörden
erlaubt, weil „die Mormonen“ damals noch als die von den Nazis diffamierte
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage galt. Es war spät geworden.
Nach sechs Stunden Verspätung fühlen wir uns ein wenig verloren. Hunderte, wenn
nicht Tausende Menschen spazierten an diesem lauen Spätsommerabend auf den
Hauptstraßen, der Lübecker und der Wismarschen. Sie genossen den Frieden.
Mindestens jeder Zweite musste aus dem Osten vor der Roten Armee
geflohen sein. Es schien, als hätte es nie einen Krieg gegeben. Alles sah
unglaublich ruhig aus. Es gab nirgendwo Spuren des Krieges. Ich fand vor allem
erstaunlich so viele Männer zu sehen. Wo kamen die alle her? An wen sollte ich
mich wenden?
Es gab tatsächlich eine Summe unzähliger Stimmen, denn es schien
mir, als wehe nicht die geringste Brise. Die Worte breiteten sich weithin aus.
Mir kam der Gedanke, dass ich nach dem Polizeipräsidium fragen
könnte.
Plötzlich mitten im buchstäblichen Gewimmel sprach ich eine Dame
an, die in Gesellschaft mehrerer Leute daher kam… „Schließen Sie sich uns an!“
sagte sie. Mehr nicht. Binnen Sekunden vernahm ich, dass sie über eine gerade
beendete
Samstagversammlung sprachen. Der Name Neumärker ließ aufhorchen.
Das war der Mann der mich eingeladen hatte, und die Dame hieß Elli Polzin,
Flüchtling aus Stettin. Mitglied jener Kirche deren Menschen und
Versammlungen ich nun näher kennen lernen wollte.
Die Art wie sie Helmut und mich einlud mit ihren Kindern ein
Lager auf dem Fußboden zu teilen, blieb mir, wie ihr ganzes Wesen,
unvergesslich. Es war diese selbstverständliche Treue zu den Idealen des
Mormonismus, die sie ein halbes Jahrhundert danach immer noch ausstrahlte. Eine
so kluge, selbstbewusste, humorvolle Frau, der zwei Jahre später das Glück
vergönnt war ihren Ehemann wiederzusehen, der als Sanitäter an der
"Ostfront" eingesetzt wurde, und dann langjähriger Kriegsgefangener
war, in einem Land, in dem die Sieger selbst Hunger litten. Am Sonntag saßen
mein Bruder und ich in der Versammlung der Frauen, denn als zur Klassentrennung
aufgerufen wurde, blieben wir sitzen.
Foto: Bundesarchiv
Bahnreisen 1946 -47 in Deutschland zwischen Juli und Oktober
Sehr selten, dass ich
auf diese Weise reiste.
Es hieß die Priestertumsträger würden sich in einem Nebenraum
versammeln. Ich trug doch noch keinen Grad des Priestertums, deren niedrigsten
die Jungen ab dem 12. Lebensjahr erhielten, wenn sie würdig und tätig sein
wollten.
Fasziniert hörte ich die FHV-Leiterin Rowolt (oder Ruwolt)
sprechen. Es war die Stärke und Größe ihrer Geisteshaltung mit der sie sich uns
mitteilte: „Ich wohnte in Hamburg, verlor mein Heim, meine beiden Söhne
meinen Ehemann, aber nicht meinen Glauben...“
Dann kam ein betagter Herr, ein Ältester. Er zog uns aus der
Frauenschaft heraus.
Wie sehr haben wir uns dann dort gelangweilt. Obwohl wenigstens
ich die gute Atmosphäre dieser Gruppe von etwa 30 Männern spürte. Es scheint so
zu sein, dass Frauen mehr und intensiver ihr Herz befragen und es sprechen
lassen, als die Vernunft. Ist es nicht wahr, dass Abinadi in einem Extremfall,
den Priestern Noas geradezu, einen Vorwurf daraus machte, dass sie zu
"verkopft" seien: „Ihr habt euer Herz nicht dazu gebracht, es zu
verstehen, darum seid ihr nicht weise gewesen." Mosia 12: 27
Alle kommenden Jahre hindurch, zuerst aber während der langen
Heimfahrt, von Schwerin nach Wolgast stand mir dieses flächige, ruhige Gesicht
der Dame Rowolt vor Augen. Diese Frau musste durch bitterste Prüfungen gehen.
Sie verlor aber nie jenen Geist der aus Menschen Heilige machen kann.
Bevor Vater heimkehrte, erfuhr ich, dass meine Freunde Richard
und Gerhard Lange, entgegen ihrem Schwur gegenüber Herrn Kell, unserem Retter,
nachts hinübergeschwommen oder gerudert waren, zur immer noch waffenstarrenden
Insel um sich mit je einem Karabiner und passender Munition einzudecken. Sie
gingen bei entsprechender Mondkonstellation wildern. Bald darauf fehlte ihnen
der dritte Mann, der Aufpasser. Den sollte ich ersetzen. Falls die
russische Armeepatrouille auftaucht sollte ich pfeifen. Aber ich hatte Angst
und verweigerte mich. Meiner Feigheit wegen wurden sie ertappt und umgehend zum
Zehner-ukas verurteilt. Sollte ich mir Vorwürfe machen?
Ja, vielleicht.
Aber als beide drei Jahr später, 1949, anlässlich der Gründung
der DDR durch Staatspräsident Wilhelm Pieck begnadigt wurden, traf ich Richard
wieder. Ich kam damals aus Prenzlau, dort befand ich mich als 19-jähriger noch
in der Lehre in einem Baumschulen-Unternehmen. Zum Kurzurlaub kehrte ich zurück
nach Wolgast.
Erstaunt sah ich, dass jemand der mir fremd war, auf „meinem“
Sofa daheim, lag. Ich konnte ihn nicht gleich erkennen. Er schlug die Decke
zurück. Da war nur ein Gerippe, mit Menschenhaut überzogen: „Richard?“
Was er berichtete wage ich nicht zu schreiben. Sadisten mit
roten Armbinden hätten sie mit Hunger und Schlägen traktiert. Eine weitere,
möglicherweise ausgesuchte Schikane bestand darin, den Jungen freien Blick auf
die Frauen- und Mädchen zu geben, die wie ihre männlichen Leidensgenossen auch
unter Liebesmangel litten. „Ich wusste nicht wohin, meine Familie ist
abgehauen nach Schweden, angeblich mit einem Fischerboot.“ Richard warf mir
meinen Freundesverrat nicht vor. „Sie kamen mit Hunden.“ Daraus folgerte: Sie
hätten auch mich geschnappt. Lapidar fügte Richard hinzu: „Meine Leber ist
kaputt, aber ich gehe in den Westen, hier kann mir keiner helfen.“
Im Herbst 1946, unmittelbar nach Richards Verhaftung und
Einweisung ins Lager Waldheim, trafen erneut Missionare in unserer Gegend ein.
Es war die Zeit nachdem Vater aus einem Gefangenenlager in Frankreich geflohen
war, besuchte uns Elder Walter Krause. Ein Mann um die 35, mit starken
Gesichtszügen, gezogene Nase und sympathischem Auftreten. Vater nahm ihn zwar
wahr, doch er kämpfte mit seinen Depressionen. Er entrann der Schwerstarbeit in
einem französischen Kohlebergwerk durch riskante Flucht.
Zur Verursachung seines Zustandes zählte die Kriegsberichterstattung.
In den letzten Kriegstagen sprach der deutsche Soldatensender u.a. von heftigen
Kämpfen um den Brückenkopf Wolgast, dreimal sei die Stadt zurückerobert worden.
In dunklen Tagträumen sah er seine Familie unter Trümmern liegen. Die
Ungewissheit trieb ihn an. Seit Kindheitstagen durchlitt er als Halbwaise an
der Seite eines nunmehr stets trunkenen Vaters, depressive Phasen. Beide
trauerten endlos um den Verlust der Mutter meines Vaters.
Ich stand an der Bandsäge als er in meine Werkstatt kam. Dann
sah er Mutter und Helmut, sowie Helga wohlauf. Daraufhin brach er zusammen.
Monatelang nach der unerlaubten Rückkehr zu seiner Familie verließ er nicht das
Bett. Alte Depressionen fielen aus neuen Gründen über ihn her. Uns, bei guter
Gesundheit und in einer eher heiteren seelischen Verfassung zu sehen, war wohl
ebenfalls zu viel für ihn, den Mann mit großem Mitgefühl. Er kämpfte gegen sich
selbst, Das führte zu Zwangsdenken.
Erst im Frühling 1949 wurde mein Vater für fast zwei Jahrzehnte
Herr seines Selbst. Verdiente verhältnismäßig viel Geld, erwarb ein Haus in der
Wolgaster Bahnhofstraße. Mutter war mit ihm sodann zwanzig Jahre glücklich, bis
er zurückfiel in schwere Depressionen und schließlich Suizid beging.
Kategorisch hatte er jede fachärztliche Hilfe verweigert.
Trotz aller Wunden, die er bei alliierten Bombenangriffen erlitt
kam Walter Krause zu uns, allerdings auf Krücken. Er gehörte zu den
Überlebenden der Zerstörung der Stadt Dresden im Februar 1945. Er ließ, nur
Monate nach dieser Tragödie seine Familie in Cottbus zurück, um eine Mission
für seinen Gott zugunsten vieler desorientierter, verzweifelter Menschen zu
erfüllen.
Der damalige Missionspräsident Richard Ranglack klagte:
„Walter wir brauchen dich!“
Unglaublich! Walter gehorchte. Er fand ein reifes Feld vor, das
abgeerntet werden konnte. Innerhalb weniger Wochen wurden 50 Personen Mitglied
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Johannes Reese und sogar
ich waren daran beteiligt.
Reese hielt seit Monaten zuvor in unsren Wohnräumen
Hausversammlungen ab, da es in unserer Gegend keine autorisierten Lehrer
unserer Kirche gab. Etwa 20, manchmal auch mehr Leute kamen zusammen. Allesamt
Flüchtlinge, die nach dem Zusammenbruch seelisch ermüdet dahinlebten. Ich hatte
ihnen Traktate gegeben, die frühere Missionare bei uns zu Hause hinterließen,
und die ich zwischen der Anti-Mormonenliteratur vorfand. Ich lud irgendwann
auch meinen Freund Hans Schult ein, der später als Distriktpräsident Ostberlins
wirkte.
Reese nahm mitunter, ohne Mutter zu fragen aus unserem
Briefständer Post meines Vaters, die seit etwa einem Jahr aus Norwegen kam, im
Mai 1945 allerdings abriss. Dann sagte er in die Runde: „Hier ist wieder
eine Epistel von Wilhelm Skibbe“ Tatsächlich enthielten die Briefe stets
Betrachtungen biblischer Zitate, die Vater mit den Lehren der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage verband. Vater war wirklich ein Denker. Er
fand die Theologie sei großartig, weil sie obenan die Liebe stellte, die jedes
Menschen Willen respektierte. Selbst der allmächtige Gott würde niemals
eingreifen, wenn wir es nicht erbitten. Gott
wünscht zwar, dass wir uns unserer Schwächen bewusst sind, doch nie wird er
Menschen erniedrigen. Im Gegenteil.
Selten erwähnte Vater Episoden oder Fragen die ihn oder Mutter
betrafen. Wir vernahmen eines Tages, bevor Walter Krause kam, die Worte der
Ehefrau Willi Dunkers: „Kann man sich den Mormonen anschließen.“ Johannes
Reese erwiderte: „Ja! Guten Gewissens.“
Allerdings rang er mit sich selbst ob er auch die Lehre von der
Möglichkeit der Vergottung des Menschen mittragen könne. Dies erfuhr ich erst
später. Er wurde nie Mitglied, verschenke aber zahllose Bücher Mormon an
Andersgläubige mit Widmung. Man kannte ihn weithin. Er spielte zu
Gottesdiensten evangelischer Richtungen und ebenfalls bei katholischen Messen.
Walter Krause kam in diese Situation hinein. Er predigte stets
in gehobener Stimmung. Wir fühlten seine tiefe Überzeugung von der Echtheit des
Geistes des wiederhergestellten Evangeliums. Er vertiefte meinen Glauben und
den der Chust- Schult- und Weberfamilie, die dann allen Stürmen zum Trotz
lebenslänglich dabeiblieben. Der erste dieser Konvertiten war Max Zander, ein
belesener Gartentechniker, der seinen Freund Johannes Reese nach guter
Literatur gefragt hatte. Herr Reese gab ihm ein Buch Mormon. Max war total
überrascht. „Ist das wirklich wahr?“
„Geh und besuche ihre Versammlungen!“, antwortete mein Klavierlehrer. Max tat es. Er hörte Walter
Krause aufmerksam zu. Er spürte die Seelenkraft dieses Mannes und die Macht der
Einzigartigkeit der Lehren einer verfemten Kirche. Es war überwältigend
für ihn. Ich erinnere mich an diese beeindruckenden Stunden der Inspiration. Es
ging um die Fragen nach dies- und jenseitigem Glück. Joseph Smith lehrte: „Eine
Religion die mir nicht mehr Glück in diesem Leben geben kann, vermag es auch
nicht in der jenseitigen.“
Wertvoll sei Abrahams Wort, wie es im Buch „Köstliche Perle“
festgehalten wurde: „da ich gewahr wurde, dass mir mehr Glück und Frieden
und Ruhe beschieden sein würden, trachtete ich nach den Segnungen der Väter und
dem Recht, wozu ich ordiniert sein musste, um in ihnen zu walten; da ich selbst
ein Nachfolger der Rechtschaffenheit war und auch wünschte, jemand zu sein, der
viel Erkenntnis besaß, und ein besserer Nachfolger der Rechtschaffenheit zu
sein und mehr Erkenntnis zu besitzen und ein Vater vieler Nationen zu sein, ein
Fürst des Friedens, und wünschte, Belehrungen zu empfangen und die Gebote
Gottes zu halten, wurde ich ein rechtmäßiger Erbe, ein Hoher Priester, der das
Recht innehatte, das den Vätern zugehörte.“ Vers 2
Gebote seien zwar Grenzsteine oder Zäune, die uns vor den häufig
schweren Folgen von Übertretungen schützen wollen.
In einer Ansprache kam in diesem Zusammenhang ein dazu passendes
Beispiel vor: Eines Großbauern Zuchthengst übersprang die Hürden und fraß
vergiftetes Saatgut.
Sehr bald nachdem er mehr gelesen hatte, wollte Max Zander im
späten November im offenen Wasser getauft werden. Der Tag wurde bestimmt und
dieser begann um Mitternacht mit minus 17 Grad Celsius. Walter Krause musste
mit einer Axt die zwölf Zentimeter dicke Eisschicht, des sogenannten Pferdegraben
am Peenestrom aufbrechen, wobei ich ihm half.
Und so, nach späterer Taufe der Mitglieder der Zanderfamilie kam
es, dass bald darauf in Wolgast die erste Gemeinde der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage in unserer Umgebung gegründet wurde. Es wurden immer
mehr. Menschen unterschiedlichster Gesinnung fanden zu fast verlorenem Glauben
an einen liebenden Gott zurück. Es gab natürlich Gegenwind und es ereigneten
sich kaum vorstellbare Dinge, wie in diesem Fall, den Walter Krauses Tagebuch
festhielt. (Veröffentlicht 2005 durch Edith Krause, „Walter Krause in seiner
Zeit“): „Im April 1947 sollte Gerd Skibbe einen Auftrag seiner Mutter
erfüllen: in das Dorf Mahlzow auf der Insel Usedom fahren, um dort Fisch zu
kaufen. Ich war froh, mit ihm zu gehen; denn wieder hatten wir so die
Gelegenheit, über die Grundsätze des Evangeliums nachzudenken. Schwester
Julianne Skibbe, Gerds Mutter, packte ein Paar Holzschuhe für die Frau des
Fischers ein. Sie fragte Edith Schade ob sie mitginge- Sie stimmte zu. Also
gingen wir zu dritt hinunter zur Peene, wo wir eine Fähre bestiegen, die uns
zur Insel brachte. Bei der Ankunft erfuhren wir, dass Offiziere der
sowjetischen Armee die Pässe aller Reisenden überprüften. (Walter vermutete
gleich etwas Schlimmes) „Was ist das alles?“ dachte ich mir... Die sowjetischen
Offiziere kontrollierten die Pässe. Gerd und Edith kamen ohne Ausweise. Sie
wurden gebeten, nach rechts zu gehen. Ich hatte meinen Reisepass dabei, der in
vier Sprachen ausgestellt worden war. Bruder Suhrmann (nach dem Krieg führend im
Kohlebergbau Sachsens) hat ihn für mich besorgt. Mir wurde gesagt, ich solle
nach links gehen. Nachdem alle rund 30 Personen kontrolliert worden waren,
durften die Personen der rechten Seite weiter gehen.
So waren Gerd und Schwester Edith Schade frei, den anderen wurde
jedoch gesagt, sie... würden unter Bewachung bleiben. Gerd und Edith besprachen
die Situation und kamen dann, um mir zu sagen, dass sie unbedingt bei mir
bleiben würden. Ich lehnte ihr Angebot ab, weil ich angesichts der vielen
russischen Offiziere um Ediths Sicherheit fürchtete. Die beiden änderten ihre
Meinung jedoch nicht. Nach einiger Zeit traf ein riesiger Militärlastwagen ein.
Man sagte uns, wir sollten hinaufklettern und uns auf den Boden setzen, während
die sowjetischen Soldaten uns mit Maschinengewehren bewachten... Diese
erzwungene Fahrt über die wunderschöne Insel Usedom hat uns nicht gerade
gefallen. Die 42 Kilometer lange Reise endete im Ort Heringsdorf. Der Lastwagen
hielt vor einer der alten Ferienvillen...Dort wurden die Menschen aufgeteilt
und in verschiedene Räume des Gebäudes geschickt. Wir drei wurden getrennt…
Während wir warteten, fiel die Dunkelheit über die Welt. Einer nach dem anderen
wurden wir dem Kommandanten vorgeführt, der ebenfalls in einem abgedunkelten
Raum saß. ... Schwester Schade erzählte uns später, dass sie wegen der
Dunkelheit Angst hatte, weil sie nur die Stimme des Dolmetschers und des Mannes
hören konnte, der viele Fragen stellte. Irgendwo in der hinteren Ecke
quietschten die Betten ...Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass Gerd
Skibbe der erste war, der interviewt wurde. Er wurde sodann freigelassen und
wartete auf uns ... Schließlich wurde mir mitgeteilt, dass man mich mit einem
Nazi-Führer namens Schwede-Coburg (Nazi-„Gauleiter“ des pommerschen
Parteibezirks) verwechselt hätte, dem man nicht entkommen lassen wollte. Der
Kommandant sagte mir, dass ein „Bruder“(Gerd) und eine „Schwester“ (Edith) auf
mich warteten, die bei keinem ihrer Verhöre Angst vor ihm zeigten. Und, dass
wir alle die gleiche Geschichte erzählten. Wir dürften gehen. Bevor ich den
Raum verließ, schüttelte der Beamte mir die Hand, öffnete seine Uniformjacke
und sagte mir, dass auch er gläubig sei. Er trug ein Madonnenbild an einer
Kette.
Als wir uns wieder auf der Straße befanden, senkten wir den
Kopf, um ein
Dankesgebet zu sprechen. Dann gingen wir die Straße entlang, um
nach Wolgast zurückzukehren.
Da nun Schwester Schade diese Holzschuhe zu tragen nicht gewohnt
war, gingen wir nur bis Koserow. Dort wollten wir um eine Rast bitten. ... Gerd
kannte den örtlichen Bäcker und klopfte bei ihm. Es war nach 2 Uhr morgens. Der
Bäcker sagte uns, wir sollten zur Scheune gehen, wo wir auf dem Stroh schlafen
könnten.
Kaum hatten wir uns niedergelassen, brach ein heftiges Gewitter
los. Es regnete eimerweise. Wie glücklich waren wir, in dieser Scheune zu sein,
wo es warm und trocken war! Die Liebe und Loyalität meiner treuen Gefährten
gaben mir Hoffnung und Kraft, die Arbeit des Herrn voranzutreiben.“ Zitatende
Ich erlebte in diesem Frühling 1947, wie ein Offizier der
Militärstreife, von einem seiner Soldaten erschlagen wurde. Ich stand drei
Meter entfernt, wollte eine Kinokarte kaufen. Ein Muschik, der im Vorraum der
Kinokasse, in einer Nische stand hielt in seiner Hand eine
zwei-Liter-Milchkanne. Da muss Schnaps drin gewesen sein. Der Mann mit der
Armbinde „Militärpolizei“ wollte dem ohnehin Betrunkenen dieses Gefäß abnehmen.
Jemand hinderte ihn, denn es waren weitere etwa drei oder vier Rotarmisten die
sich das Getränk wohl teilen wollten. Der blutjunge Soldat schwenkte die Kanne
und schlug sie dem Armeepolizisten mit voller Wucht mitten auf den Schädel.
Obwohl das Opfer sofort zu Boden sank, erlitt der nicht mehr junge
Streifenführer weitere tödliche Schläge. Einer der vom Schnaps benebelten
bemerkte mich erst jetzt. Seine Augen rotierten und ich lief um mein Leben.
Gerhard D. – ein Sonderfall
Damals erhielt Walter Krause
Unterstützung durch den aus Sachsen stammenden Gerhard D., der ein ganz
besonderer Missionar war, 19 Jahre alt und verdorben bis auf die Knochen.
Missionspräsident Walter Stover hatte ihn berufen, da seine Familie einen guten
Ruf besaß und Gerhard selbst – allerdings nur vorgegaukelte - Zeichen von
Loyalität und Glauben an den Tag legte.
Walter Krause wurde noch nicht umgehend
auf Gerhards verborgenen Ehrgeiz und dessen Leidenschaften aufmerksam sonst
hätte er ihn ohne weiteres nach Hause geschickt. Doch das Schicksal lief
schneller als erwartet. Meine Mutter und ich bemerkten als erste, dass mit
diesem jungen Mann auffallend einiges nicht stimmte. Wir fanden ihn rauchend im
Holzschuppen meines Vaters, einem Raum voller zundertrockenem Holz und
Holzspänen. Es stand inmitten vieler alter deutscher Fachwerkhäuser, die
Hunderte von Jahren überdauert hatten. Nervös schwang Gerhard seine Arme durch
die Luft, um den Geruch und die Tabakrauchwolken zu vertreiben, aber ohne
Erfolg.
Gerhard sollte mir beim
Holzschneiden in unserer kleinen Fabrik helfen. Es kümmerte ihn wenig. Er saß
lieber im warmen Wohnzimmer. Als ich eintrat verbarg er sofort ein Buch. Das
machte mich misstrauisch und neugierig. Nach willkürlich aufgeschlagenen und
gelesenen 2 Seiten fragte ich ihn: „Warum hast du Boccaccios
„Decamerone“ zu uns nach Hause
gebracht?“ Er zuckte mit den Schultern und antwortete herablassend: „Ich
bin alt genug dafür.“
Dies war die Situation, als
Gerhard sich dann, zwar widerwillig, herbeiließ, mir beim Holztransport aus dem
Wald, 15 km von Wolgast entfernt, zu helfen. Wir hoben die schweren, zwei Meter
langen Baumstämme auf den Lastwagen, ein altes, langsames Fahrzeug, das mit
Holzgas betrieben wurde, denn Benzin gab es selten. Erschöpft kletterten wir
auf unsere Ladung und ließen uns von der Sonne und der sanften Frühlingsluft
den Rücken wärmen, während der Lastwagen nach Hause kroch. Als wir das kleine
Dorf Zemitz erreichten beschloss Gerhard zu provozieren: Er zog sein Hemd aus.
Zu meinem Entsetzen sah ich die leuchtenden Farben der Nazi-Flagge mit dem
Hakenkreuz auf seinem Unterhemd.
Als wir durch das neue Grün der
langen Dorfgasse fuhren, saß er wie eine Statue da. Jeder hätte ihn mit dem
rot-weiß-schwarzen NAPOLA-Emblem sehen können. (NAPOLA bedeutet Sonderschule
für künftige Führer im Dritten Reich Adolf Hitlers, auch Werkstatt um Spione
auszubilden) Das Wappen umgab seine Brust wie ein Feuerring. Ich hatte das
Gefühl, ich sollte vom rollenden Lastwagen herunterspringen. Seit dem
verlorenen Krieg waren bereits zwei Jahre vergangen. Zwei Jahre voller Blicke
auf die Ruinen und die Qual all dessen, was der barbarische Hitlerfaschismus
hinterlassen hatte. Auch wenn es den meisten Deutschen schwerfiel, sich allen
Anordnungen der Sowjetmacht zu beugen, widersprachen Handlungen wie diese, die
Gerhard an diesem Tag an den Tag legte, jeder Vernunft. Das war eine freche,
unverzeihliche Provokation. Wenn uns nur einer mit Verantwortungsbewusstsein
gesehen hätte, wären wir unweigerlich hinter Gittern gelandet. „Bist du
verrückt geworden?“ Er griente nur.
Unter diesem Zeichen musste nicht nur jede Familie Deutschlands großes
Leid erdulden, sondern ganz Europa litt immer noch. Tausende Städte Europas,
zwischen Coventry und Stalingrad waren dem Erdboden gleichgemacht worden.
Plötzlich verstand ich, warum
Gerhard es in Abwesenheit Walter Krauses liebte, unsere Treffen zu leiten. Die
meisten Mitglieder waren alt genug, um Gerhards Eltern zu sein. In der
Anfangszeit standen wir auf, um Kirchenlieder zu singen.
Befehle zum Aufstehen und
Hinsetzen wurden vom anmaßenden "Missionar“ G.D. gegeben. "Hoch!"
und „runter!“ forderte er, als wären wir seine Untergebenen. Zu
meiner Überraschung waren alle neuen Mitglieder gehorsam und niemand beschwerte
sich. Es könnte sein, dass sie dachten, dies gehöre dazu und sei die richtige
Art, sich fügsam zu verhalten. Ich traute mich noch nicht, es Walter Krause zu
sagen. Hätte ich es nur getan. Aber ich
wollte nicht schon wieder ein Verräter sein. Wenige Tage nachdem Gerhard D.
seine politischen Neigungen törichterweise offengelegt hatte, wurde er in
Stralsund - einhundert Kilometer von Wolgast entfernt - von Offizieren der
Roten Armee verhaftet.
Zu diesem Zeitpunkt saß er im
Wartesaal der ersten Klasse im Bahnhof. Dieser war den Offizieren und
Zivilangestellten der Roten Armee vorbehalten. Hin und wieder überprüfte jedoch
die sowjetische Militärpolizei die Pässe aller Anwesenden. Gerhard, wie wir
später vernehmen mussten, sprach perfekt Russisch. Er liebte Wodka und, wie wir dann erfuhren,
musste er sich auf der Napola Marienburg, Ostpreußen, ein großes Repertoire an
schmutzigen Witzen angeeignet haben, um als Ostagent in Russland befehlsgemäß
operieren zu können.
Natürlich besaß er keinen
gültigen Pass. Bei der NAPOLA wurde Gerhard jeglicher Religionszugehörigkeit
entwöhnt.
Armer Walter Krause!
Nach der Festnahme Gerhards
wurde Walter vom Kommandanten nach Stralsund vorgeladen. Dieser Beamte teilte
ihm mit, dass Walter Krauses Leben für die russischen Behörden nicht viel wert
sei, wenn sich ein solches Ereignis wie oben beschrieben wiederholen würde.
Allerdings, Walter hatte sich in den vergangenen Monaten ein ausgezeichneter
Ruf erworben. Das könnte der Kommandant gewusst haben. Missionar Krause
kümmerte sich um Waisenkinder aus Mitgliederfamilien und andere in Not
geratene. Er mischte sich grundsätzlich nicht in politische Diskussionen ein.
Ich begegnete ihm 1968, anlässlich eines
Kirchentreffens in Ostberlin. Er winkte mir zu. Ich zuckte die Achseln. Er kam
auf mich zu und erzählte mir, wer er sei. Er wünschte wieder mein Freund zu
sein.
20
Jahre lang musste er durch verschiedene Gefangenenlager, in Sibiriens
Kohlebergwerken gehen. Er arbeitete in heißen, wassergefüllten,
lebensgefährlichen Löchern. Dort hatte er reichlich Gelegenheit, seine
faschistischen Pädagogen zu verfluchen, die ihn als einen zunächst dressierten
und dann verstoßenen Hund zurückgelassen hatten.
Hin und her gerissen zweifelte ich letztlich an Gerhards
Redlichkeit. Irgendwo, tief in unserem Inneren, scheint es einen Mechanismus zu
geben, der es uns nicht erlaubt, Misstrauensgefühle schnell abzustreifen.
Obwohl wir es manchmal vielleicht sollten. Ich sagte ein paar leere Worte.
Schmerz muss er gespürt haben, tiefen Seelenschmerz, als er sah, dass ich ihn
ablehnte. Was er dringend brauchte, wäre ein ehrliches Willkommenswort und eine
Umarmung gewesen. Mein damaliges Verhalten bedrückt mich bis zur Stunde. Er
verstarb bald darauf. Ich hätte Gutes für ihn tun können, wenn nicht meine
Bedenken die Oberhand erlangt hätten. Es war die Sorge, dass sie ihn zu einem
Sowjetspion umgedreht haben könnten.
Uns war seit langem bewusst, dass wir ständig von der „Stasi“ argwöhnisch
beobachtet wurden. Meine Schuld Gerhard kühl behandelt zu haben werde ich
weiter zu tragen haben. Er war schließlich zu uns zurückgekehrt. Wir „Mormonen“, insbesondere die Leitenden,
zu denen ich damals gehörte, galten zu dieser Zeit noch als Mitglieder einer,
in kommunistischen Augen, gefährlichen amerikanischen Sekte. Wir mussten
besonders vorsichtig sein. 1968 herrschte noch das gegenseitige Unbehagen...
Unser Warten in Ungewissheit war zu jener Zeit, einer Ära der Bitterkeiten
geschuldet. Das berühmte Weihegebet von Präsident Monson (1976) auf den
Radebeuler Hügeln gesprochen, lag noch in weiter Ferne. Irgendjemand
übermittelte dann allerdings den Text dieses besonderen Gebetes dem
Überwachungssystem, - was später sehr zu vermuten war -. In ihm bat der
damalige Apostel Monson jedenfalls um einen Segen des Allmächtigen für die
kommunistische Regierung. Da gab es
keinen Fluch. Das änderte die Position unserer Kirche und verschaffte uns
DDR-Mitgliedern nach 1980 Anerkennung durch die Regierungsbehörden. Diese
sanfte Weise des Umgangs mit radikal Andersdenkenden in Führungsstellen sollte
schließlich zum Bau eines Tempels im Osten führen.
Im Jahr
1947, sowie 1948 musste ich die Lebensmittelrationen, die uns die Kirche aus
Utah geschickt hatte, an bedürftige, sowie Nichtmitglieder liefern. So
transportierte ich ein- bis zweimal pro Woche die Pakete durch ganz Mecklenburg
und Vorpommern. Sie enthielten Fleischkonserven, Mais, Tomaten, Pfirsiche und
Beutel, sowie dann Säcke voller Weizen.
Aufgrund meines schlichten Kirchenpasses erlaubten mir der zuständigen
Beamten zweimal in Sonderwagen zu reisen, die den russischen Generälen
vorbehalten waren. Ihre Haltung überraschte mich.
Unsere Kirche verfügte seit 1936 über ein gut funktionierendes
Wohlfahrts-Programm, um ihren Mitgliedern und Freunden in Not zu helfen.
Tausende Tonnen Weizen wurden an die Menschen in Deutschland geliefert. Die
Russen gaben ihr Einverständnis (unterzeichnet vom Militärkommandanten in
Karlshorst), dass das Rote Kreuz und die Sowjetische Militärverwaltung zusammen
mit der Kirche beliefert würden. Das bedeutete in der Praxis, dass mindestens
die Hälfte aller Lieferungen zugunsten weltlicher Institutionen erfolgten.
|
|
|
|
Präsident Ezra T. Benson war der Erste der bald nach dem Krieg gegen
Einwände amerikanischer Autoritäten, die Bensons Sicherheit in Gefahr sahen,
vor Ort auftrat um mit eigenen Augen das ganze Ausmaß des Elends zu sehen, das
über deutsche, aber auch andere europäische Städte gekommen war.
Bis 1949 gingen zahlreiche kleine Weizenbehälter durch meine Hände,
ebenso wie viele andere Lebensmittel, Kleidung und Schuhe, die alle mit der
Bahn transportiert werden mussten. Ich habe nie ein Paket verloren. Völlig
fremde sahen mich oft mit den schweren Containern auf dem Bahnsteig kämpfen und
halfen mir. Ich musste diese kostbaren Geschenke unserer Mitglieder in den
Vereinigten Staaten nie verteidigen. Ich war mir des Vertrauens, das mir
entgegengebracht wurde, immer bewusst und war sehr vorsichtig. Das Jahr 1947
war die Zeit, in der Millionen Menschen unter schwerem Hunger litten. Ich erinnere mich, wie ich im eisigen Winter
1947 im Warteraum „Bahnhof Zoo“ in West-Berlin ein dickes, verwildert
aussehendes Mädchen wie einen bösartigen Wachhund auf einem großen
Kartoffelhaufen sitzen sah.
Damals sollte in Westberlin eine Konferenz stattfinden. Vater hatte sich
aufgerafft und begleitete mich. Durchgefroren in der Wartezeit gingen wir in
das S-Bahnrestaurant Friedrichstraße. Heiße Brühe wurde angeboten. Unglaublich!
Wie gut sie schmeckte. Plötzlich fragte ich mich, woher die Fettaugen kamen,
die obenauf schwammen. Ich konnte es mir erst erklären als ich die in den
Trümmern umherstreunenden Katzen sah, die dort Jagd auf alles machten, was sie
überwältigen konnten. Wir machten uns wieder auf den Weg. Doch es lagen noch
einige Wartestunden vor uns. Der Kälte wegen begaben wir uns in das fast
isoliert dastehende Postamt am Stettiner Bahnhof. Wenig später kam Walter Krause
herein: „Ich suche euch!“ In der einstigen 4-Millionenstadt, in der es
noch drei Millionen Frierende gab, fand er uns! Das hielt ich für sehr bemerkenswert.
Er wollte uns nur mitteilen, dass die Konferenz ausfällt.
Alte
und behinderte Bürger starben an Hunger. Typhus war weit verbreitet.
Rückblickend war es wirklich ein Wunder, dass ich in den ständig überfüllten
Zügen fast immer einen Sitzplatz gefunden habe. Nichts war für mich gefährlich, außer die
schönen Augen gleichaltriger Mädchen, wenn sie mich anleuchteten... aber ich
war gehorsam und sagte mir: „Sei brav, Gerd, eines Tages wirst du die beste
und schönste junge Dame finden und sie eines Tages heiraten.“
Auf
meinen Reisen sah ich viele Städte in Ostdeutschland. Nicht alle waren so zerstört wie Hamburg.
Schwerin,
Greifswald und Stralsund, Orte die ich oft aufsuchte, blieben von den
Luftangriffen der Alliierten unbeschädigt, Berlin, Demmin, Neubrandenburg,
Dresden und zahlreiche andere Wohnorte lagen jedoch weithin in schwarzen
Trümmern. Es war deprimierend die allgemeine Hoffnungslosigkeit vieler älterer
Frauen zu sehen und zugleich die lauten Tanzvergnügen anderer zu hören.
Jahre
später wurde mir klar, dass die Hand Gottes das deutsche Volk nicht ungestraft
ließ. All das Böse, das Naziland über die Köpfe seiner Mitmenschen brachte,
hatte schlimme Folgen. Sah Nephi dieses selbstverschuldete Elend nicht lange
vor meinem Tag voraus? “… so spricht Gott, der Herr… O ihr Anderen, habt ihr
der Juden gedacht, meines Bundesvolkes aus alter Zeit? Nein; sondern ihr habt
sie verflucht und habt sie gehasst und
habt nicht danach getrachtet, sie zurückzugewinnen. Aber siehe, ich werde euch
das alles auf euer eigenes Haupt zurückbringen; denn ich, der Herr, habe mein
Volk nicht vergessen“ 2. Nephi 29:4-5
![]() Gleich
nach dem Zusammenbruch des sogenannten 3. Reiches, der Nationalsozialisten
wurde bekannt, dass Millionen Juden, nur weil sie Juden waren, in
Konzentrationslagern zusammengepfercht und dann verbrannt wurden. Es traf sie
allesamt, Kinder und Mütter, Uralte und Hinfällige Menschen. Plötzlich war das
Entsetzen groß. Von diesem Ausmaß der Vergehen hatte nur wenige Kenntnis. Es
wurde wohl verborgen. Ich sah im Geist den Totenkopf des SS- Mannes P. den er als Kokarde an
seiner Dienstmütze trug. So dachte auch zurück an die Familie Eckdisch und
fragte mich: “Warum die Europäer, insbesondere die Deutschen, die Juden verfolgten?
Wie konnte es jemals zu Großverbrechen dieser Größenordnung kommen?“, und
in diesem Zusammenhang fragte ich mich selbst:
Gleich
nach dem Zusammenbruch des sogenannten 3. Reiches, der Nationalsozialisten
wurde bekannt, dass Millionen Juden, nur weil sie Juden waren, in
Konzentrationslagern zusammengepfercht und dann verbrannt wurden. Es traf sie
allesamt, Kinder und Mütter, Uralte und Hinfällige Menschen. Plötzlich war das
Entsetzen groß. Von diesem Ausmaß der Vergehen hatte nur wenige Kenntnis. Es
wurde wohl verborgen. Ich sah im Geist den Totenkopf des SS- Mannes P. den er als Kokarde an
seiner Dienstmütze trug. So dachte auch zurück an die Familie Eckdisch und
fragte mich: “Warum die Europäer, insbesondere die Deutschen, die Juden verfolgten?
Wie konnte es jemals zu Großverbrechen dieser Größenordnung kommen?“, und
in diesem Zusammenhang fragte ich mich selbst:
Wiki Commons
Kam das
Verderben nicht auf unser eigenes Haupt zurück?
Walter
Krause wies darauf hin, dass die Kirche seit dem vierten Jahrhundert Juden drohte,
dass Bischöfe wie Ambrosius von Mailand und Cyrill von Alexandria sie grundlos bösartig
behandelten. Sie wollten sich, aus nachvollziehbaren Gründen nicht „christlich“
taufen lassen. Luther hasste sie, weil sie auch seine Glaubensversion
ablehnten.
Ich war
erstaunt: Zum Ersten was ich in der Bibel in meinem 17. Lebensjahr herausfand war,
dass die mehrfachen Weissagungen sowohl Verheißungen wie Warnungen aussprachen:
„Wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und
alle seine Gebote, die ich dir heute gebe, hältst und danach handelst, wird
der Herr, dein Gott, dich erhöhen über alle Nationen der Erde.“ Deuteronomium
28: 1
Aus der
Sicht der Beobachter des 21. Jahrhunderts steht fest, die Anzahl der Nobelpreisträger
jüdischer Herkunft zu allen anderen verhält sich prozentual zur
Gesamtweltbevölkerung wie hundert zu eins. Niemand kann es leugnen: Die
Israeliten sind ein besonderes Volk. Null-Komma-Null-Zwei Prozent aller stellen
mehr als jeden Fünften höchstausgezeichneten!
Aber
die Warnungen desselben Thorakapitels lauteten ebenso extrem: „Wenn du aber
nicht auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und nicht alle seine
Gebote und Satzungen, die ich dir heute gebe, hältst und nicht danach handelst,
dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen:
Verflucht
bist du in der Stadt, und verflucht bist du auf dem Feld … Der Herr wird
den Fluch, die Verwirrung und die Bedrohung auf dich loslassen bei allem, was
du unternimmst, bis du schon bald vernichtet und vertilgt wirst, deiner bösen
Taten wegen, weil du mich verlassen hast.“ Verse 15-20
Mehr
Antworten fand ich in den Werken des evangelischen Pfarrers und
Hochschullehrers Hartwig Weber. „Antisemitismus ist ein Produkt heidnischer
Zeiten, das von Christen offiziell und im Prinzip zur vollen Blüte gebracht
wurde … Nach dem Toleranzedikt von Konstantin dem Großen konnte sich der
Antisemitismus entfalten und wurde universell und dauerhaft. Die christliche
Kirche machte es zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Lehren ... Gregor von
Nyssa nannte die Juden im Jahr 370 „die Feinde der Barmherzigkeit, Verfechter
des Teufels, Hasser des Guten …“ Im Jahr 1215 forderten sie auf dem 4.
Laterankonzil, dass alle Juden und Araber eine Erkennungsmarke tragen sollten.
Infolgedessen wurden Juden verpflichtet, gelbe oder rote Hüte und einen gelben
Ring am Mantel zu tragen. Jüdinnen mussten ein Band auf ihrer Haube tragen. Die
Geschichte des Christentums ist seit den Tagen Konstantins eine Geschichte der
Verschmelzung von Macht und Krieg…“ „Jugendlexikon” S. 330
Keine Szene ist vergessen, nichts,
solange wir aneinander Interesse finden. Die alten Bilder von Menschenkindern,
die wir nie sahen und doch von deren Lebenskampf wir eine Vorstellung haben,
sie alle spielen mit, unser Weltbild zu formen.
Bedauerliche Tatsache ist, dass Luther, der Retter Europas vor
der Allmacht und der Verdorbenheit Roms, zur Judenhetze aufrief. Seine Kirche
befreite sich keineswegs von dieser Last, bevor die Niederlage Hitlers sie dazu
zwang ihre Mitschuld einzugestehen. Wahr ist allerdings auch, dass es in
Nazideutschland, mormonische Gemeindepräsidenten gab, die Judenfeindlichkeit
zeigten oder zuließen, obwohl sie damit entgegen ihrer Religion handelten. Aber
die Linie der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage war immer auf
die Sammlung Israels ausgerichtet und nicht auf deren Zerstreuung. Unser
Präsident und Prophet Howard W. Hunter (1904-1995) erklärte offiziell: "Sowohl
die Juden als auch die Araber sind Kinder unseres Vaters, beide Völker sind
Kinder der Verheißung und als Kirche ergreifen wir keine Partei. Wir schätzen
beide Völker, ihr Wohlergehen liegt uns am Herzen." Lehren der Präsidenten der Kirche.
Pfarrer Hartwig Weber
ist ehrlich: „Weder die evangelischen noch die katholischen Kirchenleitungen
konnten sich aufraffen, (während der Nazizeit) offen für die
verfolgten Juden einzutreten. Die Kirchen selbst waren von einem latenten
Antisemitismus
durchsetzt. Nur dort, wo die eigene Sicherheit und Macht auf dem
Spiel standen, traten die Kirchen dem NS-Staat entgegen…das Schicksal jüdischer
Minoritäten war demgegenüber zweitrangig. Unter den Christen gab es etwa
300 000 Juden als Gemeindemitglieder. 1933 standen 29 Juden in kirchlichem
Dienst… 1941 forderte die Kirchenkanzlei der Deutschen Evangelischen
Kirche die Kirchenbehörden dazu auf, „geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass
die getauften Nicht-Arier dem kirchlichen Leben der deutschen Gemeinden
fernbleiben…“ Hartwig Weber „Religion“ rororo , Rowohlt
1948 gab es mehrere
Begebenheiten, die entgegengesetzter nicht konnten
![]()
Links die drei Westsektoren, rechts das kommunistische Ostberlin
Seit Mai 1945 mussten die Sowjets
auf Basis von Bündnisverträgen zwischen den Siegermächten USA, Großbritannien
und Frankreich zulassen, dass die Alliierten, Truppen in Berlin stationierten. Die Kommunisten unternahmen
danach viele Versuche Westberlin in den Ostblock einzugliedern, indem man die
westlichen „Besatzer“ aufforderte ihre Koffer zu packen und zu verschwinden –
und wenn es nicht im Frieden ging, dann musste man eben nachhelfen. Es ging,
dann bereits ab 1948 auf „Biegen und Brechen“. Zwischenziel der sowjetischen
Außenpolitik war es ohnehin ganz Deutschland zu vereinnahmen. Zunächst musste
der Störfaktor Westberlin ausgeschaltet werden, der jedoch lag inmitten des
roten Ostens.
Das geteilte Deutschland
zwischen 1945 und 89
Erster Anlauf:
In der Nacht zum 24. Juni
1948 sperrten sowjetische Truppen alle Zufahrtswege nach Westberlin. Die Versorgung der dort lebenden 2.2 Millionen
Menschen war gefährdet. Das war klarer Rechtsbruch. Wen aber sollte das
kümmern? Hauptsache für den
Personenkreis um Ulbricht war die Idee, dass die „Amis“ kapieren, dass sie
damit aufgefordert sind nachzugeben, ihren Platz zu räumen und
dass sie dem Kommunismus zu erlauben haben siegreich zu sein. Die Regierung der Vereinigten
Staaten handelte wütend, entschlossen und angemessen klug. Nachgeben: Nein.
Gewalt? Nein! Das Kalkül des Kremls war durchschaubar: Wenn 2 Millionen nach Brot rufen, das
Westberlin spätestens nach zwei Monaten nicht mehr im Angebot ![]() hat, weil der
hat, weil der
erforderliche Nachschub an Mehl aus Westdeutschland unterbleibt, muss die DDR einspringen und die Versorgungslücke schließen. Doch aus dem östlichen Geniestreich wurde nichts. Es wurde eine Luftbrücke eingerichtet. Eingeflogen wurden Güter wie Nahrung, Brennstoffe und anderes. Noch lagen, zu dieser Zeit, besonders in Ostberlin, große Stadtteile in Trümmern. Noch war die Stimmung gegenüber den Besatzermächten in Ost und West nicht gut.
Oft
sind es nur scheinbare „Kleinigkeiten“ die das Gute bewirken.
Die Sowjetunion gab die
Blockade erst am 12. Mai 1949 auf.
Nun allerdings war die
Feindschaft zwischen Ost
und West eine Endgültige, und zwar weltweit
Spiegel 9-1948 : „Das russisch besetzte Nordkorea wurde zur »Volksrepublik«
ausgerufen. Mit eigener Verfassung, einem 200 000-Mann-Heer und Hammer und
Sichel als Hoheitszeichen. Die politische Taufe des längst geborenen Bankerts
Nordkorea ist ein erstes offenes „Gardez“ (ein Ausdruck der im Schach verwandt wird) der Russen an die UNO. In Moskau waren die
Alliierten übereingekommen, nur eine gemeinsame Regierung für das
russischbesetzte Nordkorea und das amerikanische Südgebiet zuzulassen. Einer
UNO-Kommission, die dazu freie Wahlen durchführen sollte, wurde die Einreise in
die russische Zone verboten…
Die neugebackene Volksarmee Nordkoreas
marschierte im Paradeschritt durch die ebenfalls neu gebackene Küstenhauptstadt
Gensan. Über hundert russische Offiziere auf der Ehrentribüne salutierten. Auch
zwei amerikanische Verbindungsoffiziere waren gekommen. Sie bereuten es bald.
Eine aufgeputschte Menge riss ihnen die Uniformen vom Leibe und prügelte auf
sie los. Die Russen salutierten ungerührt weiter. Der US-Oberbefehlshaber in
Korea, General John Hodge, protestierte bei seinem russischen Kollegen…“
Ununterbrochen
lief im Osten die Propagandamaschine. Sie wurden nicht müde alles Westliche zu
diskreditieren und alles Kremlnahe in den Fantasiehimmel zu heben. Jeden Tag,
Jahr für Jahr erschienen die Meldungen durchweg in Schwarzweiß. Wenn im roten
Prag eine Modenschau stattfand dann war das ein Zeichen der Lebensfreude, aber
wenn in London die Königin mit einer goldenen Kutsche ausfuhr, war das reine
Dekadenz. Uns schien es oft, als genüge nur ein Missverständnis und Schwarz
würde auf Weiß in aller Härte aufprallen.
Im
Osten wurden die Getreideernten noch eingebracht wie im Mittelalter, während
drüben Mähdrescher zur Alltäglichkeit gehörten. Wir lebten mit der
Unsicherheit. Einerseits wären wir nicht überrascht, wenn Westberlin
angegriffen würde, andererseits war klar, dass dies nicht geschehen wird.
Russlands Wunden die ihnen der Krieg zu gefügt hat, waren nicht geheilt. Seit
Hiroshima fürchteten beiden Seiten ihr feindlicher Gegenüber würde zum Letzten
aller Mittel greifen. Die Vorstellung einer atomar verseuchten Welt erschreckte
selbst die härtesten Machtidioten. Rein zahlenmäßig sah es zwar wie ein
Kinderspiel aus, die bereitstehenden Divisionen im Zeichen der Sowjetflagge
einzusetzen um die Alliierten aus der ehemaligen deutschen Hauptstadt zu
vertreiben. In den drei Westsektoren gab zu dieser Zeit nur 12 000 Soldaten
insgesamt, davon etwa die Hälfte US-amerikanischer Militärs. Denen gegenüber
standen rund 200 00 sowjetische Truppen die Berlin umrundeten und weitere 180
000 auf ostdeutschen Boden mit 7 500 Panzern und 800 Bombern einschließlich
Jagdflugzeugen. Prof. Beier-Red – möglicherweise
aber ein anderer unter den kommunistischen Zeichnern – stellte damals mehrere
Karikaturen die dazu passten, die spaßig aussahen und todernst gemeint waren. Eine davon zeigte
einen auf dem Nordpol des Globus sitzenden Rotarmisten, er steckt den Schaft
der mit Hammer und Sichel bestückten roten Fahne in den Bauch der Mutter Erde.
Er, mit der Budjonny-Mütze, hat auf ihr Besitzerrecht im Wortsinn, Uncle Sam
dagegen nicht, der sich sorgenvoll den Kopf kratzt, denn seine Position auf dem
Erdball wird ihm von dem kess lächelnden Sowjetmenschen definitiv strittig
gemacht. Frechheit siegt. Der Russe macht, dass der Ami abrutschen muss, von
diesem Erdball, denn dieser Ball bietet nur eine einzige Sitz- und
Bleibemöglichkeit. Der Amikapitalist ist dazu verurteilt die Erde für immer zu
verlassen.
Unerwartet sagte mir eine
Pädagogin meiner Kirche Ungutes voraus. Sie wusste, dass ich hin und
hergerissen war, sobald mir eine Dorfschönheit ihre Liebe anbot, was nicht
gerade selten vorkam. Selbst Vater, der immer noch gegen seine Depressionen
ankämpfte, musste etwas bemerkt haben. Gelegentlich erhob er sich für einen Tag
vom Lager und nahm vorübergehend am Leben teil. Er fasste es in die Worte: „Was
finden die Weiber an dir kleinem Kerl?“
Recht hatte er. Ich war nur
1.65 groß. Allerdings immer lebhaft und positiv.
Die unverheiratete Dame die
über bemerkenswerte Sprachkenntnisse verfügte, urteilte oder spekulierte gern
über die Zukunft anderer, auch über die meiner Freunde. Mir sagte sie: „Für
dich wäre es das Beste, du stirbst früh.“ Mir sagte sie: „Für dich wäre
es das Beste, du stirbst früh.“ Das hätte ich nicht ernst nehmen sollen,
oder wenigsten bedenken, dass sie sich um meine ewige Zukunft sorgte.
Ich hätte lachen sollen. Doch
das Gegenteil war der Fall.
Ich sehe mich am Karfreitag 48
in der ersten Reihe des Opernhauses Rostock sitzen, um gegen geringes Entgelt,
Richard Wagners „Tannhäuser“ zu hören.
Machtvoll drangen die Worte: Hoch über aller Welt ist Gott Und sein Erbarmen ist kein Spott!“ Der wegen seiner Liebesaffären büßende Tannhäuser suchte die Vergebung.
![]()
Ich, 1946
Ich heulte buchstäblich in mich
hinein. Wochenlang! Nein noch hatte mich nicht, wie Tannhäuser, in den
Venusberg begeben, aber die Versuchung gab es. Und wer weiß? Das Urteil stand
bereits fest, falls doch: Du bist zu weich, besser für dich bald zu sterben.
Und dann kam das andere
Ereignis: Eines Freitags im Oktober, als ich in unserem Maschinenraum
Holzschuhe zurechtschnitt, kam Mutter herein. Sie überreichte mir ein
Telegramm: „Gerd, ich brauche deine Hilfe, komm bitte sofort. Walter
Krause.“ Ich stoppte sofort den Motor, schaute auf die Uhr und befand mich
30 Minuten später am Bahnhof. Es war die einzige Möglichkeit zu reisen. Mein
Ziel lag in 100 Kilometer Entfernung. Es war später Morgen. Die Fahrt wurde etwa 25 Kilometer vor meinem
Ziel unterbrochen. Die Bahnbeamten
teilten uns mit, dass die Bahnstrecke gestört sei. In den nächsten 8 bis 10
Stunden würde es keine Züge in Richtung Berlin geben.
Ich musste eine Entscheidung
treffen. „Na ja“, dachte ich mir, „ich muss einfach laufen…“ Fünf Stunden
später erreichte ich hungrig und erschöpft Prenzlau. Walter Krause schüttelte
mir die Hand und sagte: „Gerd, wir brauchen den Schlüssel zu den
Versammlungsräumen, damit wir morgen unseren Gottesdienst haben können. Mir
geht es nicht gut genug, um Bruder Popanz zu besuchen. Er selbst ist
krank. Würdest du uns die Schlüssel
besorgen?“ Neubauer Popanz (einer der ersten deutschen Missionare nach dem
Ersten Weltkrieg) lebte mindestens 10 Meilen von Krauses entfernt. Also lief
ich am nächsten Tag noch einmal etwa 35 km.
![]() Am nächsten Tag, nachmittags
gegen 14 Uhr, öffneten wir die Tür zu dem kleinen, aber feinen Zimmer. Ich
hatte keine Ahnung, dass dies eine der besten Versammlungen meines Lebens
werden würde. Wir hielten unser Treffen im ersten Stock ab. Im Raum direkt
unter uns feierten junge Leute eine Party mit sehr lauter Musik. Es war ein heißer Nachmittag. Wir waren zu
sechst oder zu acht und sangen: „Wir danken Dir, o Gott, für Propheten.“
Elder Krause, einziger Sprecher für die nächsten dreißig Minuten, begann zu reden
und ich hörte seine ersten Worte. Für mich waren es auch die letzten. Ich fiel
in einen tiefen Schlaf. Es war wunderbar. Ich bin sicher, dass ich euch im
nächsten Leben dieselbe wahre Geschichte erzählen werde. Hier segneten mich höhere
Mächte mit herrlichem Glück, denn genau in dieser halben Stunde konnte ich die
wunderbare Kraft eines wahrhaft Heiligen Geistes spüren. Es war, als ob sanfte
Wellen wieder und immer wieder liebevoll streichelnd über meinen ganzen Körper
glitten. Vor mir stand ein Tisch. Auf ihm lag mein Kopf. Das Großartige nahm
ich sonderbarerweise deutlich wahr, obwohl ich fest schlief. Und das obwohl es
von unten her sehr weltlich herauf dröhnte, dieses Stampfen vieler Füße auf
hartem Parkett, das Wummern und Tosen eines Schlagzeuges. Ich erhielt trotz der
entgegengesetzten Umstände die Bestätigung, dass Joseph Smith in seiner Zeit der
Sprecher Christi war. Wieder und wieder lehrte er, dass jeder Mensch über einen
freien Willen verfügt den niemand, selbst Gott nicht, antasten darf, dass jedermanns
Rechte
Am nächsten Tag, nachmittags
gegen 14 Uhr, öffneten wir die Tür zu dem kleinen, aber feinen Zimmer. Ich
hatte keine Ahnung, dass dies eine der besten Versammlungen meines Lebens
werden würde. Wir hielten unser Treffen im ersten Stock ab. Im Raum direkt
unter uns feierten junge Leute eine Party mit sehr lauter Musik. Es war ein heißer Nachmittag. Wir waren zu
sechst oder zu acht und sangen: „Wir danken Dir, o Gott, für Propheten.“
Elder Krause, einziger Sprecher für die nächsten dreißig Minuten, begann zu reden
und ich hörte seine ersten Worte. Für mich waren es auch die letzten. Ich fiel
in einen tiefen Schlaf. Es war wunderbar. Ich bin sicher, dass ich euch im
nächsten Leben dieselbe wahre Geschichte erzählen werde. Hier segneten mich höhere
Mächte mit herrlichem Glück, denn genau in dieser halben Stunde konnte ich die
wunderbare Kraft eines wahrhaft Heiligen Geistes spüren. Es war, als ob sanfte
Wellen wieder und immer wieder liebevoll streichelnd über meinen ganzen Körper
glitten. Vor mir stand ein Tisch. Auf ihm lag mein Kopf. Das Großartige nahm
ich sonderbarerweise deutlich wahr, obwohl ich fest schlief. Und das obwohl es
von unten her sehr weltlich herauf dröhnte, dieses Stampfen vieler Füße auf
hartem Parkett, das Wummern und Tosen eines Schlagzeuges. Ich erhielt trotz der
entgegengesetzten Umstände die Bestätigung, dass Joseph Smith in seiner Zeit der
Sprecher Christi war. Wieder und wieder lehrte er, dass jeder Mensch über einen
freien Willen verfügt den niemand, selbst Gott nicht, antasten darf, dass jedermanns
Rechte
Joseph Smith 1805-1844
ewig sind. Nur die Geflechte aus
Fehlentscheidungen, infolge der uns angeborenen Selbstsucht, können das jedem
bestimmte Glück beeinträchtigen. Um ungetrübte Seligkeit zu erlangen sollen wir
Christi Gebote halten. Städte sollten übersehbar große Gartenstädte sein in denen jeder
jeden kennt, was aufkommender Kriminalität entgegenwirkt. Gesetzesübertreter
sollten nicht in Zellen eingesperrt werden, sondern in Bildungseinrichtungen.
Bodenschätze gehören allen, nie Einzelnen. Über alledem muss jedem die Würde
des anderen wichtig sein. Gott kann man nicht dienen, außer man ist dem
Nächsten dienlich.
Genau 50 Jahre später
berichtete ich in meiner Ansprache an die Mitglieder in Prenzlau von diesem
Erlebnis. Nach dem Treffen kamen Edith Krause und Luise Eckert auf mich zu und
sagten: „Ja, wir können uns an diesen Tag erinnern und an die wunderbare Wahrnehmung
eines beglückenden Geistes, den wir deutlich spüren konnten. Es war auch für
uns eine besondere Zeit."
1948
fand das große „Freud-Echo“ Treffen in Westberlin in der Waldbühne statt.
Ungefähr 5 000 Mitglieder der Kirche und ihre Freunde kamen zusammen. Teile der
Ansprache des Präsidenten der Ostdeutschen Mission, begleiten mich bis heute,
da ich nun im 95. Lebensjahr stehe. „Pflegt das Familiengebet.“ sagte
Walter Stover. „es bindet eure Herzen stärker zusammen als alles andere in
der Welt.“ Jedenfalls fasste ich seine Rede, so zusammen.
2006 wurde ich auf kuriose Weise
an diese Großzusammenkunft erinnert. Wir standen nach einer der Versammlungen
der Herbstkonferenz der Kirche in Salt Lake City zusammen. Etwa zehn oder mehr
Leute bildeten einen Kreis. Die Mehrheit wusste wer ich bin. Wir tauschten
unsere Erinnerungen aus. Ingrid, meine Frau, stand neben mir.
Aus fünf Metern Entfernung
schaute mich eine sehr schlanke Frau intensiv an. Ich zuckte hilflos meine
Achseln. In der folgenden Gesprächspause sagte sie: „Aber Gerd du weißt wer
ich bin! Ich bin Hildchen aus Berlin. Du hast doch mit mir auf dem Heuboden
meiner Eltern geschlafen!“
Das Schweigen der Anwesenden und
ihre Augen sprachen Bände.
So kannten sie mich nicht.
Es dauerte einige zäh
hinfließende Sekunden, - Heuboden? … in Berlin? – Da fiel es mir wie Schuppen
von den Augen: „Das war 1948 während des „Freud-Echos!“ Sie nickte
freudig und die andern schauten immer noch verlegen. „Wir waren damals rund
200 Leute die auf dem erwähnten riesigen Heuboden deiner Eltern ein
Nachtquartier gefunden hatten.“ Auch Westberlin lag ja damals noch weithin
in Trümmern. Wo, wenn nicht auch an solchen Plätzen hätten wir sonst Platz
gefunden? Da oben hätte sie – ich weiß es bis heute nicht – direkt neben mir
gelegen. Das Aufatmen der uns umringenden Leute endete mit Lachen.
Im Frühjahr 1949 verließ ich
Wolgast und wurde Lehrling in einer Baumschule in Prenzlau. Max Zander hatte
mir das ermöglicht. Auch er zog nach Prenzlau und wurde Berufsschullehrer,
ausgerechnet in meiner Klasse. Da auch die Familie von Walter Krause nach
Prenzlau gezogen war, wurde ich ihr Untermieter.
Unter dem Titel „Baumschule“ hatte ich mir etwas ganz anderes vorgestellt. Ich fühlte mich wie ein Sklave und wollte dieses Kapitel meines Lebens so schnell wie möglich abschließen. Allerdings sollte es noch weitere zweieinhalb Jahre dauern, bis ich meine Ausbildung mit der Note „sehr gut“ abschließen konnte. Bis Mitte Juli 1949 lebten wir in den alten Armeegebäuden der Stadt. Dann wurden diese riesigen Gebäude von der neu gegründeten Volksarmee-Armee beansprucht. Drei Monat bevor aus der Sowjetzone die DDR wurde.
Gemälde nach dem Wolgaster
Maler Schöngrün
Viele Jungs meines alters
ließen sich locken, in der Armee ein sorgenfreies Leben zu führen. Wo immer sie
zuvor beschäftigt waren verdiente niemand monatlich mehr als 250 Mark. Die
Werber boten ihnen 800. Wer ohnehin arbeitsscheu dachte, unterwarf sich der
damit verbundenen Hirnwäsche. Selbst dem Dümmsten war klar, dass der sich ihnen
aufdrängende Kommunismus auf jene Unterwerfung aller ausgerichtet war, die Herr
Pfarrer Rößle in seinem Machwerk, der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tag vorwarf. Hatte er nicht wörtlich formuliert: „Das Ziel der
Mormonen ist es, alle zu bekehren, um die gesamte Menschheit zu versklaven. Das
gesamte System ist darauf ausgelegt, dieses Ziel zu erreichen.“ Flossen
nicht aus seiner Feder die denkwürdigen Sätze:
„Diese nominell noch kleine,
völlig andere Kirche wird eines Tages globalen Status erlangen. Diese
amerikanische Kirche ist ein gefährlicher, oberflächlicher Glaube mit einem
völligen Mangel an biblischem Wissen, unterstützt durch die Macht Satans. Unter
dem Banner des Evangeliums verbreiten sie ihre Lehren. Aufgrund ihrer
satanischen Kräfte wird die Mormonensekte zu einer Weltmacht und einer großen
Gefahr für die Nationen der Erde werden.
Die
Bolschewisten Stalins strebten die Weltmacht an. Das Hissen der roten Fahne über den Zentren
der USA war längst beschlossene Sache.
Wir
lasen nicht nur die über der Ostzone von Ballons abgeworfenen Flugblätter die
aus Händen westlicher Menschenrechtler kamen. Sie berichteten, wie Angehörige
der Kreml - Opposition in Russlands Weiten, als angeblich unverbesserliche
Kriminelle sich zu Tode schuften mussten. Wir hörten Westsender und vernahmen
Berichte von Frühheimkehrern aus sowjetischer Gefangenschaft. All wussten sehr
wohl, um was es ging. Aber Geld stinkt nicht.
Dort in
den „Alsen-Kasernen“ fanden bis Juli 49, auch unsere Kirchentreffen statt und
direkt über uns versammelten sich die Zeugen Jehovas. Eine Gruppe von etwa 40
Personen. Gelegentlich besuchte ich ihre Gemeinde, um zu erfahren, was andere
glaubten. Wir unterhielten uns freundlich miteinander. Dreizehn Monate später
erklärte die Regierung die Zeugen Jehovas für verboten.
Kurz
bevor das geschah, gab die kommunistische Administration den „Zeugen“ die
Gelegenheit sich zu blamieren. Ein abgekartetes Spiel sollte folgen. Die
leitenden Männer der Zeugen Jehovas durften eine Großversammlung abhalten. Sie
konnten die Versammlung nach Belieben gestalten. Ich war dabei als sie
wunderbare Jerusalem Lieder vortrugen. Sie verkündeten: in wenigen Jahren wird
Jesus seine Herrschaft auf Erden antreten...
Ungefähr
600 Leute kamen zusammen, - mindestens 500 aus reiner Neugierde - gegenüber
vielleicht 50 der frommen Gegenseite.
Natürlich
musste den Unerfahrenen jeder Satz den die Redner aussprachen weltfremd, verworren
und verschroben erscheinen. Dann kam es zu einem Wortgefecht. Ein Kommunist
erklärte: „Ich saß 12 Jahre im Konzentrationslager. Ich weiß, einige von euch
ebenfalls. Wir Marxisten mussten mitleiden, wenn zusätzliche Schikanen auch
über uns verhängt wurden, und das nur weil verbohrte „Zeugen“ sich weigerten
die Mütze vom Kopf zu ziehen, wenn ihnen ein SS - Mann begegnete. Wir schämten
uns, aber wir übten Disziplin, um nicht eine Steigerung des Zorns unserer
Todfeinde herauszufordern.“
Eine
halbe Stunde ging es hin und her. Die Atheisten gewannen, wie sie sich zuvor
schon ausgerechnet hatten, Pluspunkte, ihre Gegenüber nicht. Es war eine
Propagandashow, die mir etwas mehr Verständnis für beide Seiten gab.
In der
Baumschule leistete ich im Vorsommer 50, harte Arbeit und sehnte das Ende
meiner Dienstzeit herbei. Noch lagen mindestens 18 weitere mich strapazierende
Monate vor mir.
Damals,
in den letzten Junitagen, traf ich, auf der Uckerpromenade einen alten
Klassenkameraden wieder, Dieter Kavelmann. Stolz trug er die blaue Uniform der
Volkspolizei. (Kasernierte Polizei)
Ich
hörte, dass er jetzt in derselben Kaserne lebte, in der ich einige Wochen lang
wohnte.
Eine liebliche, sehr junge Dame schmiegte sich
an seinen Arm. Über uns ertönte das Zischen und Dröhnen eines modernen,
düsengetriebenen, sowjetischen Kampfflugzeuges. Er sollte zu einem der Zeitzeichen
der neuen Gesellschaftsordnung werden, die weltweit siegen wollte. Ich schaute
mir Dieters geflochtene silberne Schulterlitzen an. Trotz seiner knapp 21 Jahre
war er bereits zum Oberrat befördert worden. Das entsprach nahezu dem Rang
eines Oberstleutnants. Allerdings wirkte er älter und reif. Er blickte scheinbar
durch mich hindurch und machte eine Bemerkung über die Zwangsjacke, die ich
trug. Ja, ich war nichts weiter als ein armer Lehrling, der ich bleiben würde. Er dagegen war jemand. Ich hasste meinen Job
noch mehr als meine eigenen Schwächen. Dieter erkannte, dass ich nur aufgrund
meiner starken moralischen Grundsätze nicht den Willen aufbrachte, den Vertrag
mit meinem Baumschulen-Chef zu brechen. Er lachte mich aus. Er sah nicht nur
glücklich aus, er war es. „Komm zu uns!“, lockte er: „du hast eine
vormilitärische Ausbildung, wie ich. Wir suchen solche Leute. Komm und mache
mit!“ In meinen Ohren klang es auf jeden Fall eine Weile, wie Musik. "Ja!",
schmunzelte er: „Du hast einen klaren Kopf für Ideologie. Ich kenne dich
doch!“ Er malte ein fabelhaftes Bild mit leuchtenden Farben. „Armer Gerd, du verdienst nur 50 Mark im Monat.
Wenn du zu uns kommst, erhältst du stattdessen umgehend fast zehnmal so viel. Verlasse
deinen Chef, der dich nur ausnutzt.“ Während dieses Gesprächs blickte er
wieder auf die schlanke Blondine an seiner Seite herunter. „Nach 6 Wochen
wirst du alles haben, was Männer verlangen. Du kannst reden und siehst gut aus.
Mädchen mögen dich.“ Die Dame neben ihm lächelte wieder. Ich fühlte, wie
mein Gesicht vor Scham und Neid rot wurde. Mir ging danach nur eine Frage durch
den Kopf: „Wenn du, Gerd, die Lehre hinwirfst, wer wird das Sagen haben? Wer
wird dein Gott sein? Kann Lüge die Wahrheit töten?
Das
Einzige, was uns vor Irrtümern und Verwicklungen bewahren kann, ist der
entschlossene Wille, nach der Wahrheit zu suchen.
Im
Hintergrund erschien die dunkle Gestalt Josef Vissarionovich Stalins deutlich
vor meinen Augen – der kalte Ausdruck seines Gesichts, ein Gesicht, das an so
mancher Straßenecke und in vielen Amtsgebäuden zu sehen war. Sonderbar,
anscheinend liebten immer mehr Leute diesen Mann, der wie Hitler das Leben von
Millionen Menschen zerstört hatte. Er war ein Massenmörder. Diese Tatsache wurde, mittels
Propagandatricks, anscheinend verdrängt.
Ich werde nicht zulassen, dass
Menschen in seinen Diensten mir Stalins rote Farben ins Gesicht malen. Der
Wille eines bösen Mannes, der die Welt unterwerfen will, wird mich nicht zwingen.
Stalins Uhr geht anders als meine. Sie bestimmte nun den Rhythmus des Lebens
meines Freundes Dieter. Ich wusste, dass
ich nicht dazu geboren war, so zu sein, wie er. Ich hatte Einsichten gewonnen,
die er nie gesucht hatte, die er allenfalls für Illusionen hielt.
Doch kurz nach diesem Gespräch
gab ich dem Zeitgeist „ein wenig“ nach. Ich brachte die ganze 30-köpfige
Gärtnerklasse dazu sich der Freien Deutschen Jugend (FDJ) anzuschließen. Wir
sollten damit ausdrücken, dass wir uns den positiven Zielen der neuen
Weltordnung nicht widersetzen. Die FDJ war damals noch eine nichtkommunistische
Organisation in der Kritik und Selbstkritik geübt wurde. Ich selbst war zuvor
eingeladen worden an einer Zusammenkunft von etwa 25 Teilnehmern zu besuchen.
Es gefiel mir wie der Gruppensekretär ein überzeugendes Beispiel gab. Er
kritisierte die Praktiken des aufkommenden Bürokratismus in der DDR. Zu viele
Leute liefen mit Aktentaschen durch die Gegend und zu wenige in
Arbeiterkleidung. Was er unterschlug war
die Tatsache, dass es in weiten Teilen Ostdeutschlands kaum Industrie gab.
Hier dominierte der
Agrarbereich. Doch vor der superschweren Landarbeit drückte sich nahezu jeder.
Noch gab es zu wenig Technik. Gepflügt wurde mit Pferden. Noch war monogermes Zuckerrübensaatgut, die
das mühselige Vereinzeln der Pflanzen später erübrigten, ein Wunschtraum.
Mähdrescher wollten in der DDR erst irgendwann gebaut werden. Dafür liefen immer mehr Polizisten durch die
Gegend. In Orten von wenigen Tausenden, wie Prenzlau, gab es mindestens
achthundert. Des prokommunistischen
Sekretärs anschließende Selbstkritik klang ehrlich, er müsse sich noch mehr
bemühen ein perfekter Mensch zu werden.
Wie sehr gerade dieser Aspekt
doch den Idealen meiner Kirche entsprach.
Da brach der Koreakrieg aus
Im Sommer 1950, hingen riesige
Banner aus den Fenstern unserer ehemaligen Tagungsräume in Prenzlau, Alsenstr.
1. Diese roten Stofffahnen waren 20 Meter lang. Sie trugen die Inschrift: „Grüße
an unsere Brüder in Korea, die gegen die US-Imperialisten kämpfen.“ Damit
sollte darauf hingewiesen werden, dass die Aggression aus Südkorea und den
Hintermännern aus den USA kam, und dass die friedliebenden Nordkoreaner zu
hilfesuchenden Opfern geworden seien. Sollten die jungen Volkspolizisten, –
rund fünfhundert Mann – allesamt, wie in vielen anderen ostdeutschen Städten,
an die Seite der Nordkoreaner transportiert werden? Unmöglich war das nicht. Da
war er nackt, der Haken, Leute wie mein Dieter könnten ins Feuer hineingezerrt
werden.
Intuitiv war mir klar, dies war
ein anderer rücksichtsloser Griff der Stalinisten – in diesem Fall mit Hilfe
der nordkoreanischen Genossen – nach der Vorherrschaft über unseren Globus.
Allerdings, mittlerweile, da
meines Wissens weiter nichts Nennenswertes geschah, hatte dieses Ereignis meine
zum Positiven neigende Meinung nicht völlig geändert.-
Zu
diesem Zeitpunkt war ich bereits zum Schulleiter der 600 Lehrlinge gewählt
worden. Ich hielt ein paar Reden vor den Jungen und Mädchen, wollte sie an mich
binden und meiner Stimme Gehör verschaffen. Die Idee von der Völkerfreundschaft
die derzeitig in allen DDR-Medien hochgelobt wurde, musste mir gefallen, obwohl
sie als Propagandamittel missbraucht wurde.
Nach
großen spirituellen Erfahrungen im Evangelium hinkte ich nun auf beiden Seiten.
Sonntags war ich engagiertes Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage und im Alltag Sympathisant der guten Seiten des DDR-Systems.
Allerdings wuchs in mir die Zahl der unbeantworteten Fragen.
Dann
zeigten sie uns FDJ-Funktionäre im Prenzlauer Kino angebliche Beutefilme, die
beweisen sollten, dass die verdammten Amerikaner damit angefangen hatten.
Nur wer das wirklich wollte, konnte glauben, dass der angebliche Aggressor
Südkorea im Bündnis mit den USA am ersten Kriegstag, dem 25. Juni 1950, um 60
km zurückgeschlagen wurde.
Meine
Begeisterung für die FDJ litt unter diesen unzumutbaren Schiefdarstellungen. Doch
der nicht unentwegt aufmerksame Mensch gewöhnt sich an alles, zumal, wie in
diesem Fall, alles fernab geschah.
Uns
bewegten die Zeugnisse der Mutter Eckert. Eine ihrer Schilderungen blieb mir in
lebhafter Erinnerung. Sie, aber nicht ihr Ehemann, schloss sich in den frühen
30 er Jahren der Kirche an, zu einer Zeit als es in Deutschland sechs Millionen
Familienväter gab die seit Jahren schon arbeitslos dahinvegetierten. Sie
erhielten damals nur knapp 7 Mark Wohlfahrtsunterstützung pro Woche von einem
Staat der unter den Versailler Reparationszahlungen von jährlich 2 Milliarden
Goldmark litt.
Ehemann
Eckert, obwohl schmal gebaut, verdiente als Grobschmied sein Geld. Er wurde
seitens unserer Missionare befragt, ob seine Frau Teil-Zehnten zahlen
darf. Sie selber hatte kein Einkommen.
Schmied Eckert, seinem Wesen nach gutmütig, sagte zu: „Unter der Bedingung,
dass ich immer ausreichend zu essen habe.“ Dann kam jener Tag an dem Mutter
Eckert ratlos in ihrer Küche stand. Das Wirtschaftsgeld war aufgebraucht.
Hinlänglicher Vorrat, außer einigen Kilogramm Kartoffeln, Salz und Zucker, war nicht
verfügbar. Was sie ihrem Mann vorsetzen konnte wusste sie bei bestem Willen
nicht. In ihrer Verzweiflung betete sie in sich hinein: „Vater im Himmel,
die Missionare deiner Kirche gaben meinem Mann die Verheißung: Du wirst nie
hungrig sein!“
Eine
Stunde später klopfte es. Ein Bekannter trug einen Wassereimer. Er nahm das
Tuch herunter. Sie sah bis oben gefüllt pfundschwere Barsche: „Heute bissen
sie wie verrückt!“ Mutter Eckert schluckte. Er fing sie auf dem nahe
gelegenen Uckersee. Seine Frau hätte
noch Barsche vom Vortag: „Mir kam der Gedanke, dass Eckerts große
Fischfreunde sind.“
Der erwähnte Polizist kam nach
einer meiner Reden zu mir. Ich hatte über den großen Evangeliums-Grundsatz des
ewigen Fortschritts meditiert. Dem Mann gefielen vermutlich einige Passagen: „Ich
komme nicht zurück.“
Dies bedeutete, dass die
„Mormonen“, nach der Einschätzung dieses Kontrolleurs, keine Staatsfeinde
seien.
Hin und
hergezogen nahm ich ein Jahr später im August 1951 an den 3. Weltfestspielen zu
Berlin teil, auch weil ich neugierig und lebenshungrig war.
Die
Einladung zu diesem Großereignis war breit angelegt. Alle Idealisten, die
friedens- und freiheits-liebenden Studenten und Jugendlichen aus aller Welt
sollten sich in Berlin zusammenfinden und einander näherkommen.
Allesamt
sollten ihre Talente und Überzeugungen zur Schau stellen. Ich ahnte nicht im
Mindesten, dass es die bis dahin weltgrößte Sex Party werden sollte. Wir
reisten in Güterwagen. Sie waren mit Stroh und primitiven Holzbänken
ausgestattet worden.
![]() In
Berlin angekommen, hatten wir einen langen Fußmarsch vor uns. Immer wieder
stoppte unsere Marschkolonne, aus der ich bald ausscherte. Da saß dann, mitten
auf dem grauen Bürgersteig, ein Dreißiger in einem Blauhemd der FDJ, das ich
nie trug. Ich kannte ihn. Das war der Prenzlauer Baptistenprediger!
In
Berlin angekommen, hatten wir einen langen Fußmarsch vor uns. Immer wieder
stoppte unsere Marschkolonne, aus der ich bald ausscherte. Da saß dann, mitten
auf dem grauen Bürgersteig, ein Dreißiger in einem Blauhemd der FDJ, das ich
nie trug. Ich kannte ihn. Das war der Prenzlauer Baptistenprediger!
Bei der
drückenden Schwüle der Witterung, war ihm wahrscheinlich vom vielen Umherrennen
schlecht geworden. Bleich hockte er auf dem grauen Straßenpflaster und stöhnte.
Junge Leute umrundeten ihn, ohne mehr als flüchtige Notiz von ihm zu nehmen.
Ich ging auf ihn zu, sprach ihn an. Wir betrachteten einander verwundert. Was
suchst du hier, dachte ich. Du passt hier doch nicht her. Bist du übergelaufen
zu den Atheisten? Wenn du wüsstest, was du für ein Bild abgibst. Möglicherweise
dachte er dieselben Fragen an meine Adresse. “Ein Mormone bei den
Kommunisten?”
„Ich
will nur studieren und sehen, dann urteile ich!“
rechtfertigte ich mich vor mir selber. Aber tatsächlich zog mich die “rote”
Welt in jenen Stunden stärker denn je zuvor an. Ich hatte mich bei meiner Tante
Berta angemeldet die nahe dem Alexanderplatz wohnte, nicht weit entfernt von
dem Ort wo der Prediger und ich einander trafen.
Am
nächsten Tag sah ich, wie die Menge der Jugendlichen zugenommen hatte. Die blauen
Hemden waren die Farbtupfer in dieser völlig grauen Stadt, in der immer noch
die schwarzen Ruinenflächen dominierten. Alle Kinos Ostberlin, alle
Kulturstätten standen uns unentgeltlich zu Diensten. Ähnlich verhielt es sich
mit der Verpflegung.
Unvergessen
die Stimmung der Tausende, insbesondere als Swjatoslaw Richter, einer der
Sendboten des Kremls, im Friedrichstadt – Palast, das erste Klavierkonzert von
Tschaikowski im Friedrichstadt-Palast für uns spielte. Wie seine Hände über die
Tastatur flogen sah ich erregt, weil ich ihm nahe genug saß.
Die
Fülle großartiger Harmonien wollte nicht enden. Es riss uns fast in den Himmel.
Ich fühlte wie die wahrhaft göttliche Musik selbst den geringsten Gottlosen
erfasste. Das bewies die Menge der
Hände, ihr rhythmisches Klatschen danach, in das ich begeistert einfiel. Alle
in ihren Blauhemden waren aufgesprungen, ebenso die ausländischen Gäste. Und
dieser anhaltende Jubel war echt. Gemeinsam wanderten wir von einem kostenlosen
Konzert (vorgetragen von weltberühmten Künstlern) zum nächsten. Es war ein
erhabenes Gefühl, mit so vielen Menschen in besten Absichten verbunden zu sein.
Die Stunden vergingen wie im Flug. Eine tschechische Blaskapelle spielte im
Freien auf dem Mont Klamott – dem Berg der aus den Trümmern ehemaliger
Wohngebäude entstanden war. Die goldenen Instrumente leuchteten an diesem
späten Tag unter dem noch blauen Himmel. Hunderte Menschen lagen neben mir im
Gras. Dann sah ich neben mir eine zarte, sehr junge Hand. Ohne darüber
nachzudenken, was ich tat, legte ich meine Rechte auf die des Mädchens. Es
vergingen ein oder zwei Minuten, bis ich ihr Gesicht sah. Es lächelte mich an.
Sie muss achtzehn gewesen sein. Wort- und regungslos lauschten wir gemeinsam
den anheimelnden böhmischen Volksweisen. Erst als wir aufstanden, fing ich an,
Unsinn zu reden. Wir begleiteten uns gegenseitig zwei Stunden lang nach Hause, nachdem
die Nacht hereinbrach. Wir umrundeten weite Teile des Alexanderplatzes. Wir
gingen nicht Hand in Hand, sondern lässig Seite an Seite. Ich weiß nicht mehr,
worüber wir sprachen, aber im Laufe des Abends, sahen wir immer mehr Mädchen
und Jungen, die in Hausnischen und anderen Plätzen sich aneinanderklammerten
und ihrer Lust hemmungslos freien Lauf ließen. Irgendwann blieben wir vor dem
Haus meiner Tante stehen, Mehner Straße 9. Es war das Einzige im Umkreis von zwei-
oder dreihundert Metern, das noch intakt dastand. Zwischen den schweren
Ziegelfragmenten hing noch der Brandgeruch längst vergangener Nächte des
Schreckens. Darüber wölbte sich ein klarer Sternenhimmel. Ich sah im Geist die
beiden gelähmten alten Damen, die jahrelang bei jedem Luftangriff unter den
Esszimmertisch gekrochen waren, und Gott jedes Mal darum gebeten hatten,
beschützt zu werden. Hatten sie es bewirkt, dass dieser Hausteil noch immer
dastand? Oder war es lediglich ein glücklicher Zufall gewesen?
„Hast du ein eigenes Zimmer?“
Diese Frage war das Ergebnis
meines inkonsequenten Verhaltens.
Nur ich konnte so naiv sein.
Sie sagte: „Keine Sorge, ich habe einen Gesundheitspass.“
Ich habe mich selbst verdammt!
"Ich bin Mormone!“ das
platzte aus mir, ein wenig gequält, heraus.
Sekundenlang bereute ich meinen
Status. Dieser winzige Zeitraum jedoch legte offen, wie anfällig ich Mensch für
Versuchungen war.
Ich redete wieder.
Das ist wahr.
Sie verstand nichts: „Ich
bin als Waise unter Jungen aufgewachsen, die mich nie gefragt haben…“
Mit großer Bitterkeit im
Herzen, drehte ich mich um.
Ihre Welt kannte keine Leute
wie mich.
Ich ließ ich sie einfach dastehen,
weil ich mich in der Dahlemer Gemeinde sitzen sah. Sie musste mich als Idioten
betrachten. Mit den ersten Schritten kam ich mir vor, als würde mich eine
Zentnerlast niederdrücken. Ich hätte wegen der Widersprüchlichkeit meiner Natur
heulen können.
Sie wird mich verflucht haben.
Und ich habe die ganze Nacht sehr unruhig geschlafen. Am nächsten Morgen, auf
dem Weg zur Kirche, zogen mich FDJ-Wachen aus der S-Bahn am Bahnhof Potsdamer
Platz heraus. Es handelte sich um die letzte Haltestelle Ostberlins.
Ich wollte wiederum ehrlich
sein, trug zwar nicht das blaue Hemd, aber immer noch mein FDJ-Abzeichen am
Revers. Die leitenden Kommunisten wussten, welche Anziehungskraft der reiche
Westen, gegenüber der Armut im Osten ausübte. Sie wollten verhindern das ihre
Anhängerschaft sich nach Westberlin begab, wo man Schokolade kaufen konnte,
falls man Ost- gegen Westgeld eingetauscht hatte.
Ich bin einen langen Weg
gelaufen und kreuzte dann erst die Sektorengrenze. Nach langer Zugfahrt sah ich endlich das
brandneue Gebäude meiner Wahl in Dahlem. Es befand sich in der Nähe des
Missionsbüros in der Hirschsprungallee. Dieses noble Haus kannte ich seit
1946. Traurig und innerlich zerrissen
saß ich dann in der Kapelle unter vielleicht 150 Mitgliedern. Ich hatte
ziemlich weit vorne Platz genommen, wo die beider Damen saßen die als Untersucher
gekommen waren, die kurz vor Beginn, auch von mir wissen wollten, wer Joseph
Smith sei.
Mein
Gesicht für zwei drei Minuten aufgehellt, musste nun wieder meinen Kummer
widerspiegeln. Jedenfalls nickte mir ein amerikanischer Missionar, etwa meines
alters, ausgesucht freundlich und aufmunternd zu. Das tat mir gut. Ich schaute
noch einmal in seine Augen. Ja, er meinte mich.
Es war
das schönste, erhebendste Lächeln, das ich bis dahin auf dem Gesicht eines
männlichen Mitmenschen gesehen hatte, das mir galt. Sicherlich standen mir
meine Selbstvorwürfe der vergangenen Nacht immer noch ins Gesicht geschrieben.
Täuschen
konnte ich nie. In der Sonntagsschule besprachen sie eine Passage aus der
Bergpredigt. Ehrlich gesagt interessierte ich mich viel mehr für mich selbst –
ich sehnte mich danach zu wissen, ob es eine Wahrheit gab, die mich aus meiner
schwierigen Situation endgültig befreien würde.
Ich
erinnerte mich der Kriegstage als ich im Wohnzimmer unserer Flurnachbarin Frau Stolpe
stand. Über dem eisernen, altmodischen Bett ihres dreißigjährigen Sohne Fritz
hing ein Christusgemälde.
Der
forschende Blick Christi, den ihr Ehemann präsentierte, war, wie mir schien,
erfüllt von Mitgefühl für unsere Schwächen und schlecht bestandenen
Prüfungen. Ich dachte an Situationen die
wir ungefestigten Menschen so leichtfertig auf uns zukommen lassen, statt ihnen
beizeiten aus dem Weg zu gehen. Aber. ER weiß um unsere guten wie um unsre
weniger guten Wünsche und Verlangen – insbesondere diejenigen, die unserer
Seele langfristig schaden könnten. Denn, die Seele vergisst nichts. Das ist ja
der Grund warum wir handeln sollten, wie ER uns liebevoll rät.
In
diesem Raum befand sich auch ein Gemälde, das ein Mädchen zeigte, die nackt, in
etwa zwanzig Meter Entfernung vom Maler, auf einem kleinen Felsen stand, der
Seewind blies ihr ins Gesicht, ihre schönen Haare flatterten, sie aber reckte
sich. Damals war ich wohl erst 13, und doch zog mich ihr Anblick schon magisch
an. Die alte Dame sagte: „Es ist ein Symbol für Freiheit!“
Meine Absicht war nicht, zu lauschen, sondern
vielmehr aus unmittelbarer Nähe zuzusehen und zuzuhören, wie zwei Missionare
interessierten anderen Frauen die Erste Vision Joseph Smiths erklärten.
Plötzlich faszinierte mich das Gespräch. Ja, es ist wahr. Joseph wusste, was
wir glauben. Etwas das Menschen wie ich als schön empfanden: Gott der Allmächtige
und sein Messias kümmern sich um unser Glück, das uns nicht in den Schoß fällt,
das erworben und auf ihren Rat hin bewahrt sein will.
Was zählte, war nicht so sehr,
was diese jungen Männer sagten, sondern wie sie die Prinzipien erklärten, die
nur wenigen von Beginn an gefallen. Es gab nicht die geringste Spur von
Fanatismus oder Heuchelei. Auf einfache, anschauliche Weise malten die
Missionare die Szene, in der Joseph niederkniete, wie die Macht des Zerstörers
auf ihn fiel – und dann standen in einer himmlischen Vision zwei Lichtpersönlichkeiten
in der Höhe über ihm.
Einer von ihnen rief Joseph
beim Namen, zeigte auf die Person neben ihm und sagte: „Das ist mein
geliebter Sohn, höre ihn.“ War dies nicht das große Ereignis, nach dem sich
die alten Heiligen gesehnt hatten? Die Lehren Christi wurden nach seinem Tod geändert.
Menschen wurden nun seit Tausenden von Jahren in die Irre geführt. Nicht die
frommen Exerzitien sind es, die Beseligung machen, sondern der zum Guten
angewandte Wille.
Christus versprach, dass er
zurückkehren würde. Dies berichtet die Bibel. Das Erstaunen Joseph Smiths muss
groß gewesen sein!
Mir schien, die beiden
Hörerinnen seien angenehm berührt worden. Falls sie nun zu ihrem Pfarrer
gegangen sein sollten, was zu vermuten ist, wird er so reagiert haben, wie in
tausenden Fällen zuvor andere seiner Amtsgenossen: Um Gottes Willen, die
Mormonen sind eine gefährliche Sekte. „Mormonen sind keine Christen“,
das sind Seelenfänger. Mormonen sind gefährlich, weil sie dies und jenes
glauben. Diese Kirche lehnt die in Nicäa 325 verkündete Lehre vom Dreieinen
Gott ab.“ “Religion Dispatches“ of May 27th, 2011
Ich traf in zahllosen gesuchten
Diskussionen nicht einen Geistlichen der auch nur annähernd erklären konnte,
was das ist, die Trinität.
Damals, 1951, hatte die
Evangelische Kirche Deutschlands noch nicht zugegeben, dass die Lehre vom
Dreieinen Gott in der Bibel nicht vorkommt. Zu diesem Eingeständnis gelangt sie
erst 70 Jahre später. „Die Diskussion um die Trinität begann im vierten
Jahrhundert nach Christus. Sie ist sehr philosophisch geprägt, da die Lehre von
der Trinität in der Bibel nicht explizit vorkommt.“ EKD 2020
„Die Bibel entfaltet keine
Trinitätslehre. Es existiert kein Kapitel in der Heiligen Schrift, das dieses
anscheinend wichtige Thema aufgreifen würde…“ Aleksandar
Vuksanović „Entwicklung der Trinitätslehre in den ersten drei
Jahrhunderten", St. Galler Studientag 2016.
Die Bischöfe zu Nicäa wurden im
Jahr 325, bewusst verleitet eines größenwahnsinnigen Kaisers Fantasiegeschöpf als
ihren Gott anzuerkennen, was schließlich zu Religionskriegen und
Ketzerverbrennungen führte. Konstantins Ansprüchen und Wünschen mussten sich
alle beugen oder in die Verbannung gehen.
Greifswald
Einen Monat später, nach
Abschluss meiner Ausbildung, meldete ich mich zusammen mit Hunderten anderen
Bewerbern beim Berufsbildungsinstitut für Lehrer an. Es wurde
„berufspädagogisches Institut“ genannt. Ich wollte Lehrer in der
Erwachsenenbildung werden. Mir stand vor Augen, mein Wissen in wichtigen
Fächern zu erweitern, um dann meine Einsichten an möglichst zahlreiche zu
vermitteln. Sie sollten, wie ich, nachdenklicher die Frage nach dem Sinn des
Lebens und nach Gott stellen. Ich wusste
längst, dass viele in dieser Sache oberflächlich urteilten. Für das Studium brachte ich die notwendigen
Voraussetzungen mit.
Die Monate vor Weihnachten
vergingen so schnell, als wären sie nur Tage. Obwohl weitaus mehr Zeit
aufgewendet wurde dialektischen Materialismus-Leninismus zu lehren als
Psychologie und Biologie, fühlte ich mich gut. Endlich hatte ich Zeit für
Wissenserwerb, anstatt mich mit Spaten und Rechen auf den Feldern, im Regen
oder Schnee, im Wind und auf steinhartem Boden abmühen zu müssen. Hier am
Institut musste ich nie auch nur einen Finger beugen. Ich habe mich mit Freude in mein Studium
vertieft. Meine Liebe zur Politik und zur Geschichte machten es mir leicht.
Wochentags war ich Student des Marxismus, aber sonntags aktiver Mormone.
Zunächst hatte ich keine Probleme damit.
Im Fach Biologie wurde
Morganismus-Weißmanismus scharf verurteilt, die Lehren von Mitschurin und
Lyssenko dagegen seien wissenschaftlich korrekt.
Lyssenko behauptete kühn und
unredlich, „dass die Eigenschaften von Kulturpflanzen und anderen Organismen
nicht durch Gene,
sondern nur durch Umweltbedingungen bestimmt würden.“ Ich
sage nicht, dass ich damals schon den Schwindel durchschaute. Ein wenig misstrauisch war ich schon.
Lyssenko hat mit seinen Thesen in der Sowjetunion zwischen 1953 bis 1960
schwere Missernten etwa in Kasachstan verursacht. Von Stalin geliebt und
gefördert, meinte er, drei Monate Sommer würden ausreichen Mais zu ernten.
Er lehrte die Pflanzen würden
sich sehr schnell an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Aber genau das
passierte nicht, auch nicht in der vierten Generation. Mais wurzelt tief, schon
bevor die Maiswurzeln auf den Nullgradbereich stießen verkümmerten sie.
In Kasachstan taut der Erdboden
aber nur bis zu einer Tiefe von 40 cm auf. Die Schuld für örtlich gravierenden
Hunger wurde den Bauern zugeschoben die ohnehin nur entsprechend den Weisungen
der Partei agieren durften. Indirekt
sollte bewiesen werden, dass gesellschaftliches Sein das gesellschaftliche
Bewusstsein bestimmt. Angelegt war das Ganze zur Bestätigung anderer Thesen des
„wissenschaftlichen Atheismus“ und damit des „wissenschaftlichen Kommunismus“.
Im Herbst 1951 fanden unsere
Kirchenversammlungen zu Greifswald in einem separaten Raum einer örtlichen
Kneipe statt. Wir kamen zu sechst zusammen. Manchmal waren auch sieben oder
acht Mitglieder anwesend. Es störte mich nicht, dass das Lokal klein und voller
Rauchgerüche war, dass es nach abgestandenem Bier roch. Da viele neue Studenten
in die Stadt zogen, bot ihnen die Universität in Greifswald jedes noch so
kleine Zimmer und Zimmer als Unterkunft an. Infolgedessen verweigerten uns die
örtlichen Behörden die Erlaubnis, einen eigenen Treffpunkt einzurichten, sodass
unsere Gottesdienste in dieser Bar abgehalten wurden, die sonntags für die
Öffentlichkeit geschlossen war. Neben dem Ausschank befand sich der Club- und
Schlafraum für die Studenten, mit denen ich das erste Semester am Institut
verbrachte.
Da es zwischen ihrem und
unserem Zimmer nur eine provisorische Schiebetür gab, konnten sie während
unserer Treffen jedes gesprochene Wort hören. So fanden sie heraus, dass ich,
ihr Mitstudent, ein „Mormonenprediger“ war.
Eines sonntags hielt Bruder Arnold Riemer eine Ansprache. Er war von
Beruf Maler und jetzt Neukonvertit. Er war neben mir der einzige aktive
männliche Erwachsene. Als er zu sprechen begann, hörten wir bald aufmerksam zu.
Zuerst beschrieb er eine Situation, die im Buch Mormon aufgezeichnet ist.
Missionar Ammon kämpfte
kraftvoll gegen marodierende Banditen, wehrte sie effektiv ab und galt aufgrund
seiner ungewöhnlichen Stärke als eine Art Übermensch oder als Inkarnation des
„Großen Geistes“. Als Ammon vor König Lamoni stand – der ebenfalls abergläubisch
auftrat – sagte er einfach: „Ich bin ein (normaler) Mensch; ...der am Anfang
nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Sein Heiliger Geist hat mich berufen,
dieses Volk zu lehren, damit es weiß, was gerecht und wahr ist.“ Alma
18:34. Das war es. Im Zusammenhang mit jeder Art Religion und Politik
kann es nur darum gehen zu erlernen im Umgang mit sich selbst und anderen
gerecht und wahrhaftig zu sein. Das war die ursprüngliche Botschaft, eine
dringende Forderung, seit Apostelzeiten.
Arnold sprach perfekt über die
Grundsätze der Gerechtigkeit. Wie ein Künstler spielte er eine wunderschöne
Melodie auf den Saiten seiner eigenen Seele. Je nachdenklicher ich zuhörte,
desto mehr wollte auch ich Ammon zustimmen, einem Mann, der die Grundsätze der
Tugend vehement verteidigte. Es war einer dieser Vorträge, bei denen Redner und
Publikum Ort und Zeit vergessen. Dieser ungeübte Sprecher hatte eine
unsichtbare Verbindung zwischen uns und einer höheren Welt geschaffen.
Pure Inspiration ließ uns den
Kneipengeruch vergessen. Unsere
bisherige politische Welt der Propagandalügen war nichts anderes als höllische
Realität. Ihr Ziel bestand darin die
Machtausübung einiger weniger zugunsten erbarmungsloser Diktatoren zu festigen.
Mir kamen wieder die verheerenden Fehlurteile der Pastoren Zimmer und Rößle in
den Sinn.
Später, im Dezember 1951, hielt
Karl Kleinschmidt, der berühmte evangelische Domprediger aus Schwerin, ein
angeblich großer Denker und Mitglied der atheistischen Partei SED, eine
Ansprache an uns Studierende und Lehrkräfte. Ich machte es mir auf dem Balkon
des hässlichen Altbaus, Stralsunder Straße 1, gemütlich und hatte einen
perfekten Blick auf Pfarrer Kleinschmidt. Er hielt eine äußerst kontroverse
Rede. So wie ich bislang gelegentlich versucht hatte, Feuer und Wasser zu
mischen, tat er es ebenfalls.
Mit großer Energie vermittelte
Karl Kleinschmidt den Eindruck, er zöge neue Erkenntnisse aus gewissen Quellen.
Wir haben jedoch sehr wohl vernommen, wie es in seinem Kopf rumpelte. Er
erzählte eine Geschichte über einen seiner Pastoralbesuche bei einem 80-jährigen
Mann der freimütig zugab: „Oh je, Sie müssen wissen, Herr Pastor, Sie sind
zum falschen gekommen. Vor mehr als 20 Jahren bin ich aus der
evangelischen Kirche ausgetreten. Ich bin Kommunist!“
„Na dann“, habe er
geantwortet: „in diesem Fall bin ich gekommen, um einen gleichgesinnten
Genossen zu besuchen. Glückwunsch! Du liegst nicht falsch, du bist der richtige
Mann. Ich bin ebenfalls Kommunist“
Mir schien, dass nicht nur mir
die Art und Weise missfiel, mit der sich dieser Vertreter des atheistischen
Staates und der evangelischen Kirche verhielt.
(Kleinschmidt war Leitungsmitglied des atheistischen Deutschen
Kulturbundes)
Das war ein Spagat.
Ich schaute in mich: Gerd,
versuchst du das nicht ebenfalls?
Jemand, aus Reihen der 300
Anwesenden, fragte ihn ob er als moderner Pfarrer damit einverstanden sei, dass
Kleinkinder quasi gegen ihren Willen getauft würden, um so Mitglied einer
speziell ausgerichteten Kirche zu werden.
Da dachte ich: „Hier wird er straucheln!“ Aber zu meiner
Überraschung wies sein breites Gesicht nicht die Spur von Überraschung aus. Er
zögerte keine Sekunde, obwohl jeder die Berechtigung dieser Anschuldigung
erkannt haben müsste. Keck wandte sich der 50-jährige Geistliche an den
Fragesteller: „Genosse“, sagte er, „wenn du heiratest und Kinder
hast, werden sie dann nicht automatisch Bürger deines Staates? Ist das ein
Verstoß gegen den freien Willen?“
Seine kühn-freche Hinweg -
Erklärung wurde, wohl auch wegen ihrer Schlauheit, mit viel Applaus akzeptiert.
Die Mehrheit in diesem Saal musste wissen, dass Pfarrer Kleinschmidt, die
Wahrheit frisierte. Aber, der Druck des Augenblicks wurde auf null reduziert.
Nach dem Vortrag Pastor
Kleinschmidts wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich werde meinen Beifall für
die nächste Lesung, falls sie ebenso windschief daher kommt zurückhalten.
Kurz darauf leitete Dozent
Kirchberg eine Diskussion über Maxim Gorkis Roman „Die Mutter“. Er schloss mit
den Worten: „Aus Verantwortungsbewusstsein und Liebe zur DDR sind wir
verpflichtet, Provokationen zu unterbinden. Wir müssen, wenn die Klassenfeinde
sich quer stellen Widerstand leisten.
Wenn jemand sich als Feind der DDR erweist muss er den staatlichen
Organen ausgeliefert werden!“ Das
hieß im Klartext, zeige jeden Oppositionellen an, auch wenn es dein Vater oder
deine Mutter ist.
Kannte ich das nicht schon, aus
der Nazizeit?
Ich saß, an jenem Tag, unter
den 100 Hörern, in der ersten Reihe. Alle, außer mir, klickten mit ihren
billigen Schuhen oder klatschten. Der elegante 30-jährige Kirchberg starrte
mich an. Er stellte mir sofort die Frage: „Widersprichst du mir?“, zuerst
nur mit den Augen, dann akustisch. Mit seiner kompromisslosen Ideologie
und seiner 1,80 m großen Statur überragte er mich nicht nur körperlich.
Insbesondere alle Frauen auf dem Campus betrachteten ihn als einen der
überlegenen Intellektuellen. Einige Mädchen himmelten ihn an. Seinem ganzen
Wesen nach, schien er nicht der Typ zu sein, der die Peitsche gegen seine
Mitmenschen einsetzte. Bislang nutzte er seinen natürlichen Charme, um
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Seine hoch gezogenen Augenbrauen bedeuteten
mir, ich hätte meine Weigerung, ihm nicht zu applaudieren, zu rechtfertigen.
Es fiel mir nach der Rede
Pastor Kleinschmidts nicht schwer, deutlich Stellung zu beziehen: „Ich halte
es für ungerecht, jemanden nur wegen konträrer Ansichten Strafe anzudrohen.“
Da ich keine Szene machen
wollte, sprach ich allerdings leiser als sonst. Kirchberg antwortete: „Das
ist eine grundsätzliche Frage! Wir tragen Verantwortung für unsere junge
Republik. Wir haben schon genug Feinde! Hier geht es ums Ganze!”
Jetzt brannte es in mir. Ich
würde nicht zurückweichen: „Ein Lump ist ein Lump ob er braun oder rot ist!“
Er war alt genug. Er musste
wissen, dass es Naziart war sonst unschuldige Leute hinter Gitter zu bringen
die sich lediglich dem unredlichen Zeitgeist widersetzten. Er war doch
ebenfalls Zeitzeuge.
Offensichtlich schien
Kirchberg, wegen des Grades der Berechtigung meiner nicht ungefährlichen
Erwiderung, für den Augenblick leicht verunsichert.
Jetzt gab es für beide Seiten
keinen Ausweg.
Natürlich wurden wir
beobachtet.
Meine Mitschüler hatten den
Hörsaal ja noch nicht verlassen. Es musste sich herumgesprochen haben, dass ich
„Mormone“ war.
Aber es gab noch einen zweiten,
Richard Wunderlich, der nie an unseren Treffen teilnahm und der bis dahin in
einem sächsischen Uranbergwerk gutes Geld verdiente.
Beim Abendessen saßen wir
gemeinsam am Tisch, als ein Witz erzählt wurde, der nicht gerade
gesellschaftsfähig war. Ich verließ meinen Platz, Richard blieb dort und lachte
mit den anderen. Er sagte: „Ich bin kein so zimperlicher Mormone wie er!“ Kirchberg musste
vermeiden, im falschen Licht zu erscheinen. Nämlich, dass ich ihn in eine
Diskussion verwickelte, die ihm Unbehagen bereiten könnte. Also sagte er laut
und bewusst unhöflich: „Das Proletariat wird uns fragen: „Wer wen?“ Ich habe den Hintergrund dieser
dummen Frage sehr gut verstanden. Es war die törichte Machtfrage, die alle
moskautreuen Kommunisten denen stellten, die pro- demokratisch dachten.
Ich hatte bis dahin (Dezember
1951) mit zahlreichen Menschen unter vier Augen gesprochen. Da war auch nicht
einer gewesen, der dem derzeitigen kommunistischen Regime rückhaltlos positiv
gegenüberstand. Aber die Wahlen die abgehalten wurden zeigten exakt das
unehrliche Gegenteil.
Wer in weitem Umkreis wusste
nicht, dass in Russland (in der UdSSR) angeblich fast 100 Prozent der
Bevölkerung den Stalinismus liebte, dass aber dort die Angst vor Repressalien
durch die Staatspolizei (GPU, oder NKWD) die Tagesordnung bestimmte. Kirchberg
beendete das Gespräch mit gedämpfter Stimme: „Sicher sind Sie klug genug, um
zu wissen, dass es keinen Weg zurück in die Vergangenheit gibt.“ Er sah
mich ernst an: „Sie sind gefährlich für die Gesellschaft. Sie haben hier zu
viele Freunde.“ Ich nickte heimlich. Jeder in unserem Institut hegte, wie
ich, seine eigenen Zweifel. Das alles geschah nur drei Tage vor den
Weihnachtsferien.
Wir reisten gemeinsam in die
gleiche Richtung zu unseren Familien.
Wir setzten die Diskussion im
Zug fort.
Beide wussten, dass binnen
kurzer Zeit eine Entscheidung fallen musste. Entweder ich kroch zu Kreuze, oder
ich werde das Institut verlassen.
Hatte Kirchberg jemals über die
Möglichkeit nachgedacht, in die freie westliche Welt zu fliehen. Hatte er nie
Meinungsverschiedenheiten mit seinen Kameraden? Die Flucht war einfach – man
stieg in den Zug, in Berlin aus und lief mehrere Meter. So einfach war das vor
dem Mauerbau (im August 1961):
Als ich
Herrn Kirchberg, nach den kurzen Ferien, meine Entscheidung mitteilte, war er
schockiert. An seinem Gesicht konnte ich erkennen, dass er damit nicht
gerechnet hatte. Sondern eher meinen Gesinnungswechsel. Verärgert bestand er
auf gründliche Neubetrachtung unserer Überzeugungen. Er hatte nämlich
zugegeben, dass ich weder bösartig, noch dumm oder feige sei.
Zu
dieser Zeit war er noch der Überzeugung, dass seine Ideologie jeden redlichen
Bürger gewinnen müsste. Es durfte nicht sein, dass ein kleiner Frommer über
stärkere Argumente verfügte! Außerdem sei ich doch der „geborene Lehrer!“
Wörtlich:
„Ich werde Ihren Rücktritt nicht akzeptieren, bis wir die Angelegenheit weiter
geprüft haben.“ Glaubte er, er könnte mich umdrehen? Meinte er wirklich er sei imstande „religiösen
Unsinn“, wie er es nannte, zu beseitigen? Ich nahm sein Angebot für weitere
Gespräche an – und auch das überraschte ihn.
Kirchberg
sowie der Direktor, Herr Roderich Schmidt und ich trafen uns sodann 5 Abende im
Stalinzimmer, in den Räumlichkeiten des Greifswalder Instituts, Marktplatz 1.
Hin und wieder kam Stanke, der Parteisekretär, hinzu. Die Idee, dass ich das
Institut aus ihnen unverständlichen Gründen verlasse, gefiel auch anderen
Lektoren nicht. Sie erwiesen ihre Entschlossenheit, meinen Glauben an Gott zu
erschüttern. Ihre scharfen Argumente gingen hin und her.
Ich
hatte jedoch das Gefühl, dass sie guten Willens seien. Sie bemühten sich, mich
von der verheerenden Rolle zu überzeugen, die das Christentum im Verlaufe der
Geschichte der Menschheit spielte. Damit konnten sie nicht punkten, das wusste
ich besser als sie. Für mich war Religion sowohl Herzensangelegenheit, wie der
Vernunft.
Am
ersten Abend ging es querfeldein. Ich spürte den Hass der Lektoren auf die
Kirchen und ich brachte zum Ausdruck, dass ich „Mormone“ bin, wegen deren
Fehlentwicklung. Es war nicht einfach, diesen Neuanhängern der „Diktatur des
Proletariats“ zu verdeutlichen, dass die Geschichte der christlichen Religion
entgleiste, sobald sich Diktatoren erdreisteten die Führung der noch jungen
Kirche zu übernehmen. Mir war klar, dass Gewalt und das Evangelium Christi
einander ausschließen.
Diktatoren sind immer Todfeinde
des Individualrechts jedermanns, gleichgültig was sie sonst noch vertraten.
Andererseits garantiert Christus uns das Recht auf Entscheidungsfreiheit. Er
ist der Erlöser von allen Zwängen. Berühmt sind seine Worte: „Die Wahrheit
wird euch freimachen.“ Joh. 8: 32
Er bekennt unmissverständlich,
dass ihm die Hände gebunden sind, wenn wir nicht wollen. Matt.
23: 37
Ein typischer Diktator
gegenüber dem freien Glauben war Bischof Damasus von Rom. Im Jahr 366 beschloss
er Papst zu werden. Er stellte die Machtfrage. Sein Amtskollege Ursinus stand ihm
im Wege. Damasus heuerte einen Schlägertrupp an um die Anhängerschaft des
Ursinus zu vernichten. Beides
gelingt ihm. Heute zählt ihn die römische Kirche unglaublicher Weise zu den
legitimen Sukzessoren Christi.
Ich sah es meinen Gesprächspartnern an. Das wussten sie nicht.
„Zu den übelsten Charakteren der Geschichte zählt ein weiterer Bischof der
Kirche: Ambrosius von Mailand.
Er ist ein Kriegshetzer, er
übte seine Macht als Kaiserberater brutal aus. Er verbot jede Religion
innerhalb der Grenzen des riesigen römischen Reiches. Nur die von Damasus von
Rom gebilligte „Kirche“ habe ein Existenzrecht. Griechische Tempel ließ er
schleifen. Juden sagte er den Kampf an.“
Ich sprach ihnen offensichtlich
aus dem Herzen. Ich biss mir jedoch auf die Zunge und verkniff mir zu sagen:
Lenin sei der Geistgenosse dieser beiden Kirchenfürsten. Niemand konnte
leugnen, dass Lenin zum roten Terror aufrief.
Aber ich hatte noch ein
Beispiel: Bischof Otto von Bamberg. Viele Historiker rühmen ihn als Muster der
Sanftmut. 1128 lässt er, mit dem „Recht“ des militärisch stärkeren, den Herovit
Tempel zu Wolgast, meiner Heimatstadt schleifen: „Da gibt es einen
gusseisernen Brunnen. Er steht auf einer Freifläche vor dem Rathaus. Am äußeren
Rand gibt es 8 oder 10 Bilder die an die wichtigsten historischen Ereignisse
der Stadt erinnern.
![]() Eins zeigt, wie das
sogenannte „Christentum“ seit dem 4. Jahrhundert handelte. Bis 1128 glaubten die Bürger dieses alten
Herzogtums an Herovit. Nun mussten sie ihn entgegen ihrer wahren Überzeugung
verleugnen. Das konnte nur Heuchelei hervorrufen.
Eins zeigt, wie das
sogenannte „Christentum“ seit dem 4. Jahrhundert handelte. Bis 1128 glaubten die Bürger dieses alten
Herzogtums an Herovit. Nun mussten sie ihn entgegen ihrer wahren Überzeugung
verleugnen. Das konnte nur Heuchelei hervorrufen.
Links ist ein Soldat mit einem riesigen
Schwert zu sehen, daneben ein Mönch-Priester. Er soll diese Heiden in einem
provisorischen Zelt taufen. Sie stehen nackt in einer riesigen Holzwanne, die
bis zu den Knien mit Wasser gefüllt ist. Sie hatten keine Wahl. Bischof Otto
von Bamberg segnete sie, doch in Wirklichkeit ging es nur um die Sicherung
politischer Interessen der Herzöge Wratislaw und Bogislaw. Es war
Vergewaltigung von Menschen zugunsten der Vorherrschaft zweier Diktatoren.
Russland wurde schon im Jahr eintausend der Wille damaliger Diktatoren
aufgezwungen... Ich will frei in meinen
Entscheidungen sein.“
Wahr ist, diese Männer zu Greifswald, verachteten mich nicht. Im
Gegenteil. Nur Stalin, dessen Büste den Raum dominierte, starrte mich grimmig
an. Der Hauptpunkt den meine Gegenüber nun ins Feld führten bestand in den
Verweisen, dass wir dem Tierreich entstammen. Für einen Schöpfer, wie ihn die
Bibel beschreibt, sei kein Platz. In der Tat, das war der fragwürdige Teil
meiner Weltanschauung. Aber, der entscheidende
Punkt ist die unterschiedliche Definition des Begriffes „Mensch“. Die
allgemeine Vorstellung meint das Sichtbare, - das sterbliche Wesen -
mormonisches und urchristliches Verständnis meint dagegen das Unsichtbare: „Der
Mensch ist Geist.“ Lehre und
Bündnisse 93: 33. Dieser ist nicht das Produkt der Evolution.
Darwinismus ist folglich nur die Hälfte der Geschichte. Tatsache sei,
dass das Buch Mormon durchaus – wenn auch nur indirekt – zwischen Heutemenschen
und voradamitischen unterscheidet. 2. Nephi 9: 21 und Mormon 3: 20
„Ich habe gehört, dass es eine christliche
Splittergruppe Italiens gab, die Bagnolesen. Sie behaupteten, ihre
Schöpfungslehre stamme aus Apostelzeiten, und die sagt: “nachdem Gott das
Weltall schuf, überließ er die Lenkung der Dinge der Natur.“ Henry Charles Lea „Geschichte der Inquisition im Mittelalter Bd. I S.
109
Und es kommt ein Fakt hinzu. Meine Kirche lehrt
mit Blick auf den Schöpfungsakt: „Die Götter wachten über die Dinge die sie
befohlen hatten, bis die Dinge gehorchten.“ Köstliche Perle Abraham 4: 18 Für mich folgt daraus, dass Evolution ein Werkzeug Gottes
war. Seit meinem siebzehnten Lebensjahr wusste ich,
dass die Bibel zwei Schöpfungsberichte kennt, den elohistischen Gen 1:1-2:3 und den jahweistischen Gen 2:4-3:24 Architekt Elohim
schuf alle Dinge zuvor geistig, während Christus (Jahwe, oder Jehova) als
Baumeister wirkte. „Mormonen glauben buchstäblich, dass wir Ebenbilder und
Kinder der ewigen Götter sind. Das deutet Goethe an.“ Roderich Schmidt
fragte sofort ein wenig aufgebracht: „Wo steht das geschrieben?“ Ich verwies auf „Faust“ I, den Missionar
Walter Krause lange Passagen hindurch oft in Privatgesprächen auswendig
zitierte. „Wir stammen aus den Gefilden hoher Ahnen…“ Das liegt doch tief in
uns. Wir sind die Erbauer von Palästen mittels Wissens“. Bienen und andere
Insekten bauen instinktiv was wir bewusst tun. Wer verlieh ihnen diese
Fähigkeit? Immerhin fand ich
gewisse Anerkennung. Umso eifriger bemühten sich meine Gesprächspartner mich
auf ihre Seite zu ziehen.
Möglicherweise waren wir Beteiligte
am Schöpfungsakt.
Allgemein nimmt man an, dass
Zufälle Leben hervorbrachten. Ich halte es für logischer daran zu glauben, dass
alledem ein Plan vorausging. Die Antworten die ich gab, verblüfften.
Der Kern der
Heilslehre der „Mormonen“ lässt sich indessen mit wenigen Worten ausdrücken:
Wir sind ewige, in ihren Entscheidungen freie, auf eigenen Wunsch ins Fleisch
gefallene „Intelligenzen“.
Damals allerdings
verfügte ich noch nicht über die Erkenntnis, dass Origenes (185-254) genau das
lehrte. Er war nachweislich der
Spitzen-Theologe der christlichen Akademie zu Alexandria. Fälschlich werden deren Lehren von
großkirchlichen Theologen immer noch als „Origenismus“ bezeichnet und damit auf
ein Minimum an Glaubwürdigkeit reduziert.
Immerhin
lehrte und beschrieb Origenes (185-254) nebst Hippolytos von Rom, die später
einheitlich von der Mehrheitskirche verworfene Theologie: Der Himmel sei die
Heimat der Seele jedes Menschen derer die zur Familie Adams gehören. Handwörterbuch
für Theologie und Religionswissenschaft 3. Völlig neu bearbeitete Auflage
Vierter Band Kop-O
Ich hatte es 1948 tief in meiner Seele gespürt, dass dauerhaftes
Glück in Unfreiheit nicht gedeiht. Was ich allerdings nicht sagte, war, dass
unser Prophet Joseph lehrte, dass es Satan war, der „gegen Gott rebellierte
und versuchte, die Freiheit des Menschen zu zerstören, die der Herr, Gott, uns
gegeben hatte“. Wir sind dafür verantwortlich, das zu behalten, was wir
bereits (im vorirdischen Leben) erworben haben – das Recht auf
Handlungsfreiheit. Dies ist das Fundament, auf dem die Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage aufgebaut ist.
Als ich 1945 las, wie unverfroren die lutherischen Geistlichen
Zimmer und Rößle behaupteten und geradezu schworen: „„Das Ziel der Mormonen
ist es, alle zu bekehren, um die gesamte Menschheit zu versklaven”, wusste
ich, das ist gelogen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damals, in
Greifswald, hinzugefügt habe: „Euer Staat wurde gemäß der ‚Diktatur einer
Partei‘ errichtet.“ In Wirklichkeit diktierte nicht die Arbeiterklasse,
sondern ein einzelner Mann, und der sitzt im Kreml. Das wäre allzu provokativ
gewesen. Aber, meine Erkenntnis, dass der zu jener Greifswalder Zeit noch
andauernde Koreakrieg Beweis genug war zu sagen: Ziel der kommunistischen
Diktatur ist die atheistische Weltherrschaft. Mir scheint, ich hätte das
angedeutet, denn sie fragten mich: „Du wusstest, dass hier der
Marxismus-Leninismus Basis aller anderen Lehren ist, warum kamst du her? Ich
erwiderte: „Es gibt eine Reihe von Übereinstimmungen. Alle Mitglieder meiner
Kirche glauben an den Fortschritt, wie ihr. Dass die Schätze der Erde niemals
zugunsten von Kapitalisten ausgebeutet werden dürfen. Sie gehören dem Volk. Wir
sind grundsätzlich gegen Ausbeutung Wir sind für eine Weltregierung die
künftige Kriege ausschließt und nicht zuletzt sind war überzeugt, dass Bildung
Krisen lösen kann.“
Jeden Abend hatten sie 2 Stunden Überzeugungsarbeit eingesetzt,
ich aber auch. Schließlich durfte ich ein letztes Wort sagen, bevor sie mich
freiwillig entließen. Mir lag daran noch einmal zu unterstreichen, dass meine
Kirche ungemein stark betont, dass Menschenrechte heilig sind, dass unser
Verständnis jede Religion oder Ideologie ablehnt die Gewaltanwendung (außer in
Kriegszeiten zur Selbstverteidigung) zulässt: Meine Religion lässt sich
vielleicht am Besten mit den Worten Friedrich Schillers beschreiben: „Alle
Menschen werden Brüder, wo Sein (Gottes) Flügel weilt!“
Neuanfang
Am 17. Januar 1952 kam ich im Dorf Cammin an, wo sich für mich
eine neue Tür öffnete. Ich wollte meinem Freund Fischermeister Kurt Meyer
helfen. Er hatte vom Staat rund 180 Hektar Seefläche gepachtet. Wo sollte ich sonst hingehen? Die Kirche
wünschte, dass wir vor Ort helfen sollen Zion zu errichten. Eine Flucht in den
Westen schloss ich also aus. Kurt – der wie seine Frau Helga treue Mitglieder
waren - sagte zu, mir tausend Quadratmeter Land zu übergeben um den Start zur
Bildung einer kleinen Baumschule zu ermöglichen, im Gegenzug sollte ich ihm
unentgeltlich helfen. Meinen Schlafplatz sollte ich im ausgebauten Dachboden
des kleinen Meyer-Hauses finden, das malerisch an einem großen See gelegen war.
Aber, es wartete bereits das nächste Problem auf mich. In unmittelbarer
Nachbarschaft gab es eine sehr freundliche Dame...
In den folgenden Wochen ernteten wir Rohr auf
den zugefrorenen Seen.
Ich schob ein Schneidegerät vor
mich her, das die Stängel absäbelte.
Am frühen Morgen glitzerte in den ersten
Sonnenstrahlen ein dicker weißer Reif auf den Spitzen des schlanken
Schilfrohrs. Als wir unter strahlend blauem Himmel unserer Arbeit nachgingen,
fielen mir die Eisflocken ins Gesicht, aber ich war glücklich. Als Belohnung
für meine damalige Arbeit erhielt ich eine kostenlose Unterkunft, sowie
herzhafte Mahlzeiten.
So wurde ich Teil der Familie
Meyer. Nur wenige Wochen später erhielt ich Post von meinen Freunden im
Institut. Sie schrieben: Direktor Roderich Schmidt, der „Superkommunist“, sei
verhaftet worden. Er hatte Stipendiengelder unterschlagen, um eine seiner
Schülerinnen zu gewinnen, die jedoch die Geliebte des Parteisekretärs gewesen
sei...
Einen Monat später kam die
Nachricht, dass die Lehrerausbildungsstätte – das berufspädagogische Institut -
geschlossen wurde.
Gegen Ende Februar tat die
Sonne ihr Bestes. Sie weichte das Eis auf unseren kleinen Seen. Insbesondere in
Ufernähe, brachte sie es zum Schmelzen. Auf dem Teschendorfer See lagen noch
mehr als 400 Bündel Schilf. Kurt indessen musste einen Termin beim Zahnarzt in
der Stadt einhalten, und er sollte und wollte danach noch kranke Freunde
besuchen. Er bat mich, die Schilfbündel zu retten. Beschäftigt mit dieser
Aufgabe, zerbrach das Eis immer wieder und ich befand mich dann knietief im
eisigen Wasser. Obwohl es nicht lebensbedrohlich war, war es sehr unangenehm.
Ich war dankbar für den Schutz, den meine Gummistiefel boten. Mein Bemühen
verlief sehr langsam. Gegen 17 Uhr begann es dunkel zu werden und es lagen
immer noch viele Bündel auf dem Eis. Denn bis zur Straße, von der ein
Weitertransport möglich war lagen fast zweihundert Meter Weg vor mir. Entschlossen, sämtliche Bündel zu retten
arbeitete ich daher weiter in der Dunkelheit, bis ich meine Arbeit endlich
erledigt hatte. Ich beschloss, nicht über den See nach Hause zu gehen, obwohl
einsetzender Frost das Eis wieder härtete.
Ich kam zu dem Schluss, dass
ich den sehr viel längeren Weg um den See herum nehmen sollte. Gut gelaunt trat
ich meinen 3 km langen Marsch zurück nach Hause an. Über mir malten die Sterne
ein Bild der Schönheit und erinnerten mich daran, woher ich gekommen war und
wohin ich einmal zurückkehren wollte. Es machte mir nichts aus, dass ich
teilweise bis auf die Knochen durchnässt daher marschierte. Die Bewegung wärmte
mich. Der Gedanke, dass ich zumindest sowohl in meinem Herzen, wie in meinem
Kopf frei war, machte mich immer wieder glücklich. Als ich durch die letzte Tür
eintrat, sah mich Helga, die Dame des Hauses, an, als wäre sie schockiert. Sie konnte die Tränen nicht verbergen. Sie
stotterte: „Gerd! Und ich dachte, du wärst ertrunken.“
Aber, was ich erst später
erfuhr, unsere Nachbarin bangte an jenem Abend ebenfalls um mein Leben. Hinter
den Gardinen hätte sie gewartet.
Der Nachtfrost kehrte zurück.
Kurt und ich konnten das restliche Schilf auf anderen Seen ernten.
Ich grub, sobald der Boden
aufgetaut war, mit meinem Spaten täglich mehr als hundert qm um. Und im März
reiste ich in die Stadt, um die Vorräte zu kaufen, die ich für den Beginn
meines kleinen Abenteuers brauchte. Von einer nahen gelegenen Baumschule ließ
ich mir zuvor 1500 Rosenwildlinge, 1 000 Mahaleb (Unterlagen für Sauerkirchen
sowie 1000 Apfelwildlinge des Typs 9 zuschicken.
Im Abteil des Zuges, das ich
öffnete saß unsere freundliche Nachbarin. Mir schien sie sei bekümmert. Ihr
gefiel, dass ich mit ihr, einige Minuten, harmlos plauderte. „Sie sind ein
Schatz!“ sagte sie und fuhr weiter.
An diesem Reisenachmittag kam
ich zurück, ging in den kleinen Warteraum, der auch als örtliche Kneipe und als
geselliger Treffpunkt für die Männer des Dorfes diente. Das sollte schwerste
Folgen nach sich ziehen. Ich kann mich nur an ein paar hin und her fliegende
Worte erinnern, weil es mich damals nicht interessierte. Außerdem wurde
disharmonisch gesungen.
Bald darauf erfuhr ich, dass
der Bürgermeister unseres Dorfes – Herbert Schindler – verhaftet wurde. Ein
Mann in seinen Dreißigern, der seines Charakters wegen, allgemein hochgeschätzt
wurde.
Eine Woche verging und
Schindler war immer noch nicht zurückgekehrt. „Gerd, der Bürgermeister ist
nicht zurück“, murmelte Helga, „die Bauern vor Ort verdächtigen dich.“ Da
ich mir keines Fehlverhaltens bewusst war, vergaß ich unser Gespräch in der
Küche und wandte meine Aufmerksamkeit der Arbeit des Tages zu. Am Ende dieser Woche der
allgemeinen Angst um Herbert Schíndler, spazierte ich auf dem Heimweg vom
Dorfkino durch den Park hinter dem alten Schloss. Aus der Dunkelheit tauchten drei
schwarze Silhouetten von Männern auf, die schnell auf mich zukamen. Meine Augen
hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt und ich erkannte Neumann und Schulz, den
Dritten nicht, kräftige Gestalten: „Du warst es!“
"Verräter! Mit den Frauen
anderer Leute herum poussieren!“
„...Wir werden dich ersäufen.“
In der Tat, das schwarze Wasser
des Camminer Sees war nur zehn Meter von uns entfernt. Es blieb mir nur noch
eines zu tun. Ich musste ihrem Sinn für Gerechtigkeit vertrauen. Ich musste die
angetrunkenen Männer beruhigen. Was die Vorwürfe gegen mich bezüglich der
Ehefrauen anderer Männer und der Verhaftung des Bürgermeisters angeht, hatte
ich wirklich keine Ahnung, außer dass ich ein Stück Kuchen von einer der Frauen
des Dorfes erhalten hatte und mich dafür bedankte.
Da ich ruhig blieb, statt zu
zittern, beruhigten sich auch die Männer vorübergehend.
„Na ja“,
polterte Neubauer Neumann in höhnischem Ton „wir werden es schon
herausfinden… Alles wegen eines Liedes... Du hast das Geld gebraucht, nicht
wahr? …Die Stasi hat dich belohnt… 60 Mark – Judas‘ Lohn.“
Die geisterhaften Schatten rückten
näher und ich befand mich, wie eine Fliege, im Spinnennetz. In einem Eid
vereint hielten sie mir ihre Fäuste unter die Nase. Es stimmte definitiv, dass
ich so arm war wie eine Kirchenmaus. Geriet ich vielleicht unter Verdacht, weil
ich nie in ihre örtliche Bar ging? Neumann, der mir wirklich gefährlich
erscheinende, stattliche Mann, dessen Sohn zu seinem Stolz Literaturgeschichte
studierte hatte mehrere Versuche unternommen, Helga, Kurt Meyers Frau, zu
umgarnen. Aber sie hätte ihn immer abgewiesen. Das hörte ich von Kurt.
Ich
wusste auch: Neumann hasste mich vom ersten Tag an. Regelmäßig kam er abends an
den See, um Fässer zu füllen, die er im Winter und Sommer auf einem Schlitten
transportierte, um sein Vieh zu tränken. An jenem Kinoabend ließ er mich seine
Überlegenheit spüren, indem er sich demonstrativ streckte und auf mich herab
sah Er gab mir das Gefühl, ich wäre nichts als ein bettelarmer Bösewicht. Plötzlich
drehten sie mir den Rücken zu und stolzierten davon. Mehrere Tage hindurch
musste Herbert Schindler polizeiliche Verhöre über sich ergehen lassen. Er kam
zurück, als wäre nichts passiert.
Er
wirkte wieder locker, wie immer. Ich musst ihn sprechen. Im total verwahrlosten
Schloss befand sich sein kleines Büro. Er bot mir einen Stuhl an. Mit
unsicheren Händen zündete er sich eine Zigarette an und begann dann frei zu
reden. Zunächst entlastete er mich: „Ich weiß, wer mich bei der Stasi
anzeigte. Du warst es nicht. Ich habe es schon gewissen Leuten
mitgeteilt.“ Er gestand, dass es von
seiner Seite als Bürgermeister und wichtigsten Mann seines Dorfes dumm gewesen
sei, an einem öffentlichen Ort ein natürlich verbotenes, altes deutsches
Kriegslied zu singen: „Wir fliegen gegen England, Bomben auf England …“ –
„Bomben über dem Land der Engel“. Er sei betrunken gewesen.
Sein
Song war und blieb jedoch eine Verehrung des Faschismus und ein Lob auf den
Krieg. Die Strafe für solches Verbrechen betrug nach dem kommunistischen
„Gesetz zum Schutz des Friedens“ fünf Jahre Gefängnis. Als ich an jenem für ihn
folgenreichen Nachmittag meinen Kopf kurz ins Wartezimmer des kleinen Bahnhofes
steckte, bestand die Möglichkeit, dass ich ihn bewusst belauscht haben könnte.
Aber
daran konnte ich mich nicht erinnern.
Dann
schaute er mir direkt ins Gesicht. Er sagte was ich bereits wusste: „Die
Männer in diesem Dorf mögen dich und Kurt nicht!“ Verklausuliert sagte er: Ihr
macht euch mit eurer Religion zu Außenseitern.
Mir war
klar warum die Inquisitoren Herbert ungeschoren entließen. Hätte er gesungen
„Bomben auf Moskau“, er wäre jahrelang hinter Gittern verschwunden und ich
wäre verloren gewesen. Doch England und Amerika waren Vertreter des
räuberischen Kapitalismus und damit Todfeinde des Kommunismus.
Befriedigt
ging ich meiner harten Arbeit nach.
Am
Abend des 5. April ging ich erschöpft und früh zu Bett. Auf dem Gramelower See
hatte ich Stellnetze vom Vortag gehoben und mehrere große Hechte gefangen,
sowie stattliche Barsche von deren Verkauf ich ein Drittel der Preise erhielt. Das
Schwierige daran war stets der Bootstransport. Ein kleines Geräusch weckte
mich, ungefähr um Mitternacht. Eine Frau schlüpfte durch die kleine Tür. Elise?
Sie näherte sich. Es war unsere Nachbarin, eine vom Leben enttäuschte Frau. Die
Mutter zweier sehr junger Söhne, kam an meine Seite: „Er ist weg!“ Sie
trug einen leichten Morgenmantel, öffnete ihn, als sei ihr zu warm.
Ihr
Mann, ein kleiner, erfolgloser Bauer, verließe sie immer wieder tagelang. "Er
ist kein Unmensch, aber er ist unhöflich zu mir, als wäre ich seine Magd. Er
stellt die verrücktesten Behauptungen auf." Sie wäre für sein Versagen
verantwortlich. Die Schweine würden Rotlauf bekommen und krepieren, und seine
Zuckerrüben wären die kleinsten. Statt ihr Geld zu geben, hätte er Kunstdünger
kaufen müssen. Dann war er wieder großzügig und nun befand er sich wieder
irgendwo in der Ferne. Sie
möchte geliebt werden... Ich fasste zu!
Doch ehe
ich wieder, mich selbst kontrollierend, denken konnte, wurde ich plötzlich von
einer beispiellosen Schwärze überschattet.
Die
dunkelste Nacht war nichts dagegen.
Dieser
Schock saß.
Nie
zuvor und danach vernahm ich ähnliches.
Ich wusste, dass ich ohne diese Erfahrung schweres
Unrecht begangen hätte. Fest stand, es geht immer um die Folgen… Die Seele
vergisst ja nichts.
All
unser Tun geht mit uns. Wie sagte mein Vater: „Was finden die Weiber an dir
kleinem Kerl?“
Fünf
Monate blieb ich vernünftig.
Dann
meldete sich die Natur machtvoll zu Wort. Ich dachte, gegen meine Ideale, wie
die Mehrheit meines alters.
Eines
Septembertages fragte mich Neumann, einer der drei Männer, die mich bedroht
hatten, ob ich daran interessiert wäre, ein paar Mark zu verdienen, indem ich
sein Feld egge. Es war eine Aufgabe, die ich noch nie zuvor übernommen hatte.
Und da ich nun dachte, dass die Herausforderung Spaß machen könnte, stimmte ich
zu. Vielleicht dachte er, er würde mir einen Gefallen tun, um sein früheres
Verhalten wiedergutzumachen. Um mich für
sich zu gewinnen, war er an den See gekommen, wo ich damit beschäftigt war, die
Fischernetze zum Trocknen über lange Stangen aufzuhängen. Er gab mir
Anweisungen, welches seiner Pferde das Beste sei, aber ich wusste nichts über
Pferde. Wie würde ich nun den Unterschied zwischen einem dunkelbraunen Pferd
und einem Rappen erkennen? Jeder im Dorf wusste, dass ein alter Zigeuner ihn
überredet hatte, den Hengst zu kaufen, den ich dann auswählte. Es war ein
gutaussehendes Biest. Und das stand neben drei anderen. Es war nicht der Gaul,
den ich anspannen sollte.
Mir
ging es gut und ich war zufrieden mit mir und meiner Arbeit um 16 Uhr. Ich
hatte noch einen halben Hektar zu bearbeiten.
Allerdings drehte sich mein Gedankenrad leidenschaftlicher als je zuvor.
Elise, an die ich erneut Tage lang zurückgedacht hatte, feierte am nächsten Tag
ihren Geburtstag und ihr Mann soll nach Berlin gereist sein. Es war die „derbe
Liebeslust“, wie Doktor Faustus sie nach Goethes Tragödie nannte. Jetzt wollte
ich eine heimliche Ehe führen – wenn auch nur eine kurzlebige.
Ich
dachte ungeniert über Details nach. Alle aufkommenden Bedenken schob ich von
mir. Ich hatte mich entschieden. Diesmal
werde ich zum ersten Mal in meinem Leben vorsätzlich Böses begehen.
Mit diesen Gedanken im Hinterkopf folgte ich
dem kraftvollen Hengst, wie er die fast 4 Meter breite Egge mühelos über das
gepflügte Feld zog. Gerade als ich den Schlusspunkt hinter meine Entscheidung setzte,
fielen mir die viel zu langen Zügel aus der Hand. Ich hatte sie zu kurz und
nicht fest genug gehalten. Ich bückte mich sofort, um sie aufzuheben, aber das
nervöse Pferd rastete aus und der Huf seines Hinterbeins landete in meinem
Gesicht. Ich wusste noch nicht, dass mein Wangenknochen gebrochen war. Ich flog durch die Luft. Es war erstaunlich,
dass ich nicht das Bewusstsein verlor, sondern mich auf Händen und Knien auf
der weichen braunen Erde wiederfand, während Blut aus meinem Mund und meiner
Nase tropfte. Mir kam sofort der Gedanke: „Schädelbasisbruch.“ Der
zweite Gedanke war: „Das geschieht dir recht. Lieber Gott, vor Jahren bat ich: sollte ich jemals vorhaben, schweres Unrecht
zu tun, bitte halte mich auf, wenn nötig auf die harte Tour!“
Ich
erkannte selbstverständlich nicht das Ausmaß des Schadens. Alles, was ich
spürte, war ein dumpfer Druck, dessen ganze Auswirkung jedoch noch weit weg zu
sein schien. Und meine Gedanken blieben
glasklar.
Ich hoffte, mir würde der große
Schmerz erspart bleiben.
Was mich jedoch am meisten
überraschte, war die Erkenntnis, dass ein so großer, so mächtiger Gott die
Wünsche eines kleinen, gebrechlichen Menschen nicht ignoriert hatte.
Ein Junge, der in der Nähe
Gänse hütete, sah den Unfall. Er stand plötzlich mit offenem Mund vor mir. Zu
meinem eigenen Erstaunen stand ich auf und bat ihn, das Pferd am Kopf zu packen
und zum Stall von Herrn Schulz zu führen. Im Moment musste ich Hilfe für mich
selbst finden. Auch ohne viele Worte hätte der Junge gewusst, was zu tun war.
Ich begann zu marschieren, zunächst tapfer.
Nach etwa 200 Metern hatte ich
noch fast 800 vor mir, bis ich nach Hause kam. Unterwegs traf ich den alten
Knecht eines früheren Großbauern. Ich nannte ihn beim Vornamen und nahm das
Taschentuch ab, das ich an meiner rechten Kopfseite hielt, und fragte ihn: „Wie
sieht das aus?“
Er sank zu Boden wie ein Baum
der gefällt worden war.
Ich hatte ja keine Ahnung, dass
mein rechtes Auge aus der Höhle hing, groß und rot wie eine reife Tomate. Meine
Verletzungen boten also einen beängstigenden Anblick. Warum sollte ein so
kraftvoller Mann sonst in Ohnmacht fallen? Als er Sekunden danach wieder zu
Bewusstsein kam, sagte er kein einziges Wort. Er rannte davon. Als ich das Haus
betrat, warf Helga einen Blick auf mich und wiederholte mehrmals, verwirrt, die
gleiche Anweisung: „Um Gottes Willen! Lege dich daher!“
Sie eilte zum nächsten Telefon
und rief das Krankenhaus an, in dem Erika, ein Mitglied der Kirche, als
leitende Krankenschwester arbeitete.
Als Helga völlig außer Atem
zurückkam, versuchte sie ihr Bestes, mich zu trösten. Ich brauchte ihre
Beruhigung nicht wirklich. Die Betäubung hielt an. Während sie mich wusch, und
meinen Kopf streichelte sagte sie: „Ich hatte letzte Nacht einen Traum. Oh,
oh! - Aber es wird nicht tödlich sein. Es wird nicht tödlich sein!“ Ich antwortete ihr nicht. Eine halbe Stunde verging und wir erhielten
die Nachricht, dass Erika und der Krankenwagen im Nachbarort Godenswege
angekommen waren, wo die Straße endete ... Erika ließ mitteilen: der Weg
nach Cammin sei unpassierbar, „der Fahrer hat Angst, dass wir im Schlamm
stecken bleiben. Bitte findet Pferd und Wagen, um ihn hierher zu bringen.“ Bald
darauf legten sie mich auf einen Karren mit losem Stroh und transportierten
mich über die Hügel und Unebenheiten des offenen Feldwegs. Über mir spielte der
Herbstwind in den riesigen Kronen der Ulmen. Ich schien ein erweitertes
Bewusstsein für alles um mich herum zu haben. Ich sehnte mich nach
medizinischer Hilfe und Schutz und befürchtete nun, dass die Hölle jeden Moment
Realität werden könnte. Zu meiner Erleichterung traf nach wenigen Minuten der
Krankenwagen und Krankenschwester Erika ein, die nicht aufgehört hatte, den
Fahrer davon zu überzeugen, das Risiko einzugehen, uns zu finden.
Erika saß dann schweigend und
blass, wie mir schien, neben mir, hielt meine Hand, fühlte meinen Puls und gab
mir dann eine Spritze. Ich kannte sie schon seit Jahren. Sie war eine sehr
große, schöne Mormonin, die auf ihrer eigenen Suche nach der Wahrheit zur
Kirche konvertierte – ich hatte sie immer gemocht. Der einzige Nachteil, den
ich fand, war, dass ich mindestens 10 Zentimeter kleiner als sie war. Im
Krankenhaus angekommen, legten sie mich auf eine Trage, die sich kühl anfühlte.
Mehrere Ärzte standen um mich herum und schüttelten den Kopf. „Wir können
nichts tun!“ Die anderen waren überrascht wegen meiner Seelenruhe und den
Frieden, der mich zu umgeben schien
Allerdings wusste ich, woher es
kam. Ich hatte die Prügel als Strafe akzeptiert, und in gewisser Weise machte
es mich glücklich. Hätte ich rebelliert, wäre ich von einem Schock zum nächsten
gerutscht. Mein Schlaf war tief, drei Nächte lang schlief ich in den sanften
Armen von „Morpheus“. Aber am vierten Tag hatte ich das Gefühl, als würde ein
Pendel an derselben Stelle in meinem Kopf auf eine riesige Glocke schlagen.
Ich dachte, ich würde definitiv
verrückt werden, wünschte und bat inständig um weitere Opium-Injektionen. Der
Schmerz raubte mir jeden weiteren Gedanken.
“Nein!“
Gegen Mitternacht bekam ich
Besuch vom renommierten Chirurgen, Dr. Kloesel. Ich versuchte sehr, mich zu
beherrschen und hörte auf zu betteln. Er plauderte mit monotoner Stimme mit der
Nachtschwester. Ich konnte nicht anders als zuzuhören und fiel darüber in einen
tiefen Schlaf, aus dem ich am nächsten Morgen nahezu schmerzfrei aufwachte.
Am Abend kam Erika zu Besuch
und ich fragte sie: „Wie sehe ich aus?“ Sie sprach leise: „Dein Auge ist
fast wieder in seiner Augenhöhle.“ Sie war immer noch besorgt und kam jeden
Abend, der folgenden Woche nach ihrer Schicht, um eine Stunde mit mir zu
verbringen. Der
alte Militärarzt, Doktor Buhts sagte ihr, dass er in 8 Jahren Militärdienst in
zwei Weltkriegen so etwas noch nie gesehen hätte. „Wie kann ein Auge durch
innere Blutungen doppelt so groß werden? Man muss meinen, dass es in diesem
Zustand platzen würde.“
Jetzt verstand ich den alten
Traktorfahrer, ich sah aus wie der Glöckner von Notre Dame. Ich musste lachen –
er hatte etwas wie aus einem Horrorfilm gesehen.
Ich erinnerte mich, als sie nun
allabendlich neben mir saß, an das Jahr 1948 und die seltsamen Gefühle, die
meine Seele damals erfassten.
Nach einer Konferenz wurden wir
zu einer Seefahrt, von Warnemünde aus, eingeladen. Sie stand an jenem Tag nahe
mir, an der Reling des Dampfers und schaute auf das bewegte Wasser der Ostsee.
Wir empfanden wohl beide dasselbe: Schade!
Am nächst folgenden Silvester
wollten die Wolgaster mit einigen anderen HLT-Jugendlichen in Neubrandenburg
gemeinsam feiern. Mein Freund Ulrich Chust und ich sind – weil wir nicht genug
Geld hatten – nach Neubrandenburg gelaufen.
Natürlich war dieses
bescheidene Treffen nicht zu vergleichen mit dem großen Tanz- und Spielfest im
großen Mormonensaal zu Cottbus, das ich aus demselben Grund 1946 besuchte. Jene
Mitglieder hatten diese Veranstaltung mit viel Engagement, Ideen und Charakter
vorbereitet. Aber auch die kleine Party
im Jahr 1948/49 hatte ihren Reiz. Am späten Nachmittag begleiteten uns die 4
Mädels aus Neubrandenburg zum Bahnhof, der uns entlang der 150 km langen
Bahnstrecke zurück nach Wolgast bringen sollte.
Allerdings war die Wanderung,
die wir – querfeldein unternahmen, nur halb so lang. Erika trug einen
beige-braunen Mantel und ich fühlte mich in ihrer Nähe wohl. Das war so. Damals
mussten wir Bahntickets kaufen, bevor wir den Bahnsteig betreten durften.
In einer Holzkiste stand ein
Schaffner. Er lochte unsere 20-Pfennig-Tickets. Weil Erika so groß war, gab ich
ihr zwei. Wir hatten Spaß, lachten und lächelten uns an. Wortlos wussten wir
damals, dass wir einander mehr bedeuteten, als wir jemals zum Ausdruck bringen
würden.
Jetzt, 4 Jahre später, schaute
ich sie liebevoll an, obwohl sich die Camminer Bäuerin noch in meinem Kopf
befand. Ich habe also bestimmte einander ausschließende Bilder gleichzeitig
gesehen. Wenn Erika gewusst hätte, was nachts noch in meinem Kopf und vor erst
wenigen Monaten in meinem kleinen Zimmer vorging, hätte sie mich wahrscheinlich
nicht mit ihren Besuchen verwöhnt.
Nun, das war ich. Meine
damalige Absicht war es gewesen, eine Ehe völlig zu ruinieren. Andererseits wusste ich, dass ich Erika
immer mochte. Ich hatte jedoch nie ernsthaft darüber nachgedacht, sie zu
heiraten. Dennoch: ihr Gesicht mit diesem besonderen Ausdruck strahlte das
Licht einer reinen Seele aus.
Ich habe sie einfach bewundert
und geschwiegen. So seltsam es auch schien, in den Wochen, nachdem ich nach
Cammin zurückkehrte, war das Gefühl vorhanden, dass Erika trotz unseres
Größenunterschieds die Mutter meiner Kinder sein würde. Es gab Zeiten mit dem Gedanken
sie schon seit einer Ewigkeit zu kennen. Immer wenn ich an die Silvesterparty
dachte, kehrten diese Vorstellung zurück.
Vier Monate später schrieb ich
ihr und fragte ob sie einen Mann wie mich heiraten würde.
Natürlich habe ich das ziemlich
förmlich formuliert, wie es damals für einen gebildeten Deutschen üblich war.
Ihr "Ja" kam prompt.
Als
dies bekannt wurde, erhielt sie Warnungen aus unterschiedlichen Kreisen: „Heirate
diesen Kerl nicht – er ist ein Charmeur“, „Er ist eine verkrachte Existenz“,
„Schau dir nur seine Vergangenheit an.“
Erika
weigerte sich, diesen Leuten zu glauben.
Aber
was nun?
Ich
hatte zwar über 800 Mark erspart indem ich Versicherungspolicen einsammelte,
doch die Hälfte dieses Betrages verlor ich umgehend, wegen Verlust einer großen
Rechnung. Der Betrag konnte nicht eingezogen werden und ich haftete dafür,
gegenüber der Versicherungsgesellschaft So verlor ich 500. Vom Rest musste ich
einen Anzug kaufen, um auf dem Standesamt angemessen gekleidet zu sein.
Es
stand die große Frage im Raum: Wo könnten wir wohnen? Auf keinen Fall in Cammin. Aber
in Neubrandenburg bestand Wohnraumknappheit. Rotarmisten hatten noch in den
letzten Tagen weite Teile der Innenstadt niedergebrannt. Während des Krieges
lebten dort 25 000 Menschen, nun infolge des Zuzugs von 20 000 Flüchtlingen die
im Osten alles verloren hatten, lebten die Menschen zusammengepfercht.
Neubauten
entstanden nicht, oder nur wenn jemand genug über Geld verfügte um eigenständig
ein Haus zu errichten. Nur Handwerker, wie Klempner oder Dachdecker konnten
Summen um 40 000 Mark aufbringen.
Dennoch
setzten wir den 3. Juli 53 als Hochzeitstag fest.
Kurz zuvor
wurde Erika, wegen ihres aktuellen Gesundheitszustandes, untersucht. Das
vernichtende Urteil der Ärzte lautete Endokarditis lenta! Ob es wirklich die
damals noch unheilbare Form der Herzinnenhautentzündung war? Immerhin wurde
diese Diagnose jedoch von anderen Ärzten in Frage gestellt. Wie auch immer.
Sie dürfte
nicht heiraten. Würde sie schwanger wäre das ihr sicherer Tod.
Sie gab
mir ihr Versprechen zurück. Als Erika mir das mitteilte saßen wir im kleinen
Versammlungsraum unserer Kirche beieinander.
Ich
nahm es nicht an, wollte glauben, dass ihr die Ehe gut tun wird. Neuvermählte
mussten allerdings generell getrennt leben. Jahrelang. Wäre da nicht eine Dame
gewesen, die Erikas Lage erkannte… eine Altkommunistin die Erika liebte. Sie
besaß hinlänglich Einfluss im Stadtrat und verschaffte uns, von einem Tag zum
anderen, eine kleine Mansarde. Zweimal zehn Quadratmeter groß, Küche und
Wohnraum. Und mein Vater, wieder genesen, schenkte uns eine Couch. Er würde mir
auch 2 000 Mark geben, für meine dreieinhalb Dienstjahre zu seinen Gunsten.
Wir
konnten die kleine Wohnung noch zwei Tage vor der Eheschließung wirklich
gemütlich einrichten.
Welch
ein Glück.
Zum
Standesamt musste ich in Räuberzivil gehen, da der Schneider meinen
maßgefertigten Anzug erst einen Tag später, statt wie versprochen am Morgen des
3. Juli ausliefern könne. Die Standesbeamtin musterte mich unübersehbar
misstrauisch. Denn, wie sah ich aus? Einem Landstreicher ähnlich, sichtlich
unreifer als die Braut stand ich da. Ich bin ziemlich sicher, dass sie dachte,
diese Ehe hält keinen Monat. Aber sie tat tapfer ihre Pflicht.
Erika
ging dagegen ausgezeichnet gekleidet. Anschließend segnete Walter Krause uns.
Auch er hegte sehr wahrscheinlich insgeheim seine Zweifel. Auf dem
Wohnzimmertisch der Mutter Erikas standen Vasen mit fast einhundert rosaroten
Schnittrosen der Sorte „Comtess Vandal“.
Ich hatte sie ja im Vorjahr veredelt, diese eintausend fünfhundert
Wildlinge, nun stand das ganze Feld in voller Blüte und nebenan gediehen
hunderte Apfel-Okulate. Im Herbst sollten sie verkauft werden.
Die
Räume die wir als unser Heim beziehen durften, waren früher die
Dienstbotenunterkünfte im Dachgeschoss. Unter uns lebten vier hochrangige Staatsbeamte.
Weitere prominente Personen wohnten in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Sie
und wir galten fortan als „Hausgemeinschaft“. Nach kommunistischen Idealen
musste das so sein.
Wegen dieses Umstandes sollte
unmittelbar nach der Hochzeit der erste Schritt, nach Beginn meines neuen
Lebensabschnittes, ins Verhängnis folgen.
Tag X
Eine
Hausgemeinschaftsversammlung wurde wegen des gerade mit Hilfe von Sowjetpanzern
niedergeschlagenen Arbeiteraufstandes zu Berlin anberaumt. Exakt vier Wochen
waren vergangen, nachdem Staatsgewalt den Arbeiterwillen platt walzte. Es gäbe
dringenden Schulungsbedarf. Erika, nichts Gutes ahnend, - denn sie wusste, dass
ich mein Herz auf der Zunge trage, - beschwor mich, in der Zusammenkunft, die
sie schwänzen wollte, den Mund zu halten. Wir konnten uns vorstellen, dass die
hiesigen prominenten Herrschaften die aktuell politisch-kritische, Lage
schönreden würden. Nicht nur in Berlin, in der ganzen DDR hatten die Arbeiter
gestreikt. Sie sollten laut Regierungsbeschluss für weniger Lohn, mehr leisten.
Theoretisch hätte das Arbeiterbegehren Maßstab des Handelns der kommunistischen
Regierung sein müssen, entsprechend der Diktatur eben der Arbeiterschaft. Alles stand Kopf, insbesondere die
Logik. Nach dem Lehrbuch war ein
Arbeiteraufstand im Arbeiter- und Bauernstaat nicht vorgesehen. Die Schuld für
das eigentlich Undenkbare musste dem Klassenfeind zugeschoben werden. Den
Spitzenkommunisten war es wichtig, wieder die Kontrolle über die Massen zu
erlangen. Und das, ganz im Sinne Josef Stalins. Dieser angeblich gütige Vater
aller Erdenbewohner war gerade verstorben. Alle, die zwischen der Beringstraße
und der Elbe lebten, sollten nun erkennbar trauern, obwohl sein tyrannisches
Tun und Lassen offen zutage lag.
Der
Leiter dieses Treffens (zu dem 20 Personen kamen) war Herr Wolf, zuvor Oberst
unter Generalfeldmarschall Paulus, Kommandeur der 6. deutschen Armee in
Stalingrad (Wolf konvertierte während seiner Gefangenschaft zum
Antifaschismus). Er war
clever genug diesen Gesinnungswechsel zu Geld und Rang zu machen. Im besten
Mannesalter stand er einer der Blockparteien vor, der NDPD, die ehemalige
Hitlerfreunde ebenfalls in Richtung Links umdrehen wollte, indem sie
vortäuschte „anders“ als kommunistisch zu sein. Sie sei nationaldemokratisch
orientiert. Wolfs Wirkungsbereich umfasste ein Zehntel des Gesamtstaates. Ihm
diente ein erheblicher Stab ähnlich Gesinnter. Morgens fuhr sein Chauffeur
einen makellosen BMW vor.
Zu dieser Runde gehörte Frau Dr. Edith Ackermann, etwas 35,
unverheiratet, die hinreichend gewitzt war, ihren Vorgänger im Amt des
Bezirksarztes wegen dessen häufiger Trunkenheit zu ersetzen.
Neben
ihr saß die Kreisärztin Frau Dr. Händel. Dann Herr Kreisvorsitzender Tesch, ein
– wie ich glaube, redlicher Mann. Der Bürgermeister eines nahegelegenen Dorfes,
der junge baumlange W. Eichler, ein Mann von bestem Ruf, neben ihm seine
Ehefrau, Kreispionierleiterin, und andere saßen geduldig da. Es ging um die
Reinwaschung hoch Krimineller.
Herr
Guter mit Ehefrau waren ebenfalls gekommen. Er, eine starke Persönlichkeit. Sie
bewohnten ebenfalls eine Luxuswohnung, immerhin amtierte er als Kreissekretär
der SED jener Partei die aus ehemaligen Sozialdemokraten und Altkommunisten
bestand, der niemand widersprechen durfte. Von vorne herein war dieser
Parteien-Zusammenschluss eine trickreich vorbereitete „Heirat“ von überzeugten
Demokraten und super-überzeugten Antidemokraten, die unter Normalbedingungen
auf äußerst wackligen Füßen gestanden hätte. Niemals wäre solche Verbindung
zustande gekommen, wäre da nicht die Allmacht und List gewesen die wirkungsvoll
aus dem Kreml und aus dem Hause des obersten deutschen Diktators Ulbricht kam.
Entgegen
den auf dem Tisch zutage liegenden Fakten stellte Herrn Wolf den
Arbeiteraufstand unverfroren falsch dar, aber eben so, wie die Regierenden es
wünschten. Wahrheit sei doch ohnehin immer relativ. Dabei blieben die
Tatsachenwahrheiten nach Belieben eingesperrt.
Foto DPA
17. Juni 1953
Das
eigentliche Übel bestand aber im Missverhältnis des aufgeblähten
Staatsapparates mit seiner ungeheuren Zahl an Waffenträgern aller Kategorien zu
den Werteschaffenden. 17 Millionen
Menschen lebten in der DDR. Bereits im Sommer 1952 gab es 100.000
"Kasernierte Volkspolizisten" (KVP). Diese heimliche Armee war
bereits mit Panzern, Flugzeugen und Schiffen ausgerüstet worden. Auf je 170
Bürger kam 1 Polizist, der mindestens doppelte so viel verdiente wie ein
Arbeiter. (Und gegen Ende der DDR, 1989, gab es zusätzlich für jeweils 200
Einwohner ein Überwacher bzw. hauptamtlichen Stasimitarbeiter.)
Ich,
der zufällig in der gleichen Gegend wohnte und der einzige, nahezu ohnmächtige Mensch
war, hätte schon in der ersten Minute platzen können. Sie logen einander die
Taschen voll. An einer nicht zufällig vorhandenen Schultafel, malte Exoberst
Wolf ein Schema, das belegen sollte, auf welch angeblich schäbigem Weg die CIA
den Tag X - den Streiktag - vorbereitet hätte.
Erikas
Bitte hielt mich lange fest. Aber dann platzte meine Geduldsfaden.
In
diesem Raum gab es auch nicht eine Seele, die nicht wusste, dass den Arbeitern
bitteres Unrecht zugefügt wurde.
Panzer
aus sowjetischen Wartehallen herbei zu rufen um unbewaffnete Menschen
einzuschüchtern, das war ein Skandal
Ich
protestierte, ich musste: „ihr würdet anders reden, wenn dieser Staat eure
Privilegien einschränken würde!“ Shakespeares Hamlet befand sich hinter
mir: „Sei ehrlich zu dir selbst und daraus folgt wie Tag der Nacht, du
kannst nicht falsch sein gegen irgendwen.“
Mein
Statement war zwar ehrlich, aber angesichts der Situation - frech und
gefährlich, aber dennoch angemessen und notwendig Alle im Raum starrten mich
an. Alle waren hin und hergerissen. Ihr Gewissen wird sich zu Wort gemeldet
haben. Erika wäre bestürzt davongelaufen. Ich wusste, dass ich nicht vom „Teufel
geritten wurde“ und fügte hinzu: „Mit einer Ausnahme: sie glauben selbst nicht was hier behauptet
wurde.“
Ich
konnte es nicht zurücknehmen, ohne mich selbst zu verletzen. Ich konnte es nicht ungeschehen machen.
Ex-Oberst Wolf sah mich stirnrunzelnd an. Dennoch – ich war der einzige
anwesende Arbeiter.
Er
versuchte sofort, instinktiv, die Situation zu retten. Ich hatte immerhin die
Elite der beiden besten Parteien der Welt beleidigt. (Dr. Händel und Dr.
Ackermann waren keine Parteimitglieder, unterstützten aber deren Prinzipien.)
Kreisparteisekretär Guter und seine junge Frau, der Landrat und seine Frau
sowie andere schüttelten nur den Kopf. Insgeheim musste selbst dem
Verbohrtesten klar, sein dass meine Anschuldigung zu Recht bestand. Und sie wussten, dass ich jung verheiratet
war.
Ich
sollte nun den Namen der Person unter den Anwesenden nennen die ich für
unbedingt DDR-loyal hielt, die glauben konnte, dass 1 und 1 gleich 1 ist. So
dumm war ich nicht, darauf zu reagieren. Eine Entschuldigung wurde mir
abverlangt. Aber ich verweigerte das.
Dann
sagte Herr Wolf: „Na ja, Sie sind noch sehr jung!“
Das war
Gutwilligkeit.
Das
wollte ich bedenken. Es war ein Schritt zum Bau einer begehbaren Brücke. Er
schaute mir in die Augen, als wollte er sagen: „Sei vorsichtig! Denke an
deine Frau und ihr Glück!“
Vor mir
sah ich Erika, die Hände flach vor dem Gesicht. Mir war klar meiner Widerrede
musste eine Strafe folgen.
Auch das
akzeptierte ich aus Einsicht. Ich sollte eine Geldsammlung zugunsten der
„Nationalen Front“ organisieren.
Das war sowohl fair wie unzumutbar.
Erika
wartete auf mich“! Stur durfte ich mich nicht aufführen. Eine Sammlung für das
Rote Kreuz wäre mir lieber gewesen.
Erika verschwieg ich die dumme Geschichte.
Aufregen durfte ich sie auf keinen Fall. Und sie wollte glauben ich wäre brav
gewesen, so fragte sie nicht nach.
Als ich
konsequenterweise in den beiden folgenden Abenden Geld einsammelte, wurde ich
verhaftet. Ich hatte von einem Polizeioffizier eine Spende verlangt. „Zeigen
sie mir ihre Lizenz!“
Die
besaß ich nicht, nur einen Sammelschein.
Er
führte mich ab. Im Hauptquartier der „Volkspolizei“ berief ich mich auf den
Auftrag den mir die Ehefrau des Parteisekretärs der SED gab.
Die
Polizeichefs lachten.
Jetzt
konnten sie mich packen: „Du lügst!“
„Ruft
doch Frau Guter an!“
Sie
zögerten zunächst. Beim Ranghöchsten anzurufen war gewagt. Ich saß nahebei und
ihre Stimme war laut genug, dass ich Bruchstücke des kurzen Gesprächs mithörte.
„Lassen sie den Mann laufen!“
Wieder
verriet ich Erika nichts
Doch
ich gelobte mir, mich, ihretwegen fortan zu beherrschen, und mich aus allen
politischen Belangen herauszuhalten.
Es
dauerte nur ein paar Wochen, bis ich wieder in Schwierigkeiten geriet.
Erika
nahm meine Hände, sah mich sehr ernst an und gestand: „Ich bin schwanger.“ Ich
geriet in Angst – meine Schuld. Die
Ärzte des Krankenhauses, in dem sie arbeitete, hatten sie gewarnt: Die Geburt
eines Kindes wäre zu viel für sie. Ihr Herz könnte es nicht ertragen.
Wenn sie schwanger würde,
müsste sie sofort eine Abtreibung vornehmen lassen. Mit naiver
Überzeugungskraft wollte ich sie ermuntern dem Rat der Ärzte zu folgen. Sie schüttelte jedoch entschlossen den Kopf
und fügte dann ruhig hinzu: „Ich bekomme unser Kind!“
Der Frühling und Erikas Zeit
zur Entbindung nahte. Otto Krakow, unser Gemeindepräsident, gab ihr auf meine
Bitte hin einen besonderen Segen. Alles würde gut gehen.
Stunde für Stunde arbeiteten
dieselben Ärzte, die sie vor diesem Ereignis gewarnt hatten, daran, ihr Leben
zu retten. Ich saß im Flur des Krankenhauses. Dann hielt ich es nicht mehr aus
und rannte draußen herum, ging ins Kino. Nur ein paar Sekunden nachdem ich dort
Platz genommen hatte später rannte ich wieder zurück. Vor dem Kreißsaal legte
ich meinen Kopf in meine Hände und betete und flehte: „Bitte, Vater, sie hat
einen Priestertumssegen erhalten. Lass es wahr werden.” Um elf Uhr nachts hörte ich
keine Schreie mehr. Dr. Klösel kam bald darauf zu mir. Er legte seine Hand auf
meine Schulter. Sie hätten ihr Evipan injiziert: „Sie ist durch. Sie haben
einen gesunden Jungen!“- und mit einem Seufzer fügte er an: „Gratulation!“ Ich, erleichtert, den Freudentränen nahe,
fast sprachlos, bedankte mich. Sie hatte die schmale Brücke überquert, die sie
zurück ins Leben führte.
Bewundernd sah ich, am nächsten
Tag meinen Sohn. Wie das klang: Mein Sohn. Ich war selig. Er war so zart und
schön. Erika wählte den Namen Hartmut für ihn.
Sie wurde nach der Geburt nicht
nach Hause entlassen.
Sobald ich nach ungeliebter
Gärtnerarbeit nachmittags konnte, stand ich vor dem Zimmer in dem sie, neben
anderen, neuen Müttern, lag, manchmal sogar mit Hartmut. Direkt neben dem
Fenster stand ein großer Apfelbaum in voller Blüte. Sie hatte gute Sicht auf
dieses Symbol glücklichen Lebens.
Später erzählte sie mir, dass
sie in Gedanken meine Hände festhielt – dass es meine Liebe und meine Gebete
waren, die ihr halfen, eine tiefe, dunkle Schlucht zu durchwandern. Gemeinsam
priesen wir unseren Gott für ihre Genesung, für seine Barmherzigkeit und Liebe,
für Hartmut.
„Wenn du nun nur eine Arbeit
finden würdest die du nicht hasst!“
Gegen Weihnachten 1953, wurde
ich als Gutachter berufen. Ich sollte den Wert einer riesigen, vernachlässigten
Obstplantage einschätzen. Es handelte sich um Tollenseheim. 12 km entfernt von
unserem Wohnplatz. Es erhob sich umgehend die Frage: Ob ich das 10 ha
umfassende Gelände gegen Fest-Entlohnung übernehmen würde. Allerdings besaß ich
zur Betreuung nichts als meine beiden Hände, einen, für diese Aufgabe, zu kleinen
Kopf und eine Handsäge. Wir handelten einen Monatsverdienst von dreihundert
Mark aus. Bislang verdiente ich knapp 200. Erika lobte mich. Zudem verkaufte
ich 500 Rosenbüsche und 600 Apfelbäumchen.
Das war Geld für mehr Möbel, falls wir eine größere Wohnung
bekämen. Wir genossen es Eltern zu sein. Selbstverständlich gaben wir unser
Bestes um die kleine Neubrandenburger Gemeinde zu unterstützen, wir, bzw. ich
versäumten keine der drei wöchentlichen Zusammenkünfte. Mir gefiel die Nähe zu
Bruno Rohloff, damals 65, zu Max Pielmann einem intelligenten Konvertiten des
Jahres 49, Otto Krakow und den anderen. Allesamt hatten sie ein ereignisreiches
und passagenweise unseliges Leben als Gefangene oder Verwundete und Leidende des
Krieges hinter sich. Ottos Knie waren
betroffen,
doch sein Wille erwies sich als
stets optimistisch. Schier
unglaublich war die Geschichte Brunos und doch nicht ungewöhnlich. Ähnlich
erging es zahllosen, deren Eltern und Freunde aus dem Giftbrunnen gewisser
Geistlicher getrunken hatten. Gelernter Buchhändler, schloss Bruno sich 1929,
aus tiefster innerer Überzeugung unserer Kirche an, nachdem er das Buch Mormon
vom ersten bis zum letzten Satz gelesen und kritisch betrachtet hatte. Sogleich
erhoben sich, nach seiner Zuwendung zur Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage, schwere Proteste. Die von kirchlichen "Wahrheitsverkünder"
stammenden Klischees kamen böswillig zum Vorschein. Seine Mutter, Anna
Zabel-Rohloff, lief in heller Aufregung, als sie davon erfuhr, zu ihrem Pfarrer
Wohlgemut in Pasewalk: "Was soll ich tun, mein Sohn hat sich den
Mormonen angeschlossen?"
![]()
Links von Anna, Bruno
Sie versuchte ihr Bestes, und
schrieb: „Lieber Bruno, wie wir soeben (Ende Juli 1929) erfuhren gehörst Du nun
dem Mormonen Klub an, mehr als das, Du willst Dich von ihnen taufen lassen, und
noch mehr, Du wünschst dasselbe für Deine beiden Kinder. Was soll ich davon
denken? Hast Du den Verstand verloren? Wir können uns keineswegs Dein Verhalten
erklären. Welcher Teufel hat Deine Sinne überwältigt, dass Du Dich einer
teuflischen Gesellschaft anschließt? Reicht Dir die lutherische Wahrheit nicht
aus? Willst Du damit sagen, Du hättest keine Kenntnis? Der liebe Gott hat Dir
doch einen normalen Verstand geschenkt. Ich kann aus alledem nur schließen, dass
Du Dich hier in Pasewalk als Heuchler verhalten hast. Du erwartest von Gott
Hilfe und dienst dem Teufel. Aber irre Dich nicht, Gott lässt sich nicht
spotten. Wahrlich Du solltest wissen, dass da geschrieben steht. "Wer die
Seinen nicht versorgt ist ärger denn ein Heide." Hast Du gar keine
Bedenken Deiner Kinder wegen? Du willst Deinen Kindern die Gnade rauben die
ihnen bereits durch die heilige Taufe geschenkt wurde? Mehr als das, willst Du
einen Fluch auf Dich und Deine Familie und Deine Enkel ziehen? ... Bedenke wer
den heiligen Geist empfing und dagegen sündigt kann nicht mehr erlöst
werden.... Denke daran welche Herzschmerzen Du uns verursachst. (tatsächlich
starb Brunos Mutter fünf Monate später am 16. Januar 1930) Was würde
Pastor Wohlgemut dazu sagen, wenn er noch lebte? Wird er nicht am Jüngsten Tag
als Zeuge gegen Dich dastehen? ... verlasse diese Sekte! ... Deine Eltern und Arnold“ 1960 Walter Rohloff, „Tagebuch“ bzw. „Under the
wing of the Almighty” bei Amazon
Mein
Fazit lautete damals bereits: alle trinitarisch orientierten Kirchen und
Gemeinschaften setzen ihre Vollkraft ein um den „Mormonen“ Seitenhiebe zu
versetzen. Ich las damals eine Tolstoi-Biographie. In der sagt der berühmte
russische Graf und Schriftsteller mehrfach, dass er die Lehren und Bräuche der
ROK für Aberglauben hält. Seine Kirche, die Russisch-orthodoxe exkommunizierte ihn
1901, weil er obenan die Existenz eines trinitarischen Gottes nicht anerkennen
konnte. In diesem Zusammenhang fragte ich selbst, warum die Trinitarier sich
nicht scheuen, ihren Trinitarismus als generelles Bekenntnis hochzustellen,
obwohl bekannt ist, dass er der Kirche von heidnischen Kaisern aufgezwungen
wurde. Biblisch ist er nicht. Das wissen
die Theologen sehr wohl, die in seinem Namen erfolgten Verbrechen gehören zu
den schlimmsten der Geschichte.
Wir
hätten ein glücklicheres Leben führen können, gäbe es nicht den, eindeutig von
Moskau geschürten, kalten Krieg. Er nahm an Intensität, wie uns zeitweise
schien, Tag um Tag zu.
Wir
fühlten die Bedrohung des Friedens permanent. Unsere, die DDR- Nachrichten
verfluchten die bösen Amerikaner, die Westnachrichten, die wir mit Erikas
kleinem Radio empfingen, sagten das Gegenteil. Moskau polterte, Washington gab
sich gelassen. Das Ziel der Sowjetpolitik über dem Weißen Haus die Rote Fahne
zu hissen, erschien nicht mehr als illusorisch.
Mich
bedrückte zudem, dass ich meiner neuen Aufgabe nicht gewachsen war. Mehr als
sechshundert hochstämmige, uralte Apfel- und Birnenbäume mussten gefällt oder
radikal gestutzt werden. Die Baumkronen befanden sich bezogen auf die Hälfte
des Bestandes in zweieinhalb Meter Höhe und wiesen eine Breite von sechs Metern
aus. Bienen gab es in weitem Umfeld nicht. Die Ernten würden mager ausfallen.
Schädlingsbekämpfung könnte kostspieliger sein als der zu erwartender Ertrag.
Jeder Apfel müsste mit einem Stangengerät gepflückt werden. Das einst ansehnliche Gewächshaus lag in
Trümmern. Andererseits bestand keine Aussicht einen besseren Job zu bekommen.
Zum
gesamten Areal der Tollenseheimer Obstanlage, das sich über 600 m Länge und 400
Metern Breite erstreckte, gehörte auch die (spätere Schule für Landtechnik),
sowie unfruchtbare Brachflächen.
Tollenseheim selbst war ursprünglich als Superhotel konzipiert.
Beide Teile waren eng miteinander verbunden.
Dort
traf ich auf Herrn Maque, den ehemaligen kommunistischen Kreissekretär von
Neustrelitz. Er amtierte nun als Direktor der Polit-Schule für Kader
Landwirtschaftlicher Genossenschaften (LPG). Ich unterstand ihm nicht und doch
kontrollierte er mein Tun und Nichttun. Er gehörte zum Kreis jener fünf
Menschen, von denen ich annehmen durfte, dass sie das DDR-System
uneingeschränkt liebten – auch weil es ihn schützte und gut entlohnte. Er erwies sich sehr schnell als kalt
berechnender Egoist. Nicht nur die Frauen mochten ihn. Sein gut geschnittenes
Gesicht beeindruckte. Und nicht wenige fielen auf seine Werbungen herein.
Jeder, der ihn nicht näher kannte, sah in ihm eine starke Persönlichkeit.
Gelegentlich
hörte ich seinen Vorträgen ungewollt zu, wenn er in meiner Frühstückspause, im
Nebenraum seine kruden Ansichten laut genug preisgab. Mit Nachdruck betonte er,
dass die Arbeiterklasse des Westens ihrer Verelendung entgegen geht, aber im
Osten wird das Gegenteil der Fall sein.
Für den
Ausbau der künftigen Schul-Gebäude wurden ihm enorme staatliche Fördermittel
gewährt. Letztlich soll diese Einrichtung im Wesentlichen der Indoktrination
des Marxismus-Leninismus dienen. Ende 1954 verfügte er über einen riesigen Finanz-Überschuss,
den er für elementare Vorarbeiten (Aufmaß und Planung) hätte verwenden sollen.
Was er
damit anstellte?
So traf
an einem Dezemberabend des Jahres eine große Ladung Sport- und Ruderboote auf
‚Tollenseheim’ ein Mir schien, dass da ein Irrtum vorliegen musste. Hausmeister
Paul schob mich beiseite. Der Fahrer nickte nur. Nein, die Papiere besagten
eindeutig: Auslieferung an die Bezirks-LPG Schule, Tollenseheim, bei
Neubrandenburg. Wir kratzten uns die Köpfe und zuckten die Achseln. Paul
Schmidt und ich waren Menschen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Er,
eins achtundachtzig, extrovertiert und athletisch gebaut, ich, schmal wie ein
indischer Hungerkünstler. Ich liebte es zu meditieren, Paul war lebensprühender
Akteur. Ich liebte meinen kleinen Sohn, er seinen Hund. Aber über den
Wellenbinder, ein Speedboat, das wir als erstes auf dem großen LKW entdeckten,
wunderten wir uns gemeinsam.
Paul
begab sich ins Haus um Herrn Herbert Maque, den Chef, zu informieren. Ich
fragte mich in der Zwischenzeit, ob unsere noch kleine LPG-Schule sich ein Boot
dieser Klasse leisten konnte, das schätzungsweise dreißigtausend Mark kostete.
Er kam eiligst an.
Herbert
M., ungefähr fünfzigjährig, schritt auf seinen langen dünnen Beinen schnell und
federnd. Von dem Augenblick an, als er sich dem großen Ferntransporter näherte,
hatte der schneidige SED-Genosse Maque vorübergehend keine Augen mehr für die
vorbei flanierenden, jungen Lehrgangsteilnehmerinnen.
Seine
Sinne richteten sich vor allem auf den als Vorderkajütboot ausgestatteten
Flitzer. Wie ein Wiesel rannte er um den LKW herum, schwang sich auf die
Pritsche und mahnte nun auch die anderen zur Hilfe herbeigerufenen Männer: „Vorsicht,
Vorsicht. Seid bloß vorsichtig mit dem Motorboot.” Tatsächlich kümmerte
sich Maque ausschließlich um das teure Luxusboot persönlich. Kaum hatte es
Platz gefunden in seinem wintersicheren Unterstand, wandte er sich wieder
höheren Aufgaben zu, - oder dem was er für lebenswichtig hielt. Etwas, das er
überhaupt nicht verheimlichte.
Die Paddelboote, darunter eine teure Vierer-Gig , wurden einfach
unter einem der alten Apfelbäume gestapelt, so wie man rohes Holz lagert.
Niemand, der ihm auch nur ein paar Minuten lang zugehört hätte, wie er mit
seinem feurigen Temperament die Ausbeuter aller Eigentumskategorien
verurteilte, hätte geglaubt, dass Genosse Maque sich solche Rechtswidrigkeit
gestattete. Auch er bestätigte damit
indirekt die Regel, dass sich die Vernunft der Prinzipienlosen, der
Leidenschaft unterwirft.
Als ich
kurze Zeit später an der zwei Kilometer von Tollenseheim entfernt liegenden
Fernverkehrsstraße F 96 drei etwa 20- jährige Mädchen weinend sah, ahnte ich
etwas. Ich fragte nach, und die Antwort lautete
"Wir
waren ihm nicht zu Willen!"
Direktor Maque schickte sie mit
einer schriftlichen Erklärung, die albern war, in ihre Genossenschaftsbüros
zurück. Es machte ihm offensichtlich nichts aus, Tatsachen zu verdrehen. Er
galt, schon wegen seines Parteiabzeichens als respektabler Mensch.
Paul und mir musste er nicht
weismachen, er benötige den Flitzer für Besorgungen in Neubrandenburg. Mit dem
Lieferwagen „Framo“, der ihm ja zur Verfügung stand, war er allemal schneller.
Selbst wenn Maque das Schnellboot bis zur Tür eines Lebensmittelgeschäfts hätte
vorfahren können, blieb der Benzinverbrauch eines Wasserfahrzeugs pro Kilometer
Fahrt mindestens doppelt, wenn nicht sogar dreimal so hoch. Eindeutig war es
sein Vergnügungsfahrzeug.
Als angeblich ergebener Verteidiger eines Staatssystems, das
sozial gerechter gegenüber seinen Bürgern sein wollte, agierte er verräterisch.
Wie lange kann das gut gehen?
Die acht oder zehn Paddelboote
und die Vierergig lagen noch tagelang draußen.
Einer der sie überragenden Apfelbäume bot aber keinen Schutz, vor zu
erwartenden Unwettern. Die
hohen Baumkronen boten auch keinen Schutz vor fliegenden Pfeilen und rotweißen
Messstäben. Techniker hatten sie in die Garage gestellt und möglicherweise
längst vergessen. Bedenkenlos wog ich, an einem der Arbeitstage zwischen
Weihnachten und Silvester eine der speer-ähnlichen Stangen. Verwegen
schleuderte ich sie, aus der offenen Garage, in der, zwischen zerkrümelten
Briketts, auch der Lieferwagen “Framo” stand,
Mein Stab flog hoch über die
Boote hinweg vielleicht mehr als zwanzig Meter weit. Paul, mit seinen strammen
Muskeln, ein ehemaliger, wider Willen-Waffen SS-ler, übrigens,- und sehr
selbstbewusst, war überzeugt, er würde gewiss doppelt so weit, wie ich Knirps
werfen. Aber schlecht gepackt, noch mieser geworfen. Krachend bohrte sich die
stählerne Stabspitze in den millimeterdünnen Rumpf der aus Mahagoniholz
gefertigten Vierergig. Sie hatte genau so viel Geld gekostet, wie Paul und ich
zusammen in einem halben Jahr verdienten. Der schwere Mess-stab vibrierte noch,
als wir aufgeschreckt hinliefen um dem entsetzlichen Bersten und Brechen des
dünnen Bootsrumpfes ein Ende zu bereiten.
Wir schauten als erstes zum
schräg rechts oben liegenden Fenster des alten Stammhauses, das wie eine Villa
aussah. Weder Herbert Maque noch seine Wirtschaftsleiterin Inge ließen sich
blicken. Sie hatten es also, zum Glück, nicht gehört. Paul, kühn wie immer,
verzog keine Miene seines ohnehin ruhigen, großflächigen Gesichtes. „Schnell!”,
sagte er. Ich half ihm. In meinem Hinterkopf regte sich die Befürchtung,
Paul würde mir die Schuld in die Schuhe schieben. Natürlich wollten wir keinen
Skandal. Gemeinsam schuldbewusst, aber gerissen genug, trugen wir das
irreparabel zerstörte Sportboot gemessenen Schrittes ins nahe liegende
ehemalige Hühnerhaus. Diese Behausung war eine aus morschen Brettern bestehende
ziemlich große Baracke. Schlau gedacht bauten wir sämtliche Paddelboote davor
auf. Wenn es gut ging, kam es nicht heraus, bevor der große Neubau stand und
das konnte noch zwei, wenn nicht drei Jahre dauern. Sollten wir uns irren? Aber
zunächst war da der Gedanke, den wir ebenfalls teilten: Nach uns die Sintflut.
Hingegen sagt ein altes
deutsches Sprichwort: “Nichts ist so fein gesponnen, dass es nicht käme ans
Licht der Sonnen!“
Stegebauer
Für das Vorderkajütboot des
Herrn Maque musste ein Anlegesteg gebaut werden. Hausmeister Paul machte sich
an die Arbeit. Gegen die Grundregel verzichtete er darauf, Leinen zu spannen,
an denen entlang die Pfähle zu rammen wären. Sein Machwerk sah dementsprechend
aus. Eher einem zufällig entstandenen Schrotthaufen ähnlich, als einem Werk von
Menschenhirn und -hand, stand das Unding krumm und windschief da, sogar
gefährlich wacklig. Eine Schande! Als ich auf dem von Paul zusammen
geschusterten Laufsteg entlang ging, wurde mir schlecht. Meine
Mitarbeiterpflicht war, ihm zu sagen, dass er vielleicht ein guter Ehemann und
bestimmt ein hervorragender Hundeliebhaber sei, aber vom Stegebau keine Ahnung
hat. Danach muss er versucht haben, ebenfalls ohne Schnur, die ungleichen
Bretter auf die Verbinder zu nageln. Während ich nun versuchte, meine
kritischen Bemerkungen zu relativieren (wie man heute zu sagen pflegt, wenn man
aus Gründen der Höflichkeit die Wahrheit zu verbiegen beabsichtigt) kam ein
sonderbarer Lehrgangsteilnehmer anspaziert, ein großer, steckendürrer Mann. Von
Gesicht und Gestik wirkte er wie ein Sektenprediger des vergangenen
Jahrhunderts. Er kam uns vor wie einer, der gerade in einen sauren Apfel
gebissen hatte. Für einen Meisterlandwirt hätte ihn wohl niemand gehalten. Der
Mann setzte die großen Schritte ganz bedächtig. Als er die Bescherung sah,
wurde sein langes Gesicht noch länger. Er schlug buchstäblich die Hände über
dem Kopf zusammen und blieb nachdenklich stehen. Soviel Mist auf einem Haufen
hätte er noch nie gesehen. „Abreißen!” Dieser Mann war ein Brigadier!
Kommandieren konnte er schon. „Abreißen?”, fragte Paul, gleich
wutentbrannt. „Rüchtig!”, erwiderte der große Dünne und machte eine
weitere abfällige Bemerkung. Paul zog mich beiseite, zu den Pfählen hin, die
ungeordnet im Gras herumlagen: „Den Kierl schmiet ick int Woter!”
("Den Kerl schmeiße ich ins Wasser!", flüsterte er. Wahrscheinlich
sah Paul selber ein, dass er keine Glanzleistung vollbracht hatte. Nur, er
wusste nicht, wohin mit dem Ärger. Ich
kannte ihn. Dieses Zucken seiner Augenlider verriet das Ausmaß seines mit
Erregung gepaarten Leichtsinns. Hinterhältig fragte er den Bauernbrigadier, ob
der für ihn noch einen guten Rat parat habe. Arglos, die hohe Stirn gefurcht,
erwiderte der etwas schrullige Fremde zustimmend: Am seeseitigen Ende des
Anlegesteges müsste ja sowieso noch der Kopf des Laufsteges gerammt werden. Er,
an Pauls Stelle, würde restlos alles ‚abräumen’ und dann da, in dreißig Meter
Entfernung einen starken Pfahl hinstellen und von ihm ein kräftiges Seil zum
Land spannen und dann... Lebhaft machte der uns beiden so großmäulig
erscheinende Mensch die dazugehörigen Arm- und Handbewegungen. Sogar mich
reizte sein Befehlston. Paul nickte mir vielsagend zu und fragte den Mann, ob
er sich denn auch zutraue, mit ihm und uns aufs Wasser zu fahren, um ihn vor
Ort zu beraten. Schließlich käme es ja auf den Eckpfosten an und den könnte man
gleich in den weichen Seeboden hineinstoßen. Kurioserweise akzeptierte der
Fremde. Warum nicht? Echt treuherzig schaute Paul jetzt drein. Das Mienenspiel
unseres künftigen Opfers drückte dagegen eindeutig seine Hilfsbereitschaft
aus. Und so machte der Ahnungslose mit
seinen Halbschuhen einen eleganten, akkuraten Satz vom Land ins Boot, das sich
immerhin in gut einem Meter Entfernung von ihm befand. Er wankte nur kurz,
setzte sich dann bedächtig auf die kleine Heckbank, zupfte seine Hosennaht
zurecht, zog eine Shagpfeife aus der Hosentasche, stopfte sie aufreizend
langsam mit Tabak, entzündete sie seelenruhig, sog den Qualm in sich, blies ihn
selbstzufrieden in die blaue Frühlingsluft und schaute sich um. Offensichtlich
genoss der ein wenig snobistische Ackerbauer die Aussicht auf die Schönheit der
Landschaft, während er paffte und geduldig der Dinge harrte, die kommen
sollten. Paul hatte indessen den kräftigsten unter den herumliegenden Pfählen
ausgesucht. Er richtete ihn auf. Das war fast ein Mast, dazu knochentrocken und
deshalb nicht zu schwer. Scheinbar fachsimpelnd weihte Paul mich in Details
seines Planes ein. Als hielte er seinen ärgsten Kritiker schon am Genick,
schüttelte Stegebauer Paul den Pfahl, wie man im Herbst einen Pflaumenbaum
rüttelt.
Wir nickten.
Wir meinten bei uns, über dem
zwei Meter tiefen Wasser, wenn wir da denn angelangt wären, würden wir den
Starkpfahl mit Schwung fast einen Meter tief in den weichen Grund
hineindrücken. Paul zog sein flächiges Gesicht schief und kniff sein linkes
Auge zu. Auf Plattdeutsch sagte er "Ich
trete auf den Bord und du auch." Ich war längst mit dem Späßchen
einverstanden und lachte vergnügt. Dieses Bild! „Naja”, dachte ich, „ein
Bad im Freien hat noch niemandem geschadet!” Uns beiden war natürlich klar,
dass das Oberflächenwasser des Tollensesees Anfang April sich trotz tagelanger
Sonneneinstrahlung kaum erwärmt haben konnte. Dafür war der See zu tief. Sobald
man bloß die Hand in seinen Rachen steckte, biss das Wasser noch kräftig zu.
Mit unseren Gummistiefeln durch Wasser und Morast patschend, trugen wir ein
zweites Langholz zum kleinen Ruderboot, schoben es so behutsam, wie es uns möglich
war, zwischen die Schuhe und Beine unseres gemütlich rauchenden Gastes. Sobald
wir uns von Land abgestoßen hatten, schaukelte der Kahn in den Wellen, die
durch das Gelege hindurch wogten. Aber das war ungefährlich, obwohl der
Nordostwind auffrischte. Das Schaukeln des Kahns kam uns wie gerufen. Wir
überaus erfahrenen und eitlen Bootsmänner grinsten einander an. Vor Ort
angekommen nahmen wir den ersten Pfosten, steckten mit ziemlicher Anstrengung
seine spitze Nase ins bewegte Wasser und richteten ihn einigermaßen aus. Wir
hatten noch so viel Zeit uns an unseren Berater zu wenden. „Rüchtig so!”,
bestätigte der kühne Bauer. Das untere Ende unseres Pfahles war vom
Eigengewicht bereits vier, fünf Dezimeter tief in den weichen, tonigen Grund
eingedrungen. Entschlossen spannten wir unsere Muskeln. Paul griff weit nach
oben, allzu weit allerdings. Er wollte die Schwere seiner gut neunzig Kilogramm
zur vollen Geltung bringen. Gleichzeitig sprangen wir auf den schmalen Bord,
des grünrot getünchten Ruderbootes. Jetzt gab es keine Rettung mehr. Jetzt
kippte der lange, aufreizende Kerl samt seiner Shagpfeife über Bord. Jedenfalls
war dies die bunte, auch von mir verinnerlichte Illusion.
Aber, wieso denn ich? Es machte nur Patsch! „Äh und Bäh!”,
schrie ich.
Mehr nicht, und ruderte schon
gewaltig und peitschte das Eiswasser atemringend, das mich in den Hintern und
in den Hals biss, den ich schwanengleich so hoch wie möglich reckte. Dabei
genoss ich eben noch das Plinkern dieser himmelblauen Hausmeisteraugen und die
Vorstellung, wie der andere das erfrischende Bad nimmt. Urplötzlich hatten
meine flatternden Hände äußerst heftig und dennoch sehr vergeblich in die
kühlen Frühlingslüfte hineingegriffen. Gewaltig trieben mich die Urinstinkte
an. Schnell, schnell! An Land, an Land!
Ins Trockene! Mit einem einzigen Blick, während ich noch eisern kraulte, sah
ich Paul. Der klebte noch am Pfahl. Mit seinen Füßen hatte er das Boot
ungewollt weit von sich gestoßen. Vom
Brustkorb abwärts kam ich mir vor wie ein Eisklotz. Dicht unter meinem
Bewusstsein dagegen klapperten meine Zähne wie spanische Kastagnetten. Land
unter Füßen, wandte ich mich sogleich wieder um. Da! Immer noch, wie ein
verstörtes Affenbaby, mit enorm verkürzten Armen und Beinen, klammerte
Exelitesoldat Paul sich verzweifelt an den kräftigen und doch nun so
unverlässlichen Pfahl. Die Wellenspritzer nässten schon seinen Hosenboden, denn
sein Halt neigte und neigte sich, wenn auch ganz langsam. Ich war fasziniert.
Noch zwei Sekunden vielleicht. Länger hielt ihn das Holz nicht über Wasser. Da
tat er einen urigen Schrei. Heftig, wie ein startender Schwan, mit seinen
Schwingen auf das Wasser einschlagend, krächzte er markerschütternd: „Himmel…..
und Wolkenbruch!”
Weiter kam er nicht.
Es verschlug ihm die Luft.
Ein paar hastige Bewegungen
noch, dann hatte auch er den Schilfstreifen erreicht. Mit wilder Kraft richtete
sich der bibbernde Gardesoldat auf. Statt dankbar zu sein, dass sein Herz noch
schlug, schrie er, je weiter er in Sicherheit kam, Unanständiges. Der unschuldige Meisterbauer, für den dieses
Bad bestimmt war, nahm erst jetzt die Pfeife aus dem Mund. Er machte eine
salbungsvolle Geste, bevor er uns Anweisungen gab. Ich hörte es kaum noch und
rannte so schnell ich konnte. Später sagte er: Man muss immer versuchen,
sicher zu stehen oder sich gut am Boot festzuhalten. Wie er. Er klemmte den
Pfeifenstiel zwischen seine roten Lippen, und demonstrierte, wie er sich
verhalten hätte.
Die
Liegewiese
In den
Märztagen 1956 glaubte ich, es sei gut, das Gras auf der so genannten,
eintausend Quadratmeter großen Liegewiese, abzubrennen. Ohne zu bedenken, dass
Feuer im Freien, wenn es trockene Nahrung findet sich auch seitlich und somit,
wenn auch langsam, gegen die Windrichtung ausbreiten kann. Ich entzündete die
Grasfläche mindestens zweihundert Meter weit von der Hühnerstallbaracke
entfernt, in der die demolierte Vierergig, die Ruderbote, und die Kanus
sorgfältig übereinandergestapelt lagen. Allerdings kam vom Flächenbrand
angesaugt, im Handumdrehen mehr Wind auf. In zwei Richtungen breitete sich das
Feuer aus. Das Hauptfeuer lief auf die versteckten Boote zu.
Und
schon züngelten die Flammen in die fünf herrlichen Omorikafichten hinein. Sie
standen direkt vor der für mich so wichtigen Baracke. Wütend auf mich, riss ich die wie Zunder
brennenden Clematis Ranken herunter.
Ich
entdeckte, erschrocken bis ins Mark, dass die Flammen schon unmittelbar an den
dürren Brettern des flachen Hauses leckten. Immer wieder warf ich mich mit
meinen blauen Latzhosen mitten hinein ins knisternde Feuer, bis mir die Luft
ausging. Ich wälzte mich in den Flammen. Von bösen Vorstellungen getrieben,
hörte ich die Gespenster lachen.
So
schnell wie er aufgekommen war, brach der Spuk zusammen. Zwar perlte noch Teer
vom Pappdach, doch er entzündete sich nicht mehr. Mein Kopf sank auf die Brust,
ich atmete tief auf.
Herbert
Maque sah eine halbe Stunde nach dem letzten Aufbäumen des gefährlichen Feuers
die schwarze Wiese und die teilweise angesengten Omorika. Er strich, seine
langen Beine behutsam setzend, um den Hühnerstall herum und hielt den markanten
Kopf wie ein witternder Fuchs. Bemüht, die ärgsten Spuren zu verwischen,
arbeite ich auf dem Gelände eifrig, buddelte ein Loch um die wenigen nur
halbverbrannten Ranken einzugraben und dachte besorgt, jetzt zeigt er dir seine
Zähne. Doch
als Maque näherkam, schaute er mich eine ganze Weile nur vielsagend an, als
wollte er ausdrücken: Jetzt sind wir quitt! Du begingst, wie ich, nur
eine Dummheit, ohne Folgen.
Es war ihm
also nicht einerlei gewesen, dass ich ihn eine Woche zuvor mit einer Dame in
bestimmter Position gesehen hatte, als ich in sein Büro hereingestürmt kam. Das
geschah, weil ich meinte, er hätte mich hereingerufen. Vielleicht wären wir
wirklich quitt gewesen. Doch es gab da die noch nicht entdeckte Gig, und, hätte
ich keine weiteren Fehler begangen.
Denn, mich manchmal nur auf
mein Gefühl verlassend, redete ich bei Gelegenheit mit mir unbekannten Leuten
offen über meine nicht staatskonformen Ansichten. Ich selber hatte in den ersten Nachkriegsmonaten zu viel
gesehen. Verschiedene Exbaltendeutsche und andere Augenzeugen, vor allem
ostpreußische Flüchtlinge, hatten mir zudem entsetzliche Geschichten erzählt,
die allesamt bewiesen, dass nicht wenige Offiziere der Roten Armee, die
Raubgier ihrer Soldaten zuließen.
So erfuhren wir auch mehr und
mehr Einzelheiten, von Ereignissen in Russland, die Ähnliches bewiesen. Wie brutal
nämlich die kommunistische Allmacht mit Oppositionellen umging. Bei mir waren
all diese Berichte gut aufgehoben. Sie bestätigten mich in meiner Ablehnung und
Gesinnung: diese neue Gesellschaftsordnung darf sich nicht durchsetzen. Ich
werde mich ihrer Ideologie widersetzen, wo ich kann. Mitunter war ich deshalb
unvorsichtig und sprach darüber mit Leuten die ich lediglich für
vertrauenswürdig hielt. Hin und wieder hörten wir, dass es Menschen gab, die
unser Vertrauen nicht verdienten. Was hätte ich antworten sollen, wenn mir die
Männer des DDR-Staats-sicherheitsdienstes jemals die Frage gestellt hätten,
warum verbreitest du Antisowjetgeschichten?
Irene
Schulleiter
Maque lud häufig Gastdozenten in sein Haus. Darunter befand sich eine
freundliche, fünfundzwanzigjährige rotblonde Dame, die Vorlesungen im Fach
Philosophie hielt. Sie hieß Irene K., sah gut aus, war ein wenig korpulent und
von ganz und gar offenem Wesen. Sie lachte gerne, aber sie hatte etwas an sich,
das Männer nicht unbedingt mögen. Sie konnte herausfordernd frech blicken.
Maque stellte sie kurze Zeit später als feste Lehrkraft ein.
Am
letzten Apriltag 1956 grub ich, gut dreihundert Meter vom Haus Tollenseheim
entfernt, mit einem Spaten eine Ackerfläche um, die mit Tomatenstauden besetzt
werden sollte. Da sah ich die Philosophiedozentin unerwartet auf mich zukommen.
Selbst wenn ich sie nie gemocht hätte, allein die berechtigte Vermutung, dass
sie ihr graues, gutsitzendes Kostüm für mich angezogen hatte, blieb nicht ohne
Wirkung, denn alle Lehrer und Schüler befanden sich im Kurzurlaub.
Nur sie und mich gab es noch.
Ringsum
standen im Geviert riesige Birnenbäume, die selten oder nie Früchte trugen. Das
Gelände lag unmittelbar am friedlich blinkenden See. Sie lächelte schon von
weitem, als sie den Weg zwischen den gerade grünenden Apfelbäumen herunterkam. „Ich
muss doch mal gucken, was unser Gärtner den ganzen lieben, langen Tag so
treibt.” Ihre helle Stimme vibrierte.
„Ob er überhaupt was zuwege bringt?”,
lachte ich zurück. Sie schaute mich freundlich an, als wollte sie sagen: Einen
Tag vor dem ersten Mai, am Nachmittag, müsse man es nicht übertreiben. Sie lade
mich zu einer Tasse Kaffee ein. Sie möchte mit mir über die biblischen
Paulusbriefe reden. „Es faszinierte mich, dass du sie kennst!” Einmal
hatten wir darüber gesprochen und ich hatte geäußert, die zweitausend Jahre
alten Briefe enthielten noch so manche, für uns interessante Botschaft. „Und welche?”, wollte sie daraufhin wissen. „Dass
wir tun müssen und in die Tat umsetzen, wovon wir überzeugt sind, dass es
richtig ist.”
„Das liest du da heraus?”
„Der Kern der Paulusaussagen
ist keineswegs, was die Protestanten daraus ziehen, sondern eher umgekehrt:
dass der Mensch ernten wird, was er sät.”
Ihre Erwiderung lautete: „Das
klingt ja nicht unvernünftig!” Natürlich war ihr völlig gleichgültig, was
ich mit kritischem Blick auf die Lehre beider Großkirchen meinte. Die Sonne
wärmte uns, während wir plauderten. In einer ihrer nächsten Vorlesungen käme
das Thema Glaube und Wissen vor. „Mach’
Schluss für heute, lass uns oben gemütlich Platz nehmen und darüber reden.”
Ich wollte nicht nein sagen. Sie war so höflich gewesen nicht zu formulieren: Was
du denkst, ist trotz alledem kurios.
In ihrem Zimmer umfing mich
augenblicklich ein Gemisch aus Nelkenduft und dem Geruch von ‚Großer
Freiheit’. Aus der Diskussion über Paulus,
Luther, Bauernkrieg und evangelischer Rechtfertigungslehre wurde natürlich
nichts. Schade! Denn ich verdammte die Ansichten jener schwachsinnigen
Protestanten, die meinten der liebe Gott würde schon alles richten, wenn sie
nur an seinem Namen und ihrem vagen Glauben an ihn festhielten. So jedenfalls,
mit derartigem Selbstbetrug, kann die Welt kein besserer Wohnplatz werden! Aber
eben darum geht es, wird es immer gehen, solange wir uns nicht zum Tierhaften zurückentwickelt
haben. Ich war entschlossen, der klugen
Dame zu sagen, dass die Welt selbstzerstörerischen Charakter hat, weil ihr
Liebe fehlt, jene Liebe die ihre Echtheit durch gewisse Selbstlosigkeit
beweist, denn ich war gewillt mich von ihr nicht, auf Kosten des Lebensglückes
meiner Frau, einwickeln zu lassen. Vielleicht kann man einmal Herzen ersetzen,
die Treue nicht.
Auch aus dem Kaffeetrinken
wurde nichts, denn ich nahm Selterswasser zu mir. Sie saß, die Beine
übereinander geschlagen auf dem Sofa.
Ich glaube, dass ich stocksteif
an ihrem Zimmertisch saß und halb verlegen, halb verwirrt, mit den Fransen
ihrer gehäkelten Decke spielte. Sie sprach über Homers Nymphe Kalypso und in
spöttisch lockendem Ton über Männer wie Odysseus, Calypsos Verehrer. Sie sei
jedenfalls keine ‚schön dumme’ Penelope, die artig daheimsitze und unentwegt
wartend bloß Strümpfe für ihren Mann strickte, während der eine andere bezirze.
Sie nickte, als ich sie anschaute. „Meiner sitzt jetzt irgendwo in Rostock
bei einem Weibsbild herum und spielt den Seelentröster!” Ich werde nicht einen
Augenblick länger hier oben in ihrem Zimmer herumhocken, sondern lieber zu
meiner kleinen Familie zurück radeln. Gerd, du bist nicht der Mann, der
umfällt.
Es ist besser inkonsequent zu
sein, als verräterisch. Ich lenkte,
abschließend, das Gespräch auf meine Ansichten zum Kommunismus. Man kann leicht
von andern verlangen, sich korrekt zu verhalten. Die Dozentin lächelte, aber
nur aus Höflichkeit. Sie schätze Leute, die denken können.
Nicht gerade versteckt war
meine Attacke auf die marxistischen Weltverbesserer, die alles verändern und
verbessern wollten, außer sich selbst. Herbert Maque und diese Frau vor mir,
würden alles tun, um mir zu beweisen, wie gut und schützenswert die DDR und ihr
Sozialismus seien. Gleichzeitig zeigten beide nicht das geringste
Schutzinteresse gegenüber seiner und meiner Frau. Würde ich auch nur kurz
berühren was mir untersagt ist, müsste ich auf mein Recht verzichten, den
Kommunismus vehement abzulehnen. „Die ganze Philosophie nützt nichts, wenn
wir sie einfach so deuten, wie es uns momentan passt!“ Obwohl meine Worte
wenig präzise waren, glaube ich, dass sie verstand, was ich meinte. Frau Irene
sah mich an wie jemand, der über den Rand ihrer Brille schaut.
Sie stimmte mir zu, zumindest
teilweise, wenn auch mit brüchiger Stimme. Ihre Augen blitzten plötzlich vor
Wut, weil ich aufstand. Ich ging davon.
![]() Wenige Tage später saß ich wieder an dieser,
im Tollenseheim, nach Nordwesten gerichteten, großen Fensterwand und schaute sehnsüchtig
Wenige Tage später saß ich wieder an dieser,
im Tollenseheim, nach Nordwesten gerichteten, großen Fensterwand und schaute sehnsüchtig
Foto: Touristinfo
Neubrandenburg 18 qkm
Tollense 4 qkm Lieps
auf den weit unten im Tal
liegenden langgestreckten, wunderschönen See. Seinen geschwungenen Buchten
folgte mein Blick zu gerne. Das
herrliche von riesigen Buchen-beständen und seinen großen Hügeln umrahmte
Gewässer lockte mich stärker denn je zuvor. Seine ihn umgebenden Mischwaldhänge
umrahmten ein Gemälde wie von Claude Monets Hand gemalt.
Da kam ein fremder, stattlicher und auffallend
gut gekleideter Mann in die geräumige Veranda herein, ein Buchhalter, wie ich
richtig vermutete, der mir nur kurz seinen Namen nannte und nach knapper Frage
neben mir am Mittagstisch Platz nahm. Ohne uns je zuvor gesehen zu haben,
fassten wir zueinander schnell Vertrauen.
Ich hätte wissen müssen, dass
nur drei Meter entfernt, über uns, ein Lautsprecher hing, in den ein Mikrofon
eingebaut worden war. Maque wollte doch unbedingt mithören, was seine Schüler
privat sagten. Hausmeister Paul hatte mir das schon Wochen zuvor erzählt und
mir, in Maques Abwesenheit den großen metallenen Schaltschrank gezeigt und
erklärt wie das funktioniert. Ich wusste
allerdings, dass der Herr der Schule und seine blutjunge blonde
Geschäftsführerin Inge gegenwärtig, mit dem Kajütboot, sich auf dem Weg in die
10 Kilometer entfernte Kreisstadt Neunbrandenburg befanden.
Es war dieses Gefühl von
innerer Übereinstimmung, das mich in den vielen Jahren nie verlassen hatte, das
Gespür wie weit und wem ich mich öffnen durfte und wem nicht. Es dauerte nicht
lange, bis wir die übertriebene Parteiloyalität der Philosophiedozentin Irene
ins Visier nahmen.
Er war Theaterkritiker – und
ich, sagte ich, versuche, „Theater“ zu schreiben. Wir kamen kurz zurück auf die Ansichten der
Lady Irene. Ich plauderte aus, dass sie überaus freundliche Männer gerne hat.
Da lächelte er. Er kannte sie. Sie gehöre zum neuen Frauentyp. Er lachte
erneut, aber sein Lachen klang hart. Nach einer Weile des Schweigens wechselten
wir erneut zurück zum ursprünglichen Thema: Über den XX. Parteitag der KPdSU
und die Absetzung Stalins, tauschten wir unser erstaunlich komplementäres
Wissen und unsere Meinungen aus. Wir verdammten den Aufmarsch von Panzern gegen
Unbewaffnete, und dass in Polen antikommunistische Demonstrationen ebenfalls
gewaltsam beendet wurden. Mein Gesprächspartner wusste, was ich noch nie zuvor
gehört hatte, und ich wusste von Ereignissen, die in sein Bilderbuch passten,
als hätte er schon lange danach gesucht. Wir konnten kaum ein gutes Haar an der
Verwirklichung dieses Sozialismus lassen.
Warum kam mir nicht in den
Sinn, dass Irene die Philosophielehrerin, eventuell mithörte?
Die Rohheit eines Systems, das
uns keine Wahl ließ, quälte uns. Zu viele Leute, deren Namen und Gesichter wir
sehr gut kannten, hatten sich für ihre Karriere entschieden, obwohl sie ähnlich
wie wir dachten und fühlten. Andererseits war uns bewusst, dass die große
Geschichte so chaotisch, wie sie zum Dritten Reich Hitlers verlaufen war, sich
niemals wiederholen darf. An sich war ein Experiment wie der Sozialismus
berechtigt.
Aber nicht als Abenteuer ohne
Rücksicht auf Verluste. Bereits der Urgrund, den Lenin in der Sowjetunion
gelegt hatte, erschien uns beiden als unerträglich. Mehr als das. Nicht wenige
kommunistische Funktionäre handelten wie die „Elitechristen“ des vierten
Jahrhunderts. Diese frommen Typen hatten es gewagt, der ganzen zivilisierten
Welt den Stempel eines erbarmungslos-diktatorischen "Christentums"
aufzunötigen. Sie legten die Basis für die spätere Inquisition. Nach diesem
Muster agierten die Staatsmänner des jetzigen Ostens Einmal würden die
Historiker offenlegen, wie viele Millionen Menschenleben zwischen 1917 und 1937
infolge dieser Art der Revolution allein in Russland vernichtet wurden. Beide
Jahrgang 30, hatten wir vieljährige Erfahrungen, mit dem auf uns zielenden
pausenlosen Propagandatrommelfeuer des Stalinismus, hinter uns. Wie so viele
andere hatten auch wir uns wundgerieben an den uns unsympathischen Parolen, die
in uns undifferenzierten Hass auf den “Kapitalismus” hervorrufen sollten.
Hass sollte gesät werden. Er
musste als Pflanze des Verderbens aufgehen!
Wir empfanden sehr stark, dass
es den maßgeblichen Kommunisten vorrangig um die Vernichtung der Demokratie
ging. Das war es, was uns wie die Vorstufe zur Sklaverei erschien. Als einziges
Mittel zum Überleben unserer prodemokratischen Ansichten blieb uns nur der
Versuch einander in der Ablehnung zu bestärken. Ähnliches wagten
Hunderttausende in diesem Lande, vielleicht sogar Millionen. Und doch war es
nur ein Aufblasen der Backen gegen den gewaltigen Oststurm.
Ziemlich unvorsichtig
bezeichnete ich in jener Mittagsstunde Lenins Dekret über den Boden als glatte
Lüge. Lenin habe nie anderes als die schließliche Verstaatlichung des Bodens
gewollt. Die bitterarmen Muschiks jedoch, an die sich das Dekret richtete, mussten
glauben, wenn sie sich auf Lenins Seite stellten, dann bekämen sie selbst, für
immer, ein Stückchen Land zu eigen. Die vom mörderischen Krieg ausgezehrten,
von Heimweh, Hunger, Läusen und Tod geplagten Russen hörten auch heraus, dass
Lenin den Krieg sofort beenden wolle. Ja, dass sein erstes Dekret überhaupt
ihrem ureigensten, dringlichsten Wunsch entsprach: „Alle Frieden! Frieden!” Von
klaren aber auch unnennbaren Hoffnungen getrieben, mussten sie in Lenin den
Erlöser sehen.
Vorausgesetzt sie würden seinen
Aufrufen Folge leisten, gelangten sie durch einen einzigen Schwenk ihrer Hüften
aus der Hölle direkt ins Paradies.
Wir beide glaubten, dass Lenin vorsätzlich so verfänglich geschrieben hatte.
Sein wahres Gesicht zeigte er, nur drei Jahre später, in seinem Brief „Tod den
Kulaken!”, den man, wie ich es selbst getan hatte, in jeder Lenin-Gesamtausgabe
nachlesen konnte. Eine ganze Klasse, nämlich sämtliche Mittelbauern Russlands,
gab er - wenn auch aus dem berechtigten Zorn über einige tatsächliche
Verbrecher - unterschiedslos dem Verderben preis. Das waren Millionen
Todesurteile! Jeder mit einer Pistole bewaffnete Neidhammel, der glaubte, er
hätte noch eine offene Rechnung mit diesem und jenem Mittelbauern, kam mit
Leninsätzen daher, um an sich zu reißen, wonach ihn gelüstete. Namens der
Partei und der Wahrheit wurden Menschen aus Machtgründen schutzlos.
Bauern wurde das Saatgut
gestohlen, Soldaten sinnlose Befehle erteilt. Nonnen wurden verhaftet und alle
zogen die Köpfe ein, weil angeblich Klassenkampf herrschte. Wehe dem der
aufmuckte.
Die
Zeitung vom 22. Januar 1956 hatte ich aufgehoben. Den Ausschnitt trug ich bei
mir. Ich zeigte, meinem Gesprächspartner, zwei Passagen, die mir ins Auge fielen.
Auf einer Innenseite der Zeitung des Zentralkomitees der SED “Neues
Deutschland” wurde #berichtet, wie der Frankfurter Obermagistralrat Dr. Julius
Hahn, Mitglied des westdeutschen Arbeitsausschusses der Nationalen Front aus
einer Tagung heraus verhaftet wird: „Wir sitzen, hatten gerade das
Hauptreferat gehört...plötzlich beim Mittagsmahl stürmen auf ein
Trillerpfeifenzeichen 20 uniformierte Polizeibeamte in den Saal, riegeln ihn
ab, verlangen in barschem Ton von den Anwesenden die Ausweise…”
Das
Blatt der Kommunisten (der SED) “Neues Deutschland” beklagte das Ausmaß der
Gewalt: den Einsatz von Trillerpfeifen und das Verlangen Ausweise vorzuweisen.
Das sei nicht zu rechtfertigende Brutalität.
Und wie
sollen wir das nennen was in 1953 in Ostdeutschland geschah, als Panzer einen
Arbeiterstreik niederwalzten? Und wie das was die Bolschewisten trieben?
Er oder
ich fügten hinzu: „Bilder, Originalbilder aus den Tagen der Nachrevolution
müsste man sehen, dann wüssten wir, was in Russland zwischen 1917 und 1956
wirklich geschah, das wir gutheißen sollen.“ Das hier, in der Ostpresse,
vorgespielte Mitleid galt Dr. Hahn, den Sympathisanten der Kommunisten: Berthold Brecht, der große ostdeutsche
Theatermann, wurde in diesem Zusammenhang zitiert. Auf dieses Brechtzitat legte
ich den Finger. „Eurem Bruder wird Gewalt angetan, und Ihr kneift die Augen
zu! Der Getroffene schreit laut auf, und Ihr schweigt? Der Gewalttätige geht
herum und wählt sein Opfer, und Ihr sagt, uns verschont er, denn wir zeigen
kein Missfallen. Was ist das für eine Stadt, was seid Ihr für Menschen? Wenn in
einer Stadt ein Unrecht geschieht, muss ein Aufruhr sein…” „Der gute Mensch von Sezuan“
Wer
aber empfand Mitleid mit den nicht verbrecherisch handelnden Kulaken der
Leninzeit? Und was passierte im sogenannten Arbeiter- und Bauernparadies?
Er und ich befanden uns in
Aufruhr. Zunehmend seit Jahren.
Wir
erlebten hautnah, dass schon Ende 1945 sämtliche Landeigner die mehr als 100
Hektar bewirtschafteten, alles verloren: Haus und Hof und Viehbestände. Nun
1956 drohte der Staat sämtlichen Bauern eine besondere Art der Enteignung
an. Die bis dahin selbständig
arbeitenden Besitzer sollten Lohnempfänger werden, indem sie zwangsweise
gemeinsam in Genossenschaften leninscher Art, Weisungen ausführten.
Wir
unterschieden sehr wohl zwischen gewaltsamen und freiwilligen
Zusammenschlüssen, die es ebenfalls gab, wenn auch sehr selten.
Tag für
Tag flohen DDR-Bürger in den Westen, die ihren Besitz gegen die Freiheit
eintauschten. Meine Gedanken mussten, wegen der Behauptung, die meine Kirche
erhob, dass es bald nach dem Tod der Apostel einen Abfall von den echten
Prinzipien gab, immer wieder zurück in das 4. Jahrhundert wandern. Damals übten
angeblich fromme Männer um Ambrosius von Mailand denselben Glaubensterror den
Lenins Schergen praktizierten. Gnadenlos wurden da wie hier zehntausende
Familien ins Unglück gestürzt, die sich weigerten nach der Pfeife eines Diktators
zu tanzen. Ambrosius und Lenin trieben ihre Fraktionen in jahrelange Kriege, da
gegen Ostgoten, die zu hunderttausenden in Italien siedelten und Toleranz übten
und hier dieselbe Art der Machkämpfe unter sehr stark ähnelnden Parolen. Ambrosius
und Lenin wollten die einzig Guten sein. Wer sich gegen sie stellte, wollte das
Böse.
Ambrosius
„Kirchen“-politik sollte Menschen bis ins 19. Jahrhundert hinein quälen.
Wir
sprachen in sehr scharfem Ton über einen Fall absolut ungerechtfertigter
Aufruhr-Niederschlagung in der SU. Da war der nur wenigen bekannte, jedoch
zuverlässig überlieferte Aufstand der Kronstädter Matrosen, 1921, gewesen.
Nur
dreieinhalb Jahre nach der Errichtung der Sowjetmacht klagten die Matrosen der Schlachtschiffe
“Sewastopol” und “Petropawlowsk”, dass die Arbeiter in den Kronstädter
Staatsunternehmen der Sowjetunion „wie die Zuchthäusler zur Zarenzeit”
behandelt wurden.
Auf
Lenins Befehl hin ließ Kriegskommissar Trotzki die Aufständischen
zusammenschießen. Da hatten Mitmenschen eben nur Mitleid gezeigt, eben das was
Bertolt Brecht sich wünschte, indem er forderte: „Wenn in einer Stadt ein
Unrecht geschieht, muss ein Aufruhr sein!“ Doch gerade die Partei, der auch
Bert Brecht diente, zerschmetterte gnadenlos den Aufstand Mitfühlender.
Wie passte das zusammen?
Buchhalter
Günter vermochte es mir sehr anschaulich zu schildern, wie die Truppenteile der
Roten Armee über das Eis des finnischen Meerbusens vorrückten und wie sich die
Artilleristen der eingefrorenen Schlachtschiffe vergeblich gegen den Sturmlauf
ihrer in Weiß gekleideten Waffenbrüder verteidigten. Ich stimmte ihm zu: Wenn
das wahr sei! Dann hätte man Lenin allein für diese Ruchlosigkeit in Ketten
legen müssen.
Gerade,
als ich das aussprach, fiel mein Blick auf das Gerät zu unseren Köpfen. Vor
Schreck blieb mir der Bissen im Halse stecken. Die Ikone des Kommunismus hatte
ich besudelt. So dumm zu sein, wie ich, musste bestraft werden.
Eine
Minute später hörte ich, wie Irene K. die Treppe herunterstieg.
Das
typische Klappern ihrer hohen Absätze klang allein schon bedrohlich. Ich sah
diese blitzenden Augen, als sie sich uns näherte und wusste Bescheid.
Als
leibhaftiger Racheengel wird sie sich nun erweisen. Aber wir hatten doch leise
gesprochen. „Die Empfindlichkeit eines Mikrofons der neuen Generation ist
beträchtlich.” Dieser Satz eines Technikers kam mir in den Sinn.
Namens der Diktatur des Proletariats waren wir der Dozentin, wenn sie
wollte, ausgeliefert. Ich werde ihr die Stirn bieten!
So, so,
sagte der andere Teil meiner Selbst: du wirst deinen großen Schnabel zuhalten
du bist Familienvater und Ehemann.
Aber, trotzte
ich ziemlich hilflos, die einzige Diktatur, die mein Gewissen je dulden wird, ist
die meiner eigenen Vernunft über die Leidenschaft.
„Dafür
schuldet ihr mir Rechenschaft!”, hörte ich sie schon im Voraus
tönen und sogleich sahen meine inneren Augen Männer der Stasi. Dafür, dass wir
uns herausgenommen hatten, sie persönlich zu kränken. Dafür, dass wir uns
herausgenommen ihre Partei und den großen Denker Lenin beleidigend zu
kritisieren. Sie wusste nun, dass wir Ulbrichts System als seelenknechtend
betrachteten. Ihrerseits gab es, selbstverständlich, keinen Zweifel an der
Richtigkeit des Weges, der Zwang als politisches Mittel einschloss. Sie war
mehr als eine Dienerin des Systems und wir ihre Verlierer. Innerlich verteidigte ich mich ununterbrochen
gegen eine mögliche Anklage: Zwang, gleichgültig, von wem angewandt, verkehrt
die beste Sache der Welt in ihr Gegenteil.
Wisst
ihr das nicht? Erniedrigte Frauen müssten unsere Gefühle verstehen können.
Dozentin Irene ging an uns vorbei. Nur einen einzigen, wenn auch sehr
sonderbaren Blick gab sie mir.
Es
ereignete sich nichts, noch nicht. Doch Ungewissheit kann schlimmer sein als die
ungute Gewissheit. Das war es, womit sie regierten. Es braute sich etwas
Gefährliches gegen mich zusammen. Es lag in der Luft.
Einige
Tage später, Mitte Mai erfuhr ich, dass mein Gesprächspartner, der Buchhalter
Günter, wahrscheinlich verhaftet worden sei, oder, und das war nicht
auszuschließen, er hatte sich in den Westen abgesetzt. Jedenfalls sei er
spurlos verschwunden. Das war natürlich zweierlei! Im Westen zu sein oder im
Gefängnis zu sitzen. Verhaftet! Herbert Maque und andere hatten es mir schon
mehrfach zu verstehen gegeben: Wer gegen die DDR hetzt, der spricht der
Friedensfeinde Sprache. Einige
Tage nachdem ich vom Verschwinden Günters erfuhr, fauchte mich die
Philosophielehrerin im Waschraum an: „So nicht!”
Was
meinte sie mit diesem unbestimmten, unvollendeten Satz? Ich holte mein Fahrrad
aus dem Keller, wollte heimfahren. Da sah ich Braun, einen der neu
eingestellten Lehrer, neben Irene K. stehen. Er löste seinen Arm, den er um
ihre Schulter geschlungen hatte. Braun kam dann auf mich zu. Er war klein,
sogar ein wenig kleiner als ich. Sein Ausdruck allerdings war der eines
Giganten. Er machte scheinbar vielsagende Gesten. Ich betrachtete seinen kahlen
Kopf, seine glatten Züge, um ihm nicht in die provokant ausforschenden, hellen
Augen blicken zu müssen. Unter dieser Schädeldecke bildeten sich Worte und
Sätze gegen mich. Das war nicht zu übersehen. Nicht so sehr überraschte mich
deshalb, dass er formulierte: „Wir werden sie wohl hoppnehmen müssen!”
(Er meinte wir werden dich hinter Gitter bringen müssen) Braun schien zu
wissen, was ich dachte. Er sagte: „Wegen subversiver Tätigkeit.” Erst als ich mit meinem Rad davonfuhr und
seine und ihre Blicke im Rücken zu spüren glaubte, fiel ich in Panik. So leicht
hatte der Neue es daher gesagt, als hätte er gemeint, morgen ist auch noch ein
Tag zum Teetrinken.
Bezog
er sich auf das Abbrennen der Wiese? Hatten
sie die zerstörte Gig entdeckt? War, was
die Dozentin über die Abhöranlage vernahm, nur der I-Punkt?
Reimten
beide sich des Buchhalters Günters Bemerkungen wegen noch mehr zusammen? War Günter ein Spitzel gewesen?
Du
wirst für die unverzeihliche Sünde bezahlen.
Lenin
durfte alles. Im Namen der Revolution durfte er tun, was er für erforderlich
hielt, selbst wenn sämtliche Nicht-roten allesamt daran verreckt wären. Wo
gehobelt wird, da fallen Späne.
Ich ließ zu, dass es in mich
hinein hämmerte: „Heiligtümer besudelte niemand ungestraft. Du hast ihre
Sache in den Dreck getreten. Geschieht dir recht, wenn sie dich hoppnehmen.“
Mit diesem Schock, die Gitterstäbe vor Augen, fuhr ich heim. Ich trat in das
Pedalen und schwitzte vor Aufregung. Otto Krakow, mein Gemeindepräsident und
zugleich mein väterlicher Freund, beruhigte mich. „Subversiv? Was heißt das?
Tollenseheim steht doch noch. Bange machen gilt nicht! Lass dich nicht ins
Bockshorn jagen!” Er hatte gut
reden. Das Wochenende verging. Am Montagmorgen versicherte ich mich, ob Braun
die Gig entdeckt haben könnte. Nein. Es geschah so gut wie nichts, außer dass
meine Gefühle verrücktspielten. Hatte
ich mich umsonst aufgeregt? Hausmeister Paul ging in dieser Woche überraschend
von Tollenseheim weg und ich beschloss, dasselbe zu tun. Am Sonnabend den 2.
Juni 1956, las ich in der Presse, die in der Veranda der LPG-Schule auslag, die
Produktionsgenossenschaft werktätiger Fischer “Tollense” suche umgehend zwei
Saisonarbeiter,
Das schien mir das ein Wink des
Himmels zu sein. Zögern? Nicht eine Minute.
Herbert Maque legte sein
ernstes Gesicht in tiefe Falten und entließ mich erstaunlich zurückhaltend
sofort aus der Pflicht.
Eigentlich war er nicht mein
Vorgesetzter. Die Kündigung hätte ich beim örtlichen Landwirtschaftsbetrieb
Groß Nemerow (ÖLB) einreichen müssen…
Als Fischereihilfsarbeiter auf
Zeit
Erika, meine Frau, schlug die
Hände über dem Kopf zusammen: "Das ist die unterste Stufe auf die du
dich dann begibst!“ "Na und?
Das ist meine Chance, wo soll ich sonst hin? In ein Büro wo ich über dem
Studium toter Zahlen einschlafe?"
Ich sollte die Männer allesamt sehr gut
kennen lernen. Buchhalter Adolf Voß hob die Stirn als er mich sah und
betrachtete: „Sie gehören hier nicht her. Das sind alles raue Gesellen…“
Ich lachte. Raue Gesellen haben meistens ein gutes Herz. „Na, ja,“ seufzte
er: „für sechs Wochen!“
„Hast
du schon einmal bei windigem Wetter in einem kleinen Boot gestanden?“ lautete die Frage des Vorsitzenden Bartel, Überlebender des 2.
Weltkrieges und ehemaliger Gefangener in Russland: „Ja, bei Kurt Meyer,
Cammin, aber schon früher auf der Peene, in Wolgast!“
Für sechs Wochen!“ erwiderte
er.
Es
begann mit einer Nachtschicht – und die hätte gleich die letzte meines Lebens
sein können. Es waren allesamt fast verfaulte niedrige kleine Fischerkähne.
Das waren die Männer mit denen
ich lange Jahre zusammenarbeiten sollte:
Beladen
mit den Großnetzen ragten sie nur gut vierzig Zentimeter über dem Wasser-spiegel.
Die Netze sahen ebenso verrottet aus, wie der kleine Schlepper, ein uraltes
Motorboot. Der wurde von einem ballernden 12 PS Dieselmotor angetrieben. Dieser
Kutter wies am Bug ein faustgroßes Loch auf. Seine drei Wasserkammern waren
groß genug um 5 Tonnen Fische aufzunehmen.
Aber
ich ahnte gleich. 5 Tonnen Fische fangen, an einem Tag? Dann sähe alles hier,
einschließlich der grünen kleinen Baracke, nicht so primitiv aus. Mir wurde
das Heckteil im rechten Kahn zugewiesen. Kaum einen Kilometer hinaus auf den
tiefschwarzen Tollensesee angekommen, zuckten erste Blitze. Das Wasser geriet
in immer heftigere Bewegung. Die nur knapp einen halben Meter über glattem See
aufragenden Bordwände der nebeneinander liegenden Zugnetzkähne boten nun bei
zunehmendem Wellengang wenig Sicherheit. Da stand ich nun und wurde vom
aufgeregten See bespritzt. Ich nahm die vor mir liegende Schaufel und entleerte
mein Boot vom eindringenden Wasser. Vom aufkommenden Sturm geschüttelt stießen
beide Kähne rhythmisch gegeneinander.
Dabei nahmen wir immer mehr Seewasser über. Mein Partner Kurt, ein wegen
Alimentenklagen aus Westdeutschland in den Osten geflohener Familienvater
ärgerte sich über die Spritzer und über mich. Er war betrunken und nahm an, ich
hätte ihm absichtlich eine Ladung Wasser ins Gesicht geschaufelt. Sofort hob er
seine Pätsche (Ruder) und ich duckte mich instinktiv hinter den Netzballen. Nur
deshalb traf er mich nicht. Das Gewitter ging so schnell es gekommen war
vorbei. Was wir mit dem ersten Zug in
dieser Nacht fingen war erbärmlich. Meine Aufgabe bestand darin knapp 200 Meter
der zwölf Meter hohen Netzwände über Bord zu hieven, während die beiden
„Vorder“fischer mit ihren Rudern den Kahn parallel zum Land vorwärts zogen.
Dann liefen die Stahlseile der Winden ab. Nach zweihundert Metern wurde
geankert und das insgesamt 400 Meter lange Zugnetz wurde heran gewunden.
Nachdem das mit Muskelkraft getan war, ruderten wir wieder aufeinander
zu, ankerten erneut im Schilf und zogen mit Windenkraft das Netz zurück in die
Arbeitsboote. Alles in der Hoffnung im riesigen Wadensack zehn Zentner Fische
vorzufinden. Aber es waren nur wenige Kilogramm minderwertiger Plötzen. Nach
vier Nächten Wadenfischerei fühlte ich mich erschöpft, weil ich nicht gewohnt
war, tagsüber zu schlafen. Es gelang mir einfach nicht ins Traumland zu gehen.
In der fünften Nacht, die uns guten Fang bescherte, fiel ich gegen 3 Uhr
morgens auf der Eismiete um. Es oblag mir, aus dem schützenden Mantel Sägemehl,
die im Winter vom See eingesammelten Eisblöcke herauszuholen, um schließlich
die in Holzkisten liegenden Fische zu kühlen. Keine Ahnung, wie lange ich
ohnmächtig auf der weichen Schutzschicht, in dieser warmen Sommernacht, lag.
Dennoch, die Arbeit sagte mir zu, weil es immer wieder die Nerven spannte, was
da mit dem nächsten Hol zu erwarten war. Tatsächlich, eines Tages, nach
längerer erfolgloser Fischerei wurden wir überrascht. Direkt hinter den
Trümmern der ehemaligen Torpedo-versuchsanstalt gelang es uns, einen
Riesenschwarm großer Barsche zu fangen. Alles sah zuvor trostlos aus.
Zwei
Tonnen exzellenter und weitere zwei Tonnen kaum weniger wertvoller Fische
füllten die Kammern des dickbauchigen Kutters. Von da an ging es aufwärts. Tag
für Tag brachten wir tonnenweise Qualitätsfische auf die Sortierbank. Wir
belieferten auch Berlin. Und, wie das
Leben so spielt: Mikusch, ein junger Familienvater setzte sich im Juli 1956
alleine in den Westen ab, - als politischer Flüchtling, wie er sehr
wahrscheinlich vorgab - und ich durfte bleiben und seine Stelle einnehmen… Sie
nahmen mich, wenige Wochen später, auf meine Bitte hin als gleichberechtigtes
Mitglied in ihr Genossenschaft auf: „Siehst du!“ sagte ich mir „nur die
Sache ist verloren, die man aufgibt.“
Sie
akzeptierten, dass ich nicht mit ihnen Schnaps oder Alkohol anderer Art trank.
Sie akzeptierten, dass ich sonntags nicht arbeiten wollte, sondern mit Erika
und Hartmut „zu Kirche“ ging. Sie fanden es fremd, dass ich immer ein Buch
mitnahm. Sie akzeptierten sogar meine kleine Reiseschreibmaschine.
Wenn
wir bei ungutem Wetter zu sechst in der Fahrerkabine und beim Höllenlärm des
großen Dieselmotors mit seinen gewaltigen Schwungrädern eng beieinandersaßen,
hielt sie der eine oder der andere geduldig auf Knien, denn die Festzeitung,
die ich machte, verhalf ihnen zum Lachen über sich selbst, da ich sie spassvoll
skizierte. Sie fühlten, dass ich sie
gerne hatte. Jeder von ihnen hatte seine Sonnenseite. Kurt, der mich in der
ersten Nacht bedrohte, lag nach einer durchzechten Nacht unter dem großen
schäbigen Tisch der Fischereihütte, allerdings umgeben von fünf seiner
Mitfischer. Sie hatten unfertigen „Rumtopf“ konsumiert. Das war es, was mich
oft bekümmerte. Kurz danach lag Kurt wieder betrunken mitten auf dem Netzboden.
Einer stieß ihn unsanft mit seinem Stiefel. Ich sagte: „Wie soll der Mann
aufstehen, wenn du ihm in den Hintern trittst!“, auch das wurde akzeptiert.
Kurts unselige, neue Frau, die Mutter seiner beiden Töchter, weinte sich eines
Tages bei mir aus. Er schlug sie, brach in seiner Wut ihren Arm. Er konnte die
vielen Niederschläge die er in Kriegs- und ersten Nachkriegszeiten erlitt,
nicht wegstecken. Nun verdiente er nicht genug. Wegen der aus dem Westen
erfolgreich geführten Alimentenklage musste er Lohnabzüge hinnehmen. Er wohnte
miserabel. Er hasste sich selbst wegen seiner Alkoholsucht. Dann lag er im
Krankenhaus. Die Ärzte wussten keinen Rat. Ich besuchte ihn. Zum ersten Mal in
meinem Leben nahm ich die Hand eines Mannes um sie länger fest zu halten. Am
nächsten Morgen kam Bärbel, seine Frau zu mir: „Kurt hat die Nacht
durchgeschlafen, das Fieber ist wieder runter. Es geht ihm besser.“
Eigentlich
ist es normal. Jeder braucht ein wenig Anerkennung. Ich hatte versucht, sie ihm
zu geben.
Fritz
Biedersteadt war ein völlig anderer Typ. Wenn er trank und vom „Dienst“ spät
heimkehrte wurde er gelegentlich vom Ehebett seiner Lebensgefährtin verbannt.
Dann
musste er in einer anliegenden Dachkammer seinen Rausch ausschlafen. Darüber
lachte er, sich selbst verspottend und zugleich selbstbewusst. Als
vierzehnjähriger ergab sich für ihn die Möglichkeit hoch![]() herrschaftlicher
Diener zu werden und zwar im Berliner Haus der Freifrau von Stein. Nie
verwandte diese Dame von Welt, der er jahrelang angehörte, ein niederes oder
tadelndes Wort, oder gar ein Schimpfwort. Aber es gab im vornehmen Haus einige
weibliche Bedienstete, die einander nicht immer mit Freundlichkeiten
bedachten. Er lernte dort ausgesuchte Höflichkeiten und betont gutes
Benehmen einerseits, andererseits das pure Gegenteil. Er konnte sich elegant ausdrücken,
ausgenommen, nachdem ihm der Alkohol die Selbstkontrolle nahm. Ein ganzes Jahr
hindurch standen wir, tags oder nachts gemeinsam an der eisernen Handwinde und kurbelten
das Zugnetz gegen den Wasser - und Bodenwiderstand ans Ufer, zu uns heran. Er
malte seine Vergangenheit in vielen, aber nie übertriebenen Farben. Fritz war
ein Erzähltalent und Stimmungsmacher. Er gab mir einen Rückblick in die 20 er
Jahre der mich zur Frage führte, ob es je unter uns Erdenkindern eine Zeit gab,
in der Menschen ihr kleines Glück, wenigsten für eine beachtliche Weile
ungetrübt durchleben durften? Meister und Fischereipächter Ernst Peters Senior,
stellte ihn 1921 als Hilfsarbeiter ein, nachdem Freifrau von Stein sich
gezwungen sah, ihren Lebensstil zu ändern. Der alte Peters war Neujahr 1929 am
Ende. Der Strick an den er sich erhängen wollte, war bereits befestigt, an
einem Balken seines großartigen Wohnhauses am Neubrandenburger Oberbach. In
seiner Verzweiflung gab er die letzten Pfennige für Schnaps aus. Da fingen
seine Getreuen mit ihren Fangnetzen, die unter Eis von Loch zu Loch gezogen
wurden auf einen Schlag 20 Tonner Brassen allererster Klasse. Fische nach denen
die Berliner Großhändler seit Wochen vergebens riefen. Die Jüdinnen waren
versessen darauf. Für mehr als drei Seiten wurde dieser Fang zum Glücksfall.
Zigtausend Goldmark fielen dem dauertrunkenen Mann in den Schoß. Mit Links
legte er dem Kämmerer der Stadt die Pachtsumme auf den Tisch. Er bezahlte seine
Schulden. Aber ihm und seiner Familie
wurde es nicht zum Segen. Der Teufel Alkohol behielt ihn im Griff.
herrschaftlicher
Diener zu werden und zwar im Berliner Haus der Freifrau von Stein. Nie
verwandte diese Dame von Welt, der er jahrelang angehörte, ein niederes oder
tadelndes Wort, oder gar ein Schimpfwort. Aber es gab im vornehmen Haus einige
weibliche Bedienstete, die einander nicht immer mit Freundlichkeiten
bedachten. Er lernte dort ausgesuchte Höflichkeiten und betont gutes
Benehmen einerseits, andererseits das pure Gegenteil. Er konnte sich elegant ausdrücken,
ausgenommen, nachdem ihm der Alkohol die Selbstkontrolle nahm. Ein ganzes Jahr
hindurch standen wir, tags oder nachts gemeinsam an der eisernen Handwinde und kurbelten
das Zugnetz gegen den Wasser - und Bodenwiderstand ans Ufer, zu uns heran. Er
malte seine Vergangenheit in vielen, aber nie übertriebenen Farben. Fritz war
ein Erzähltalent und Stimmungsmacher. Er gab mir einen Rückblick in die 20 er
Jahre der mich zur Frage führte, ob es je unter uns Erdenkindern eine Zeit gab,
in der Menschen ihr kleines Glück, wenigsten für eine beachtliche Weile
ungetrübt durchleben durften? Meister und Fischereipächter Ernst Peters Senior,
stellte ihn 1921 als Hilfsarbeiter ein, nachdem Freifrau von Stein sich
gezwungen sah, ihren Lebensstil zu ändern. Der alte Peters war Neujahr 1929 am
Ende. Der Strick an den er sich erhängen wollte, war bereits befestigt, an
einem Balken seines großartigen Wohnhauses am Neubrandenburger Oberbach. In
seiner Verzweiflung gab er die letzten Pfennige für Schnaps aus. Da fingen
seine Getreuen mit ihren Fangnetzen, die unter Eis von Loch zu Loch gezogen
wurden auf einen Schlag 20 Tonner Brassen allererster Klasse. Fische nach denen
die Berliner Großhändler seit Wochen vergebens riefen. Die Jüdinnen waren
versessen darauf. Für mehr als drei Seiten wurde dieser Fang zum Glücksfall.
Zigtausend Goldmark fielen dem dauertrunkenen Mann in den Schoß. Mit Links
legte er dem Kämmerer der Stadt die Pachtsumme auf den Tisch. Er bezahlte seine
Schulden. Aber ihm und seiner Familie
wurde es nicht zum Segen. Der Teufel Alkohol behielt ihn im Griff.
Die
Zeit verging wie im Fluge.
Aber
ich wollte verantwortungsbewusstes Subjekt sein.
ich wollte so gut es ging gegen Unfreiheit
ankämpfen. Es gab zu viele Anlässe
aufzubegehren, um zu schweigen. Das jedoch war nach wie vor gefährlich. Mehr
und immer mehr Bürger sahen, dass die Lebensweise die ihnen der Staat aufzwang zu
einer für sie unerträglichen Bürde wurde. Sie packten ihre Koffer und
flüchteten in die Freiheit.
In der Nähe von Cammin
begegnete ich, schon Jahre zuvor, als ich die Hagelversicherungsscheine gegen
Provision verteilte, ein junges Bauernehepaar. Es handelte sich um die Besitzer
von 60 ha Land und Wiesen. Die schmale Mutter trug ein vielleicht einjähriges
Kind auf dem Arm, das Größere hielt sie an der Hand. Sie schaute mich mit einem
Augenausdruck an, der mir unvergesslich blieb. Er stand in Lederstiefeln
daneben, ein Mann wie aus dem Bilderbuch. Er schaute mich ebenso ernst an. Seit
200 Jahren seien sie Bewirtschafter derselben Scholle. Unternehmer, wie er,
waren dem Staat ein Dorn im Auge. Nun spüre er den Druck alles zu verlieren
zunehmend. Ehe das Wirklichkeit wird,
müsse er handeln: „Wir gehen in den Westen!“ Alleine das offen zu sagen
war im Land des „real existierenden Sozialismus“ gewagt. Aber er schätzte mich
richtig ein. Einer wie ich würde ihn nicht verraten. Es war die Summe der
vielen kleinen geschickt oder plump angewandten Schikanen, die ihn
forttrieb. Sie wurde von Leuten
ausgeübt, die glaubten nun sei ihre Stunde gekommen. Er wird seine Kinder nicht
Lehrern überlassen, die deutsche und europäische Geschichte fälschten. Ständig behauptete die SED-Presse, mit der
Veränderung der Besitzverhältnisse in ihrem Sinne, würde mehr Gerechtigkeit
geschehen. Nicht die organisch heranwachsenden Erfordernisse sollten den
weiteren Entwicklungsverlauf bestimmen, sondern die Parteiprogramme Suslows,
Stalins und Ulbrichts. Aber in jeder Ehe würde sich der Partner zu Recht
auflehnen, wenn mit ihm lieblos, „nach Programm“ verfahren würde. Seitens des Staates flogen die
roten Signale und Kommandos rasend schnell.
Immer wieder wurde auch den Bauern vorgeschrieben was sie zu tun und zu
lassen hätten. „Ich weiß selbst was ich als Landwirt zu tun habe!“
Das in etwa war der Inhalt
unseres Gesprächs, ein oder zwei Tage vor der Flucht dieser liebenswerten
Menschen.
Hermann Göck, Vorsitzender der
Bezirksparteikontrollkommission der SED, Altkommunist, Bewunderer Ernst
Thälmanns, den er persönlich kannte, war Ehrenmitglied und Berater unserer
Genossenschaft. Ich kannte ihn bereits seit Sommer 1956, kurz nachdem ich ihr
Mitglied wurde. Es gab regelmäßig wiederkehrende Schulungen die in unserer
kümmerlichen Baracke abgehalten wurden. Der überaus gutmütig
Bezirksfischmeister Jochim, eine ehemaliger Ostpreuße hielt sie ab, und Göck
kam gelegentlich dazu, der dringend wünschte, wir würden geschlossen in seine
Partei eintreten. Aber keiner wollte.
Ende
August 57
![]()
Bild:
Jochen Milster Da bin ich schon ein Jahr lang dabei - hier im kalten Sommer
1957 - links außen. So sah die Zugnetzfischerei aus.
Wir erlebten eine ziemlich
deftige Auseinandersetzung zwischen Göck und Görß. Otto Görß war, was erst
Monate später offen zutage lag, ein technisches Genie. Er baute dann die erste
Unterwasserschneidemaschine die funktionierte. Kein Ingenieurbetrieb der DDR
brachte das bislang zustande. Obwohl es dafür dringenden Bedarf gab. Auch er
wollte aus dem Elend hochkommen. Er verglich westdeutschen Wohlstand stets mit
der Armut des Ostens. Selten nahm Otto ein Blatt vor den Mund.
Da saßen
wir 14 Genossenschaftler beieinander in diesem 4 mal 4 Meter kleinen
„Kulturraum“ und vernahmen Eduard Jochims und Hermann Göcks Lobreden auf die
Vorzüge des Sozialismus der DDR-Prägung. Göck eins achtzig groß, schlank von
angenehmen Äußeren schwärmte noch, als Otto Görß, Vater von sechs Kindern, ihn
kühn unterbrach: „Ich habe als Soldat während des Krieges weite Teile der
Sowjetunion gesehen, sowohl die unendlich vielen strohgedeckten Hütten der
russischen Kolchosbauern, wie auch die staatlichen Kulturpaläste.: „Ihr macht
alles mit dem Daumen der Gewalt.“ Das sagte er in Plattdeutsch: „Ji moken
allens mitn Dumen!“ Dabei drückte ihn nach unten auf eine unsichtbare Platte, mit
leicht gequältem Gesichtsausdruck. Otto wurde Binnenfischer in der Hoffnung er
könne seine Familie leichter ernähren und neue Fangideen entwickeln. Aber die
künstlich niedrig gehaltenen Fischpreise hinderten ihn zu mehr Wohlstand zu
kommen. Die steinharte kommunistische Machart verursache Magendrücken. Er
bekräftigte: die Rücksichtslosigkeit mit der die Ost-Welt befriedigt aber auch
reglementiert und unterworfen werden sollte, läge brutal offen.
Ausgerechnet mich schaute
der Altkommunist so an, als sollte ich ihm Beistand gegen die Argumente Ottos
leisten. Offenbar war Göck unbeirrbar davon überzeugt, dass die neue Generation
gar nicht anders konnte, als seinen umdüsterten Ideen, die er für taghelles
Licht hielt, begeistert zu folgen. Ich gab den aufmunternd gemeinten Blick zwar
freundlich, wie ich glaube, zurück, konnte mich jedoch nicht bremsen.
In mir lebten ja all diese
Widersprüche, hier wenige großartige Sowjetsoldaten und da die ungeheure Masse
der Primitiven. Hier die kleine Gruppe Idealisten die eine bessere Welt unter
eigenen Opfern hervorbringen wollen, Männer wie Herr Kell der uns dummen Bengel
vor dem Abtransport nach Sibirien bewahrte.
Da aber
war die unübersehbare Menge Karrieristen die nichts weiter wünschte als
persönliche Vorteile erlangen. Leute die nur „absahnen“
wollten, die auch dann noch wegschauten, als offensichtlich wurde, dass Nordkorea
Südkorea verwüstete, mit dem Ziel die ganze Halbinsel in Besitz zu nehmen, als
niemand mehr leugnen konnte, dass Stalins Direktiven den Hungertod von
Millionen Ukrainern verursachten. Dies geschah in einem Land das prädestiniert
war, riesige Weizenüberschüsse hervorzubringen.
Und ich sah im Geist immer noch das rote Banner am Friedländer Tor
auf dem in Großbuchstaben, noch vor wenigen Tagen frech geschrieben stand: Stalins Geist
lebt!
Aber, wie glücklich waren Abermillionen vor
drei Jahren zu hören dieser Tyrann, der wochenlang
Todeslisten erstellte, sei tot.
Aus vielen Elementen des roten
Parteiprogramms ließ sich, wie aus dem braunen Hitlers, Schaum
schlagen, mehr nicht.
Nicht laut, doch deutlich, nach
diesen Reflektionen, zitierte ich die Parteipresse des Vortages: „Da muss
sich vieles von Grund auf ändern! sagte selbst Chruschtschow.“
Göck reckte seinen langen Hals
noch länger. Seine Augen rollten vor Schreck und ich fuhr fort: „Ich habe
auch die Zeitungsberichte des „Neuen Deutschland“ vom 4. März 56 aufbewahrt.
Walter Ulbricht erklärte dort, was keiner erwartet hätte: Stalin ist kein
Klassiker des Marxismus. Damit distanziert er sich vom
Persönlichkeitskult um Stalin. Und dann, Chruschtschows
Enthüllungen…“
Göck unterbrach mich, ziemlich
erbittert: „Welche Enthüllungen?“ Rostig klang seine sonst klare Stimme. Meinte
er wirklich wir seien blind? Mich trieb es zu sagen: „Und Walter Ulbricht
räumte auf der Berliner Bezirksdelegiertenkonferenz ein, dass Josef
Stalin zum Nachteil der gesamten Sowjetgesellschaft die falsche These vertreten
habe: mit der Entwicklung des Sozialismus verschärfe sich der innersowjetische
Klassenkampf. Das führte zu Mord und Totschlag.“
Göck räusperte sich, während ich
meine eigenen Bilder sah, die ihm nicht gefallen hätten. Er schaute mich durchdringend an, überrascht,
dass da jemand aus dem Nichts auftauchte und sich herausnahm ihm, dem namhaften
Funktionär Steine in den Weg zu legen.
Alle anderen schwiegen, die Augen Otto Görß leuchteten. Neumann und
Gräf, der Brigadier hassten ohnehin alles Neue, insbesondere was da aktuell
politisch passierte. Sie lebten geistig immer noch im vergangenen Jahrhundert,
das hatten sie mir mehr als einmal deutlich zu verstehen gegeben.
Göck irrte. Sein Denken war
utopisch.
Ich schwieg jetzt. Aber meine
Gedanken gingen weiter
In meiner Kirche habe ich
gelernt, dass Unwahrheiten niemals dazu beitragen, ein solides Fundament zu
bilden. Die von loyalen Kommunisten erfundenen „Volkswahlen“ waren im Grunde
eine freche Lüge. Wehe dem, der den ihm ausgehändigten Zettel nicht gehorsam
faltete und unbesehen in den Schlitz einer Urne steckte. Auf jeden Fall standen
auf diesem Papier - Wahlzettel genannt - nur die Namen von Menschen, die kaum
jemand kannte, die sich bereit erklärten, ein Mandat anzunehmen, das selten
ihre wahren, tatsächlichen Überzeugungen widerspiegeln konnte. Die oberste Priorität
dieser gewählten Amtsträger bestand darin, falls sie überhaupt gefragt
würden, den Willen der Mitglieder des kommunistischen Politbüros durchzusetzen. Sehr selten gab es Ausnahmen von
dieser Regel, etwa wenn es sich lediglich um ein ethisches, also unpolitisches,
Problem handelte, das den Mitgliedern der Volkskammer vorlag, wie
beispielsweise im Fall der Frage ob Abtreibungen generell erlaubt sind.
Ja, es gab Wahlkabinen.
Jeder, der da hineinging, musste
ein „Klassenfeind“ sein, Feind der herrschenden Regierung. Mit solchem Schritt
brandmarkte sich die mutige Person selbst.
Ich sah Göcks hagerem Gesicht an,
wie es in ihm arbeitete, wie sehr er sich ärgerte. „So nicht!“ zürnte
er. Aber das änderte nichts daran, dass die SED-Parteipresse, vieles, - was ich
jemals innerlich oder vorsichtig kritisiert hatte, bereits in den
Frühlingstagen des vergangenen Jahres, - bestätigte. Große Teile der
mehrstündigen Geheimrede Chruschtschows vor Spitzenfunktionären seiner Partei
kamen nun Stück für Stück zutage. Lange hallte in mir ein Satz Göcks nach, den
er zum Abschluss dieser Schulungsrunde formulierte: „Entweder man steht
links oder rechts, wer zwischen die Fronten gerät wird zermalmt.“ Wenigstens
das war ehrlich gesagt.
Gewagte Schritte
Ich suchte einen Weg, eher einen
Umweg, mich politisch pro demokratisch einzumischen. Vielleicht versuche ich
ein Theaterstück zu schreiben, das eben sowohl unverfänglich wie deutlich
widerspiegelt, dass es eine Schande ist, Menschen wegen ihrer Gesinnung zu
verfolgen. Es musste klar sein, dass erst die Umsetzung einer Bosheit strafbar
ist.
Ich musste einen weiten Umweg
gehen, um die Willküraktionen der Partei wirkungsvoll anzuprangern. Es sollte
ein Stück sein, das auch aufgeführt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten
ungefähr 1.5 Millionen ostdeutsche Bürger die Flucht ergriffen. Sie flohen, wie
der ehemalige Erzkommunist Wolfgang Leonhard, vor dem schmerzhaften Druck den
„die Partei“ ausüben durfte. Niemand verließ Haus und Hof, der es sich nicht
gründlich überlegte.
Niemand ist glücklich, wenn er
mit dem Knüppel vorwärtsgetrieben wird, selbst wenn es ein Paradies wäre, das
ihn erwartet. Das war meine Grundidee.
Ich müsste sie weit in der
Geschichte zurücklegen.
Die spanische Inquisition wurde schon zu oft und wirkungslos beschrieben, aber nicht die
Jahrhunderte währende Drangsalierung der zwangsgetauften Mauren Spaniens durch
angeblich linientreue Christen.
Ich las alles was erreichbar war
und zu dieser Tragödie gehörte.
Wahrscheinlich 711, von
zerstrittenen westgotischen Fürsten ins Land gerufen, überquerte der Berber
Tarik mit einigen tausend Kämpfern die Straße von Gibraltar. Nach sieben Jahren
lag ihnen ein Großteil der iberischen Halbinsel buchstäblich zu Füßen. Im
Jahr 730 standen sie bereits vor den Pyrenäen.
Erst der fränkische Hausmeier Karl
Martell stoppte ihren Siegeslauf in der Schlacht von Tours und Poitiers 732.
Unbestritten ist, dass die arabische Kunst und Wissenschaft auf ganz Europa
positiv wirkte. Im Zuge der Reconquista wurden die Mauren Schritt für Schritt
zurückgedrängt, doch sie hinterließen nicht nur großartige Bauwerke, sondern
auch erstaunliches Wissen in Sachen Mathematik, Philosophie und Medizin. Was
mich aber schon Jahre zuvor beeindruckte war die Tatsache ihrer toleranten
Umgangsweise mit denen, die in ihnen ihre Todfeinde sahen. Als die christlichen
Reiterheere 1085 Toledo rückeroberten zog ihnen Bischof Bernard von Toledo mit
seiner unversehrten, kompletten Gemeinde kreuztragend entgegen. Die Legende
„Der Islam oder das Schwert“ erwies sich im Wesentlichen als Christenpropaganda.
Meine Absicht war, großen
Arabern, wie den persischen Arzt Zakariyyā al–Razis (865-925), das
Wort zu geben, das im Berufungsbrief jedes Politikers und Lehrers geschrieben
stehen müsste: „Unser Beruf verbietet uns, jemandem Schaden zuzufügen: Mein
Gott leite mich, in der Wahrheit und nichts als in Liebe und Wahrheit zu
leben.“ Das sagte er zu einer Zeit als Großfürst Wladimir von Kiew, Ukrainer
und Russen mit Waffengewalt in die Knie zwang. Jeder hatte seine sich „christlich“
nennende Diktatur aus politischen Gründen anzuerkennen. Gemäß
seinem arroganten Wesen drohte er Menschen den Tod an, falls sie sich seinen
Befehlen widersetzten: Ihr müsst euch taufen lassen. „Auf diese Weise wurde
das christlich-orthodoxe Bekenntnis zur russischen Staatsreligion.“
Diesen Geist übernahmen die
Kremlherren seit je. Diesen Gegensatz zum ursprünglich toleranten Hellenismus
und dem Christentum wollte ich herausstellen. Konnte das gelingen?
Ein kleiner, naiv-armseliger Tollensefischer
wagte es, ein bis an die Zähne bewaffnetes Riesenungeheuer zu attackieren?
Al–Razis lehrte dagegen
ermutigend, dass des Menschen Seele nach Vollkommenheit in Freiheit strebt.
![]() Und nach
ihm, war da Abd er–Rahman III. Dreißig gute Jahre hindurch bis 961. regierte er wie ein Richter des alten Israel,
den südlichen Teil der spanischen Halbinsel, das Kalifat Cordoba. Er realisierte das große Koranwort, das auch
in der Bibel geschrieben steht: Gott ist Liebe. Schon als
zwanzigjähriger Fürst des Kalifats Cordobas begriff er, was
Und nach
ihm, war da Abd er–Rahman III. Dreißig gute Jahre hindurch bis 961. regierte er wie ein Richter des alten Israel,
den südlichen Teil der spanischen Halbinsel, das Kalifat Cordoba. Er realisierte das große Koranwort, das auch
in der Bibel geschrieben steht: Gott ist Liebe. Schon als
zwanzigjähriger Fürst des Kalifats Cordobas begriff er, was
Wikipedia Commons
Da war mein Bezug: Ideen, gleich
wer sie hegt, die irgendeine Form der Diktatur stützen, ebnen der Verwilderung
den Weg.
Meinen, vor diesem Hintergrund,
verfassten Dramenentwurf „Philipp und seine Maurisken“ legte ich im
Friedrich - Wolf- Theater Neustrelitz vor. Eine Woche später luden mich die
Dramaturgen zum Gespräch ein:
„Sie haben einige sehr schöne Verse geschrieben, aber von Theater
haben sie keine Ahnung. Das Stück ist unspielbar. Hier, studieren sie Harald
Hausers „Himmlischer Garten“ besonders die Regieanweisungen.“ Danach würden
sie mich einladen und mir zeigen, was sich vom Standpunkt der Theaterleute aus
rund um die Bühne herum ereignet.
Ich sah ein, dass mein Vorsatz,
im Verhältnis zu meinem Können, zu groß war. Ich schlug deshalb diese
Möglichkeit praktisch aus, - bis auf später.
Ich wusste nicht, dass die
Theaterverantwortlichen mich, Horst Blume, dem Leiter der damals gerade
gebildeten Gruppe „Junge Autoren“ empfohlen hatten. So erhielt ich überraschend
eine Einladung zu einer Arbeitstagung.
Was ich dort dann erlebte
schreckte mich sofort wieder ab.
Es galt obenan den Sozialismus
Ulbrichts hoch zu loben und selbst das offensichtlich Böse gutzureden.
Es dauerte nicht lange und sie
warfen mich vor die Tür, nachdem ich meine Überzeugung nicht versteckte.
Diejenigen die dort das Sagen
hatten, wünschten keine Diskussionen. Sie ahnten, worauf ich wirklich hinauswollte: „Schreiben
kannst du, aber was soll das, deine Schwärmerei für uralte Herrschaften und den
philosophischen Idealismus?“
Der berühmte, dort anwesende Alfred
Wellm meinte es gut mit mir: „Du solltest schreiben, wie du deinen Glauben
überwunden hast. Das wäre doch hoch interessant!“ Natürlich überprüfte ich
unentwegt meine Glaubensansichten. Die Umstände und meine Wesensart trieben
mich immer wieder an, jeden Satz meiner Grundüberzeugung zu hinterfragen.
Jetzt aber wollte ich es
gründlicher wissen.
Ich sehe immer noch den
unaufgeräumten Dieselschuppen unserer Fischerei. Ich stand, wenige Tage nach
meinem Hinauswurf aus der Gilde der Jungautoren, den Blick himmelwärts
gerichtet: „Lieber, großer Gott. Ich muss mit Bestimmtheit wissen ob die
Kirche, der ich angehöre, die Kirche Jesu Christi ist!“
Damit unterstellte ich, dass all
meine positiven Erfahrungen, das Produkt meiner Wünsche sein könnten. Was ich
bislang erlebte, reichte nicht aus, im kommenden zähen Kampf um Recht und
Wahrheit zu bestehen. Ich versprach Missionsarbeit zu leisten und Vollzeitmissionare
auf einige Jahre hinaus mit der Hälfte meiner Jahresendauszahlung zu
unterstützen. Ich versprach, wenn ich eine starke Antwort erhielte entsprechend
zu handeln.
Zunächst ereignete sich
diesbezüglich nichts.
1957 bescherte uns nicht nur
einen kalten Sommer, sondern auch klägliche Herbstfänge und folglich der
Buchhaltung großes Pech. Obendrein trösteten die wortführenden Männer sich
mit allzu schädlichen Mitteln. Ich sah nun auch meine Fischerzukunft am
seidenen Faden hängen. Mitten in diese miese Situation hinein, schenkte mein
Vater Wilhelm meiner Familie einen besonderen Urlaub in der Schweiz. Den hätte
ich uns in den Jahren seiner Krankheit verdient. Wir hatten, schon ein Jahr
zuvor erfreut vernommen, dass unsre Kirche in der Schweiz einen Tempel
eingeweiht hatte. Nur auf Bildern konnten wir das schöne Bauwerk bewundern. Ich
nahm Urlaub und Erika war hoch erfreut.
Erster Tempelbesuch
Über Frankfurt am Main ging es
nach Darmstadt. Dort legten wir einen Zwischenaufenthalt ein. Wir mussten zum
Einwohnermeldeamt gehen, um die Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik
Deutschland zu erwerben. Genau das wusste auch die Stasi. Aber noch konnten sie
dagegen nichts unternehmen. Noch standen die Grenztore offen. Mit unserem
DDR-Pass hätten uns die Zöllner nicht in die eidgenössische Schweizer Republik
einreisen lassen. Zu meinem Erstaunen lief alles problemlos ab. Ich vermute,
einige Formalitäten wurden vorab geklärt. Binnen einer halben Stunde erlangten
wir eine zweite deutsche Staatsbürgerschaft. In diesen dreißig Warteminuten
schaute ich mich um. In diesen Büroräumen hingen flächendeckend Steckbriefe von
Mördern, Sie suchten zudem 18 namentlich bekannte Schwerstverbrecher. Ich
dachte, du großer Himmel, was für eine Welt. Was wird uns die Zukunft noch
bescheren?
Die zunehmende Verstädterung der
Gesellschaft entfremdet die Menschen voneinander. Während des Wartens dachte
ich, in diesem Zusammenhang, auch an die Pläne und Lehren des von zahlreichen
Großkirchen verfemten Joseph Smith. Sein Plan war allen Familien 2 000 qm Land
als „ewiges“ Erbteil zu übergeben, um dort ihr Wohnhaus zu errichten und den
Rest zur Selbstversorgung zu nutzen. Keine Stadt sollte mehr als 20 000
Menschen haben. Nicht wenige spotteten. Aber wie sehr sie damit im Unrecht
lagen wurde erst sehr viel später deutlich. In solchen Siedlungen kennt jeder
nahezu jeden. Das musste sich positiv auswirken!
Damals konnte ich natürlich noch
nicht ahnen, dass die „Datschenpolitik“ in der Sowjetunion, die ab Stalins Tod,
1953, sich quasi zunehmend als Retter in der Not erwies. Offizielle Statistiken
belegten bald, dass, diese 600 qm pro Familie, die ihnen der Staat zugestand,
die Hälfte aller Gemüse- und Obstarten des Riesenlandes produzierte.
Als wir uns im Gemeindeheim der
Darmstädter Mitglieder meiner Kirche versammelten, überreichte mir der dortige
Hausmeister einen Brief Walter Rohloffs (Erikas Jugendfreund da sie im selben
Haus groß wurden, und der nun in Utah lebte) „Lieber Gerd, liebe Erika, der
Mann der euch diesen Brief aushändigt übernimmt umgehen eine bessere Stelle. …
Geht nicht zurück zu den Kommunisten. Wenn ihr vom Tempel heimkehrt bleibt
in Darmstadt… ich bereite alles vor, dass Ihr ein Jahr später auswandern
könnt…“ Der Gedanke, USA-Bürger zu werden erschien mir überaus verlockend.
Doch Erika widersprach: „Ich lasse meine Mutter, nicht im Stich…“ Ich musste
auch zurück an den Sommer 1952 denken. Damals besuchte Präsident David O. McKay
Berlin. Wir ostdeutschen Mitglieder vernahmen seine direkt an uns gerichteten
Worte: „Bleibt in den Gemeinden in denen ihr wohnt. Bemüht euch die Kirche
dort aufzubauen. Ich verspreche euch, ihr werdet euere Kinder nicht an die dort
wortführenden Ideologen verlieren, wenn ihr selbst treu seid und eure
Familiengebete pflegt.“ Wie sehr er Recht haben solle. So reisten wir
weiter, Richtung Süden, im Bewusstsein DDR-Bürger wider Wunsch und Willen zu
bleiben.
Wir kamen mitten in der Nacht in
Zollikofen an. Am Morgen sahen wir noch
nichts von den ragenden Bergen, denn es regnete. Ich ging in den Tempel, fast
wie ein Analphabet in die Schule. Das Interieur im Eingangsbereich entsprach
dem eines Luxushotels. Dieser helle, riesige dicke Teppich, diese wunderbaren
Möbel, Sessel, Stühle und Tische. Große Blumenpracht. Es verschlug mir fast die
Sprache, es war mir zugleich angenehm und fremd. Diese ausgesuchte
Freundlichkeit der in völliges weiß gekleideten Tempelarbeiter die uns, den aus
dem Osten angereisten siebzig Mitgliedern, entgegengebracht wurde. verstand ich überhaupt nichts. Hauptteil
war das sogenannte „Endowment“, die Begabung. Zunächst war da, für mich, kein
eigentlicher Höhepunkt, keine Manifestation höheren Geistes. Aber da war dennoch
etwas, das mein Leben lang bei mir blieb, die Gewissheit, dass es mehr nicht
geben kann, nicht diesseits. Wir wurden
alle in ein Garment gekleidet. mit Zeichen versehen, getragen als Unterwäsche.
Und, es war ein reales, wenn auch unsichtbares Samenkorn, das in uns gesenkt
wurde, dem das Potential innewohnt unentwegt dem Licht entgegen zu wachsen.
Das ahnte ich bereits während der
damaligen Tempeltage. Mir kam während
der Rückfahrt in den Sinn, dass ich Berichte von abgefallenen Mitgliedern und
ausgesprochenen Mormonenfeinden gelesen hatte. Sie sprachen verächtlich von den
Tempelsymbolen, Zirkel und Rechteck. Das sei, sagten sie, wie das ganze
Tempelritual, geklautes Gut aus dem Vermächtnis amerikanischer Freimaurer.
In der Tat, die Maurer besaßen
Ähnliches. Joseph Smith selbst war wie die engsten seiner Führungsebene,
Meister der Loge zu Nauvoo. Ich fragte mich in jener Nacht: „Woher stammt es
wirklich?“ Ich gelobte mir das herauszufinden. Kommt es aus dem Tempel
Salomos? Und ist es vielleicht noch älter? 40 Jahre später sollte ich
entdecken, dass diese Annahme unumstößlich korrekt war.
![]()
HLT
Tempel Zollikofen Schweiz
1994 las ich Albert Champdors
Werk: „Das ägyptische Totenbuch“. 60 Elemente fand ich, die sich mit den
Hauptaussagen des mormonischen Tempelrituals in erstaunlicher Übereinstimmung
befanden. Noch wichtiger war für meine Familie, dass wir im Tempel nicht nur
für Zeit, sondern für ewig, aneinander gesiegelt, (aneinandergebunden) wurden,
was unverbrüchliche, eheliche Treue voraussetzt. Während wir durch die Nacht von einem D-Zug
mit hoher Geschwindigkeit wieder Richtung DDR befördert wurden, sah ich im
Geist den von Scheinwerferlicht angestrahlten weißgold leuchtenden
Schweizer-HLT-Tempel. Erst jetzt leuchtete es auch in mir, die Erinnerung an
das Ungewöhnliche des Erlebten. Etwas das ich jedem gönne.
Und da hatte sie uns wieder, die
DDR-Realität. Und die war, verglichen mit dem Schweizer Lebensstandard
schrecklich mager.
Wieder ging es hinaus auf den
geliebten, immer noch geizigen Tollensesee.
Eines Morgens begegneten wir, an
der Einfahrt zum Oberbach, wo alle Boote sehr langsam fahren mussten, Herbert
Maque. Er kam mit seinem Flitzer bis auf zwei Meter Entfernung zu uns heran.
Ich stand auf dem Deck des donnernden Kutters. Er schaute mich mit weit
aufgerissenen Augen grimmig an und sagte mit lauter Stimme, damit es jeder
meiner Kollegen hören sollte: „Da habt ihr nun den Teufel an Bord!“
Wie sich später erwies, hatten
sie nicht den Sinn dieser Anklage verstanden. Sie winkten ihm fröhlich zu, als
hätte er sie gegrüßt. Ich jedoch wusste:
Jetzt hat er die kaputte Vierergig entdeckt. Kein anderer als ich kam für
dieses Verbrechen in Frage.
Fritz und Genossen
Schon Ende Oktober 57 bemerkte
Buchhalter Voß lapidar: „Männer, wenn kein Wunder geschieht, sind wir
Weihnachten zahlungsunfähig!”
Die nach dieser Warnung folgenden
Fangversuche, mit dem großen Zugnetz auf den kleinen Landseen und der Lieps,
waren so gut wie erfolglos geblieben.
Hastig ging es zu. Wir stolperten und liefen hinter den Traktoren
anliegender Genossenschaften her, da sie unsere Kähne über wegloses Gelände
schleppten, oft bis zum späten Abend, um den nächsten See zu erreichen.
Aber die Schwerstarbeit wurde
nicht belohnt. Erschöpft schlief ich wieder unruhig. Wer weiß wo sich die
Fische versteckten. Es gab sie doch. Vorsitzender Bartel verkniff das Gesicht.
Er zeterte mit denen die laut stöhnten:
Mensch Leute, wer bloß auf den Augenblickvorteil starrt, der darf sich
über kärgliche Ernten nicht wundern: „Ich habe schon vor Jahren mehr Aal-
und Hechtbrut kaufen und in die Gewässer einsetzen wollen.“ Aber das hätte
er nur tauben Ohren gepredigt. Seit eh und je habe er befürchtet, dass der
Pleitefall eintreten könnte.
Nur die Camminer Seen,- die seit
kurzem unsere waren, weil der Staat Kurt Meyer die Möglichkeit einer weiteren
Bewirtschaftung entzog,- zeigten sich freigebig. Für die dort angelandeten
Qualitätsfische Zander, Hechte und Schleien erhielten wir fast fünftausend
Mark. Das jedoch reichte nicht hin die Löhne zu zahlen und die Kosten zu
decken. Und nun stand der Dezember vor der Tür und damit die Gefahr, dass die
Seen zufroren, die erst wieder betreten werden konnten, wenn der Eismantel
dicker als 5 Zentimeter war. Dann kann
man das große Garn in einem entsprechenden Loch versenken und per Leinen wieder
in gewisser Entfernung herausziehen, meisten dann allerdings erfolgreich. Unter
der Eisdecke, besonders bei Schneebedeckung, sind die Fische blind.
Geräuschvoll trieb der Nordwest
an diesem düsteren Dezember- Nachmittag, die ersten Schneeflocken vor sich her.
Das Jahr war gelaufen.
Aus.
Die Genossenschaft war pleite.
Für diesen Tag war ohnehin eine
Schulungsrunde angesagt, weil wir es anscheinend nötig hatten auf die von der SED
vorgezeichnete Linie gebracht zu werden. Die beiden Bezirksfischmeister
Jochim und Stöckelt werden uns daneben die Leviten lesen.
Ich sah Fritz Biederstadt
ankommen.
Wie ein Treidler gegen das Seil,
stemmte sich der untersetzte, nun gut fünfzigjährige Fritz Biederstaedt gegen
den Wind. Stoßweise zerrte der Sturm an seiner grauen Schiebermütze.
Seine Joppentaschen verrieten,
dass er zwei Schnapsflaschen mit sich trug. Die Männer der Kernmannschaft
legten immer zusammen. Dafür reichten die Pfennige allemal. Ich ahnte, wie die
Frauen sie hinterher ausschimpften.
Das zum Überleben Notwendigste
konnte man zum Glück einigermaßen billig erwerben. Und dann brachten wir
Fischer ja oft, selbst nach mageren Fängen, Barsche und andere Fische heim, aus
denen die erfahrenen Ehefrauen wunderbare Mahlzeiten zubereiten konnten. Vieles gab es immer noch nur auf Vorlage der
monatlich ausgegebenen Lebensmittelmarken, deren Abschnitte, von den
Verkäufern, wohl aufbewahrt wurden. Pro Person 1380 g Fleisch, - 46 g pro Tag,
- 815 g Fett und zweieinhalb Pfund Zucker im Monat.
Wer mehr haben wollte, musste es
kostspielig in den HO-Läden einkaufen.
Meine Mitfischer murrten seit
Monaten und ich hörte dann nur schweigend zu: So viel Arbeit für so wenig Lohn.
Der SED - Staat war ihrer Meinung
nach der Hauptschuldige an ihrer Armut, Er gab ihnen für viele wertvolle Fische
zu wenig Geld.
Tatsächlich trachteten die Finanzexperten der DDR -
auf Weisung des Politbüros der SED-Regierung - danach, das Preisniveau der
Löhne, Mieten und Nahrungsmittel auf dem Level des Jahres 1937 zu halten. Das
konnte nicht funktionieren.
Meine Kollegen verteidigten sich,
als sie getadelt wurden, zu wenig unternommen zu haben, so hätten sie sich das
Leben in der Binnenfischerei, mehr als 10 Jahre nach dem Kriege, nicht
vorgestellt. In den langen Monaten Dezember, Januar, Februar, März lebten sie -
und nun traf es auch mich - von Vorschüssen, die wir im kurzen Frühling und
Sommer wieder abzahlen mussten. (Manchmal ließen die Verhältnisse das Fischen
nicht zu.) Dieses Teufelsloch war groß und die Hoffnung, da endgültig
herauszusteigen, klein. Die Bauernbank gab ungern Kredite für Löhnung: “Warum
investiert ihr nicht? Warum dies nicht, warum jenes nicht?” So hieß es bei
den Bankern. Lieber rannte Fritz Biederstaedt dann, in seiner Eigenschaft als
zweiter Vorsitzender der Genossenschaft, zum Steuerberater Hermann Köppen, der
sich auch als Geldverleiher hervortat. Köppen nahm zwar höhere Zinsen, doch er
meckerte ihn nicht an. Von Seiten der Bank lautete die Predigt: „Genosse
Biederstaedt, da stellen sie zuerst mal ein Konzept auf, wie sie die
Rückzahlungsraten einschließlich der drei Prozent Zinsen pünktlich leisten
wollen.”
„Ück bün (ich bin) aber kein
Genosse”, (kein Parteimitglied) pflegte er sich vor dem Bankchef
kopfwiegend zu entschuldigen. Beim Geldmann Köppen ging das wesentlich
kultivierter zu: „Prost, Herr Biederstaedt, auf gute Zusammenarbeit!” Dieser Mensch wusste, was sich gehörte.
Aus dem Kognakschrank holte der
höfliche Geldverleiher stets das Beste. „Wohlsein, Herr stellvertretender
Vorsitzender! Sie werden das schon machen. Sechs Prozent sind für sie doch
keine Hürde.”
Diesmal jedoch sah er sich
genötigt bereits im Dezember bei Herrn Hermann Köppen anzufragen.
Blödes Wetter!
Die sechs Prozent Zinsen seien
keine Hürde, aber der verdammte Nordnordwest hatte die Fische in unerreichbare
Seetiefen gejagt. Was den Tollensesee betraf konnten, mit den verfügbaren
Mitteln, ohnehin allenfalls 5 Prozent der Seefläche befischt werden. Was soll
ein Fischer, wie Biederstaedt, unter solchen Umständen anderes tun, als
abwarten und sich dieses Abwarten auf möglichst angenehme Weise verkürzen?
Nämlich da drinnen in der Holzbaracke, wo seine Mitfischer ihn und das, was er
mit sich trug sehnsüchtig erwarteten.
Als Fritz um die letzte Ecke
seines Weges bog blieb er stehen, als hätte er einen kleinen Schlaganfall
erlitten. „Düwel uk!“ („Teufel auch!“)
Das hatte er vergessen.
Der wahre Grund für seine
Vorahnung war klar: Er würde zum Hauptschuldigen erklärt werden, wegen seiner
permanenten Anstiftung zur Trinkerei. Der fast brandneue F 8 des Bezirksrates
verriet, was ihn nun erwartete! Er, der zweite Chef, hätte bei der angesetzten
Besprechung pünktlich zur Stelle sein müssen und dann lammfromm zuhören sollen
und müssen! Wo er so spät herkäme, werden sie ihn fragen. Ob es Wichtigeres
gäbe als eine politische Lektion?
Ausgerechnet er, der aus dem politischen Gefängnis entlassen wurde,
musste weitergebildet werden.
Ja, sie ließen ihn 1946
einsperren, nachdem er mit einem, von Soldaten des Zweiten Weltkriegs
weggeworfenen Revolver in der Liepser Wildnis auf Wildschweinjagd gegangen war,
bis einer aus seinen eigenen Reihen ihn verriet. Niemand sonst wusste, dass er
die Waffe in einem Suppentopf seiner Küche versteckt hatte. Fritz hatte das
verbotene Ding gerade geputzt, als die Sowjetpolizisten hereinstürmten…
Aber der Kommunistenchef
Ostdeutschlands Wilhelm Pieck begnadigte ihn, sowie meine beiden Freunde 49.
Tapfer betrat Fritz den
verwahrlosten Vorraum zum Schulungs- und Kulturraum.
Doppelt werden ihm die beiden
Parteigenossen nun zusetzen, es wäre alles eine Frage des gesellschaftlichen
Bewusstseins. Und jetzt erst recht wird die alte Leierei losgehen: “Wann
wollt ihr endlich mehr für eure Zukunft tun? Ihr müsst mehr Satzfische kaufen!
Wo man nix reinsteckt, da kommt auch nix ‘raus! Jetzt ist
Karpfenextensivwirtschaft angesagt“
Lächelnd zwar, aber innerlich
ärgerlich, wird er ihnen die großen, grünlichgelben Zähne zeigen und es zum
Scherz ummünzen: „Ganz meine Meinung!” In Wahrheit aber möchte er sagen
und ihnen an den Kopf schmettern, was er wirklich dachte: „Lüd, woväl Geld
häm wie all de Johren tun Fenster rut, in den See rinner schmeten.” ("Leute,
wie viel Geld haben wir in all den Jahren zum Fenster hinaus und damit in den
See hineingeschmissen. Nämlich die teuren Fischsetzlinge)"
Natürlich war er ein Freund von
richtigen Besatzmaßnahmen. Aber, die fünftausend Mark für
die Maränen war auch solch ein Fall von sinnlos vergeudeten Finanzen.
Ein Glück, dass die beiden
Genossen auf Kosten des Rates des Bezirkes die Rechnung für ihre wahnwitzige
Idee bezahlt haben. Er dachte an die angeblich fünf Millionen winzigen
Brütlinge, die sie damals in ein Eisloch gegen alle Vorschrift in Ufernähe geschüttet
hatten, weil das Eis so brüchig geworden war. Laut Lehrbuch hätten sie über
tiefem Wasser in die Freiheit entlassen werden müssen.
„So lütt!”, sagte er mir
eines Nachts, als wir gemeinsam das schwere Netz heran kurbelten. Die winzigen
Dinger bestanden ja nur aus Augen. Wie wollten die da unten in der Finsternis
ihr Futter finden? Das sollte eine Beisatzmaßnahme sein?
Die beiden angereisten
Fischmeister Jochim und Stöckelt hatten schon vor Jahren Stock und Bein
geschworen, es sei hoch an der Zeit, den Tollensesee mit Maränen-Setzlingen zu
spicken, er brächte alle Parameter vor, die zur erfolgreichen Maränen-wirtschaft
führen würden…
Fritz hatte wiederholt den
Zeigefinger an die Stirn gelegt: Was für ein Blödsinn!
Offensichtlich hatte er nun,
bevor er eintrat, die Flaschen irgendwo versteckt.
Ernst Stöckelt, der erst gut
dreißigjährige, unterbrach seine offizielle Rede. Sein schwungvoll geformter
Kopf ruckte herum. Biederstaedt nickte ihm herzhaft zu, zog die Mundwinkel
herauf, ganz verbindlich, ganz der Alte, der nicht verlernt hatte, wie ein
Diener seinem Herrn in einer kritischen Situation zu gefallen wusste. Er zog unnachahmlich seinen beachtlichen Bauch ein und
zwängte sich durch den engen Spalt zwischen der grauen Zimmerwand sowie den
vier Rückenlehnen der Stühle des Buchhalters, Bartels und der beiden
Bezirksfischmeister. Da musste er partout durchschlüpfen, weil er unbedingt
seinen Stammplatz neben Otto Görß einnehmen wollte, der auf der
entgegengesetzten Tischseite saß.
Er hätte ja auch auf der
Türschwelle, neben mir, Platz nehmen können. Während er sich so durchkämpfte,
ruhten aller Blicke auf ihm, wenige missbilligend, die anderen amüsiert. Das
genoss er. Erst vor vierzehn Tagen hatten ihn beide, Reiniger und Bartel, zusammengestaucht.
Sogar sein Freund Otto Görß war ihm grob über den Mund gefahren. Da hatte er
nämlich in Neverin, nachdem sie einigermaßen erfolgreich den Dorfteich
abfischten, heimlich einige Kilo Karauschen gegen eine kleine Flasche
hochprozentigen “Bärenfang” eingetauscht. Weil ihm doch so jämmerlich zumute
gewesen sei und er gefroren habe, indessen er auf sie warten musste. Bis sie
endlich mit dem Fuhrwerk herankutschiert kamen, hätte er sich berechtigt
gesehen, etwas gegen die ihn anschleichende innere Kälte zu unternehmen. Der
Fehler bestand darin, dass nur für Otto ein kläglicher Rest übrigblieb. Das
bekamen die Benachteiligten mit. - Großes Wehgeschrei. Bei solchen Sachen
kannten sie kein Pardon. „Uns hat auch gefroren!” Das musste er
in deftigem Platt- und Hochdeutsch hören. Als Brigadier sei er abgesetzt.
Wenn er sich Ähnliches noch ein
einziges Mal erlaube, dann sei es endgültig aus mit seiner Herrlichkeit als
stellvertretender Chef.
Ich sah es voraus, die beiden
Bezirksmeister werden nun vorrechnen, dass sie die Anzahl der Fänger reduzieren
müssten.
Das konnte nur bedeuten: Ich fiele durch die Maschen, wie ein kleiner
Fisch. Sich sammelnd kratzte Ernst Stöckelt den Charakterkopf. Er fragte die
Tollensefischer, was sie denn wollten? Niemand könne mehr Lohn bekommen, als er
durch entsprechende Gegenleistung verdient hätte. So funktioniere die
Wirtschaft eben. Man kann aus einem Topf nur herauslöffeln, was da drin ist.
Ihr fangt nur einhundert Tonnen! Das sei entschieden zu wenig bezogen auf
dreizehn Fänger. Das sei umgerechnet auf die Wasserfläche all ihrer Seen knapp
ein Drittel des Machbaren! Fritz Biederstaedt kniff die
Augen zu.
Doch da war es wieder, das alte
böse Thema, der Unwert der DDR-Mark.
Stöckelt sollte es lieber ruhen
lassen.
Sah er denn nicht, wie es in den
Gesichtern der Fischer Reiniger zuckte? Otto Görß hob denn auch sofort den
Kopf: „Und de Kasernierten? Und de Aktendaschendräger?” ("Und
die Kasernierten (Polizisten die nichts taten, gar nichts und die
Aktentaschenträger?") Wofür die ihre horrende Summen Gehalt bekämen? Ihren
Funktionären hätte der Staat große Suppenkellen in die Hand gedrückt und den
Arbeitern bloß Teelöffel.
Wie eine verdroschene Pauke
vibrierte die ungeheure Anklage.
Otto ebenfalls in seinen dreißiger Jahren, war
nie feige, jedenfalls nie besonders vorsichtig gewesen, wenn jemand ihn nötigte
seine Meinung in Sachen Politik zu sagen. Unverbildet wie er war, sagte Otto,
so gut wie immer was er dachte. Das bedeutete, ich mag euch Kommunisten nicht,
weder eure Macht- noch eure Wirtschaftspolitik. Ihn stinke an, dass die
Zeitungen kaum von dem berichteten, was ihn interessiere. Als Vater von fünf
Kindern sperrten sie ihn nicht so leicht ein. Ottos weiße Wangenknochen
schimmerten durch die dünne Haut.
Er selbst sollte schuld daran
sein, dass er sich für seine dreihundert Mark monatlich, nur das
Unentbehrlichste kaufen könne? Sein Vater hätte vor dem Kriege,
einhundertundachtzig verdient, aber es sei für ihn als Kind hin und wieder ein
Stück Schokolade abgefallen. Das könne er seinen Kindern nicht bieten. „Disser
Stoot is nich fehig, blot luder Beamte un Pulezisten.” ("Dieser
Staat ist nicht fähig, bloß lauter Beamte und Polizisten!") Obermeister
Eduard Jochim, der sanfte Mann, rutschte unruhig auf dem Stuhl umher.
Ungestraft durfte sich niemand, in
seiner Anwesenheit als Staatsbeamter herausnehmen, den Arbeiter- und
Bauernstaat zu attackieren!
Otto wies die Finger seiner
Rechten vor. An ihnen zählte er noch einmal die Ursachen für die Teuerung auf.
Es gäbe schließlich zu viele Schmarotzer in diesem Staat der Politkarrieristen.
Ein übergroßer Polizeiapparat sei
das Kennzeichen eines faschistoiden Staates. Aua, das zu hören, tat den
Angereisten weh.
Eduard strich nervös über seinen
kahlen Kopf.
Vielleicht saß unter den dreizehn
einer der ihn anzeigte. Irgendjemand könnte schon am nächsten Morgen im
Auftrage irgendjemandes in seinem Büro in Neustrelitz auftauchen, seinen
Dienstausweis zücken oder die ‚Hundemarke’ vorweisen und sagen: ‚Kommen Sie
mal mit, Genosse Jochim. Wir müssen mit Ihnen über das Gesetz zum Schutze des
Friedens reden. Sie haben Ihre Dienstaufsichtspflicht verletzt. Man lässt den
Klassenfeind nicht zu Worte kommen. Schon gar nicht in einer öffentlichen
Versammlung.“
Fest stand, ein einziges Wort
gegen den DDR-Staat gerichtet konnte selbst einem Familienvater von bald sechs
Kindern fünf Gefängnisjahre kosten.
So das Gesetz. Otto Görß ließ
dennoch nicht ab.
Diesmal nicht!
Um seinen nun harten Mund zuckte
es spöttisch.
Außerdem sei nicht nur er
ärgerlich: Das erste neu errichtete stattliche Gebäude in der Neubrandenburger
Innenstadt, die weithin in Ruinen lag, war das der Polizei gewesen. Ein großes
Wohnhaus oder Altersheim wäre wichtiger gewesen. In breitem Mecklenburger Platt
sagte er das.
Stöckelt schaute streng herüber.
Warnend waren diese Blicke
gemeint. Sie bedeuteten dem Furchtlosen: Warum er immer wieder den Bogen
überspannen müsse? Das sei doch kein Geheimnis, dass er jeden Samstag sein
Aaldeputat verscheuere - jene knapp drei Kilogramm die sich fast alle Fischer Mecklenburgs
selbst zuteilten, was stillschweigend von oben geduldet wurde und wofür sie nur
zehn Mark Steuern bezahlen mussten...Das könne nun durchaus Folgen haben.
Biederstaedt räusperte sich. Stöckelt ließ ihn nicht zu Wort
kommen. Mit nun brüchiger, wenn auch gedämpft klingender Stimme, fasste er zusammen:
„Erfüllt erst mal euer Soll, dann reden wir weiter!” Damit war alles Wichtige gesagt. Doch er war noch nicht
ganz am Ende seiner vorbereiteten Rede angelangt: „Die Mannschaft ist zu
groß! Fünf, mindestens vier müssen raus!" Da war es! Das von mir erwartete,
endgültige. Alle
Männer schwiegen aus Entsetzen und aus Gründen der Vernunft.
Ich, die verkrachte Existenz,
fliege als Erster hinaus
Nächsten Freitag erwarte er
Bericht, sagte Stöckelt, der Adjutant Jochims, und so fuhren sie davon.
Bartel erklärte, die Sitzung sei
nicht geschlossen, „der Vorstand zieht sich zur Beratung zurück!“
Sie gingen zu dritt ins „Büro“, ein Verschlag
von knapp drei mal drei Metern, Bartel, Görß und Biederstaedt. Ich ging hinaus
und blickte auf den ruhig fließenden breiten Oberbach: Das war es.
Was jetzt? Abenteuer Fischfang war für mich wie erlaubtes Vabanquespiel
gewesen. Ich liebte es. Deshalb
war für mich die Tätigkeit in der Fischerei, nebst den Berufswünschen, die sich
zerschlagen hatten, für mich das Beste.
In dieser langen Beratungspause
des Fischereivorstandes ging mir mancherlei durch den Kopf. Ich war und bin für
das Zusammenarbeiten der Menschen in Genossenschaften. Gerade in einer
Genossenschaft - nicht in einem volkseigenen Unternehmen - in welchem die
Gewinne restlos an den Staatshaushalt abgeführt werden mussten, konnte ein
Großfang oder beständig bessere Fänge allen Beteiligten richtigen Wohlstand
bescheren.
Ich sah sie dann aus dem
Nebenraum kommen.
Den Mienen konnte ich ansehen,
dass in der internen Runde die Würfel gefallen waren.
Biederstaedt und Görß kamen auf
mich zu.
Sie schauten mich sehr freundlich
an: Du bleibst!
Einstimmiger Beschluss.
Ausgerechnet die vier
Nichttrinker traf es.
Neumann, Milster, Sablotny, Müller. Fast ihr ganzes
Leben hatten diese vier als Fänger zwischen offenem Himmel und bewegten
Wassermassen zugebracht.
Aus, - das
war das abrupte definitive Ende! Mit einem Mal
wurden sie für immer an Land gesetzt. So sahen sie auch aus, als sie das Urteil
entgegennahmen, wie unglückliche Seevögel, die besser schwimmen als laufen
konnten. Für die vier über Fünfzigjährigen erhob sich damit dieselbe Frage, die
mich schwer bedrückt hatte.
Selbst wenn ich freiwillig
verzichtet hätte, wäre nur einer gerettet worden. Doch
welcher Name folgte als fünfter? Das stünde noch offen. Von einem Tage zum
anderen verloren vier Prachtkerle ihren Traumberuf. Auch Kurt Reiniger der
Westflüchtling durfte bleiben.
Ich sollte die Camminer Fischerei
übernehmen.
Ich verbiss mir jegliche
Erwiderung. Nein, nicht Cammin.
All das verbarg ich vor Erika,
aber ich versprach ihr: Jetzt muss ich mehr tun. Sie umarmte mich. Sie glaubte
an mich.
Der
wilde September
Zunächst lief es gut. Mir wurde
gestattet weiterhin den Tollensesee unter Gräfs Regie zu befischen. Gräf
erkrankte, Biederstaedt setzte Stellnetze auf dem Barschberg. Damit waren wir
führungslos. Wir versuchten unser Bestes, doch die Resultate blieben mäßig. Da
überraschte uns der September 58 mit starkem Südwestwind. Er blies und blies
und hob Wellen bis auf gefühlte Dreimeterhöhen, wegen des schluchtartigen
Charakters der Umgebung in welcher der See lag.
Das ertrugen die morschen Boote
allesamt nicht. Dabei sollte der Monat September stets der Beste für die
Zugnetzfischerei sein.
Es vergingen mehrere Tage der
Untätigkeit. Wir durften nicht riskieren durch die Brandungszone zu fahren.
Wieder nahm meine Unruhe zu.
„Du wälzt dich, statt zu
schlafen. Was ist passiert.“
„Nichts, Erika meine Beste!“
Ich fasste in dieser Nacht zwei
Entschlüsse:
- gegen den Willen des
Vorsitzenden möchte ich die Fischereischule in Hubertushöhe besuchen
-
und ich werde vier Freiwillige finden die mit mir durch die
anscheinend unerbittliche, sogar zunehmende Brandung fahren um am südwestlichen
See-ende das Zugnetz einzusetzen.
Den Booten kann nichts passieren,
wenn ich sie auf meine Weise hintereinander verbinde. Manchmal muss man vom
Üblichen abweichen.
Am nächsten Morgen wehten die
Pappeln wie immer verwegen.
Bartel sah, dass Witte und ich
die Arbeitskähne bestiegen. Er stand die Hände in die Hüften gestemmt am
Bollwerk, schmockte wie immer sein Tabakinchen. Nur kurz nahm er aus den Lippen
heraus: „Ich verbiete euch rauszufahren!“ Das sei Wahnsinn. Ich hätte ja
keine Ahnung.
Vier weitere Männer um Hermann
Witte nickten mir dennoch zu. Eigentlich hätte Meister Hermann Witte mir
Berufsfremden vorgesetzt sein sollen, aber er ordnete sich freiwillig unter -
bis ich, vielleicht einen größeren Fehler begehen würde. Wir beluden die
Fangboote mit dem großen Garn. Es war ein Umfassungsnetz von zwei Flügeln von
je 300 m Länge bei einer Netzhöhe von 13 Metern. Ich gewann Wittes Unterstützung sofort, nachdem ich ihm meinen
Plan erklärte: „Wir lassen die Arbeitsboote nicht nebeneinander laufen!“ (weil der Sack in dem sich die Fische zuletzt
befinden mittig angeordnet ist), sondern die ganze Fuhre würden wir durch Seile
verbinden, so dass Beiboote und Arbeitskähne hintereinander laufen. Wir werden,
um den Starkwellen widerstehen, je fünf Meter Abstand von einem Boot zum
anderen halten. Dann können sie schaukeln wie sie wollen, der Sturm hält sie
auf Kurs.
Bartel ballte die Faust, als er
unsere Entschlossenheit sah.
Er wusste, dass ich der treibende
Keil war: „Ich mache dich darauf aufmerksam, dass du gegen meinen Willen
rausfährst. Ersäuft das Ganze bis du Schuld. Säuft ein Kahn ab oder zerbricht
er, haftest du!"
Kurt Reiniger übernahm das
Steuerrad. Auch er sah keine andere Chance zu mehr Geld zu kommen.
Als wir den Oberbach verließen
und in den Meterwellenbereich kamen trafen uns einige harte Schläge.
Zu fünft befanden wir uns in der
dunklen Kabine. Wir wussten, selbst die heftigsten Schläge können, durch das
faustgroße Loch am Kutterbug, nicht mehr als einen Eimer Wasser pressen. Kurt
Reiniger stand gelassen da. Sein Faltengesicht blieb ruhig. Er hatte, als
Soldat der Fliegerabwehr, schon Schlimmeres erlebt. Nach wenigen Minuten sehr
langsamer Fahrt in denen wir beständig die Blickrichtung wechselten, sahen wir,
dass wir bei knappem Schritttempo immerhin noch alles in Ordnung fanden.
Natürlich konnten man nun schon dreihundert Meter hinter der Brandung, das
letzte Boot entweder oben auf dem Wellenberg sehen oder gar nicht.
Nach einer viertel Stunde schien
es so, als hätten wir es geschafft. So war es. Oben, nach zweistündiger Fahrt
im Schritttempo am See-ende, angekommen stellten wir fest, wie die hohen
Pappeln die Gewalt des Windes auf den letzten drei- vierhundert Meter völlig
brachen. Das Zugnetz wurde wie üblich ausgefahren. Die mit kleinen Rundsteinen
bestückten Unterleinen zogen das Netz herunter, während die synthetischen
Schwimmer es in die Höhe zogen. Uns umgab tiefster Friede. Wir seilten jeweils
zweihundert Meter Drahtseil ab, ankerten am Schilfgürtel warfen die kleinen
Motore an. So wurden die Flügel herangezogen. Dann ruderten wir wieder zusammen
um den Kreis zu schließen
Was uns verwunderte: Der See ist
mit solchem Sturm in heftiger Bewegung; dann wird das Netz mit der Strömung
fortgerissen. Doch hier herrschte sonderbare Bewegungslosigkeit.
Als hätten die Urgewalten
kapituliert holten wir nun das Netz zurück in die Kähne. Schon bald zeigten
sich größere Fische auf den Seitenflügeln. Dann immer mehr. Aber noch wagten
wir nicht auf einen großen Fang zu hoffen. Doch dann erwies es sich: Wir hatten
5 Tonnen Fische erster Qualität überlistet, Hechte, große Barsche, Schleie,
sowie erste Klasse Plötzen (Rotaugen), die damals noch in Berlin gefragt waren.
Der brüchige Kutter wurde randvoll gefüllt. Natürlich ließen wir die
Arbeitsboote vor Ort. So schnell würde sich die Windrichtung doch nicht ändern.
Falls doch hätte es, allem Fangerfolg zum Trotz, jene Konsequenzen die der
Vorsitzende mir angedroht hatte.
Es dunkelte bereits, als wir
heimfuhren, geschoben auch vom noch sausenden Sturm, diesmal ungefährdet. Nur
die Brandungszone noch. Dann hatten wir es vollbracht. Kurt Reiniger meisterte
es, durch geschicktes Manövrieren. Wir sahen Wilhelm, unseren Vorsitzenden, in
der Finsternis dastehen. Erkenntlich am Glimmen seiner unvermeidlichen
Zigarillo und dann den schwarzen Umrissen. Er wird durch schreckliche Ängste
gegangen sein, denn andere Produktionsmittel, als Ersatz für dieses Zugnetz gab
es nicht. Als der sieben Meter lange Kutter im Oberbach wendete und am
verfaulten Bollwerk anlegte, aber noch, während der knallende Dieselmotor lief,
schnarrte der Vorsitzende mich heftig an: "Wo sind die
Arbeitskähne?"
Ich beruhigte ihn.
Dann mit einem federnden Satz
sprang er herunter und riss den ersten Schweffdeckel auf. Er ließ, aus freudigem Schreck, sein
Zigarillo aus dem Mund fallen, dann riss er den zweiten und den dritten Deckel
auf. „Fünf Tonnen!“ resümierte er.
Kein Wort mehr.
Loben durfte er niemanden.
Er fuhr davon, offensichtlich
verwirrt und zugleich erleichtert. Der Sturm hielt noch zwei weitere Wochen an.
Und wir fingen im Windschutz der Riesenpappeln vor Nonnenhof weitere
fünfundzwanzig Tonnen beste Fische. Der Buchhalten und meine Kollegen tätschelten
mir den Rücken.
Von dieser Zeit an, hat mich,
außer selbstverständlich Hermann Witte, niemand mehr wegen meines Glaubens
verspottet. Das war aus. Definitiv.
Wir hatten darüber hinaus mehrseitiges Glück. Das Blatt hatte sich gewendet.
Von diesem Zeitpunkt an landeten wir mehr und bessere Fische an, als zuvor.
Ich hatte ja das obligatorische
Fangbuch des letzten Jahrzehnts mit Kopfschütteln gelesen.
Nicht genug damit, ließ sich ein
Riesenschwarm sehr großer Brassen von uns fangen. Es war ein stiller
Oktobertag, und wir befanden uns zur rechten Zeit am richtigen Ort. Es war ein
stiller Tag. Der See lag wie ein Spiegel da. Schon als die ersten Meter des
Netztes eingezogen wurden, sahen wir einen auf zubewegenden Blasenteppich. Die stets
in Herden schwimmenden Bleie verrieten sich selbst und wir konnten sie
zurückscheuchen.
Die sächsischen Räuchereien
machten aus diesen nicht allseitig geschätzten „Plieten“ Delikatessen. Wer sie
einmal kostete, solange diese goldbraunen Fischstücke noch nicht älter als zwei
Tage waren, und gut gewürzt, der schwor auf sie. Selbst im goldenen Westen
hätten wir sie versilbern können. Solche Geschäfte zu machen,
Telefonate mit den „Klassenfeinden“ zu führen, waren undenkbar und unmöglich,
weil vom Staat verboten. Der Geschmack und der Nährwert dieser Fischart lagen
indessen hoch. Das wäre doch eine von zahlreichen Gegebenheiten gewesen Devisen
zu machen.
Als Fänger erzielten wir zum
ersten Mal einen beachtlichen Jahres-Überschuss, nämlich vierundzwanzigtausend
Mark. Das ergab eine Barauszahlung für jeden von 2400.-Mark. Was das bedeutet,
kann nur ermessen, der weiß, dass DDR-weit Spezialisten in der Industrie erst
seit Januar 1956 durchschnittlich 440 Mark monatlich verdienten.
Nun, da wir von jetzt an
fünfhundert Mark Monatslohn nach Hause trugen, begannen auch die ersten von uns
an mehr, und viel mehr an sich selbst und damit an eine Zukunft unter unseren
Umständen, zu glauben.
Und das „Saufen“ hörte auf.
Jetzt waren wir imstande neue,
und zwar synthetische Netzballen zu kaufen aus denen wir neue, größer Reusen
fertigen konnten.
|
|
|
Wikipedia: Drahtreuse |
Ich nahm die Lehren und Ideen
anderer dankbar auf und „baute“ riesige Fischfallen, mit deren Hilfe wir den
üblichen Gesamtjahresfang 20 lange Jahre hindurch stabil verdoppeln konnten.
Hermann Göck streichelte mir den Rücken, nachdem er mir manchmal seine Faust
unter die Nase gehalten hatte, weil ich partout nicht einsehen wollte, dass
seine Partei das Beste von aller Welt sei.
Neue Kleidung für die Familie und
bessere Möbel konnten wir uns anschaffen, nachdem wir 59 eine größere Wohnung
beziehen durften. Göck gab mir wiederholt den Aktivistenorden der immer auch
mit Geld verbunden war. Stasileute die wegen besonderer Fischwünsche in unsere
immer noch klägliche Baracke kamen, behandelten mich auffallend freundlich.
Stasi-Oberstleutnant Kindler und andere fanden plötzlich an mir Positives. Dass
ich nach wie vor offen die „Diktatur des Proletariats“ ablehnte, betrachten sie
nun als verzeihlichen Schönheitsfehler.
Sie wussten, dass ich meiner Kirche als Distriktmissionar eifrig und
gemeinsam mit meinem Fischerfreund Kurt Meyer, Cammin, mit gewissem Erfolg
diente.
In vier Jahren durften wir 4
Menschen taufen.
Die Offiziere des staatlichen
Überwachungsapparates wussten auch, dass ich niemals geheimen Aalhandel zu
meinen Gunsten machte, und, dass ich keine Affären hatte. Das erzählten sie mir
später.
Aber wehe denen die erwischt
wurden. Not machte sie zu Spitzeln.
Auf Umwegen erfuhr ich bereits
damals, dass die Stasi erstaunt zur Kenntnis nahm, dass die etwa 1 000 aktiven,
erwachsenen „Mormonen“, wo immer sie standen, gute bis hervorragende Arbeit
leisteten. Wir wollten nicht betrogen werden, also betrogen wir den Staat
ebenfalls nicht. Die ursprüngliche Annahme, wir stünden im Dienst des CIA
verblasste mit der Zeit. Nichtsdestoweniger blieben wir, was wir immer schon
sein wollten: Christusverehrende, bemüht seine Gebote zu halten. Den Ehrentitel „Christen“ sprachen uns nach
wie vor lediglich die großkirchlichen Theologen, aus Arroganz und Dummheit, ab.
Seit eh und je studierte und
analysierte ich ihre wichtigsten Publikationen. Man erinnere
sich nur ihrer Argumentationen, wenn sie die Lehren der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage bewerteten. Verwegen und ungerechtfertigt war ihr
Urteil und in sich widersprüchlich. Sahen sie nicht selbst welchen Unfug sie da
trieben?
Es war unangebracht zu posaunen: „Mormonen
sind keine Christen, denn sie lehnen das Nicänum ab. Sie verweigern die
Anbetung des dreieinen Gottes.“
Dass Theologen, bei diesem Stand
der Forschung das Nicänum zum Kriterium für das „Christsein“ erklären, beweist ihre
Inkompetenz. Außer in der Fantasie gewisser hauptamtlicher Kirchenvertreter gab
es, zu keiner Zeit weder Raum noch tragbaren Grund einer Anerkennung für den
„Triunen“, den dreifaltigen, trinitarischen Gott. Erstens weil er unerkennbar
und unerklärbar blieb. Und nicht nur das. Ich konnte, in Bezug auf die Gotteslehre,
nicht oft genug darlegen, dass die uns ungut gesonnen Frommen eigentlich
Leugner der „christlichen Wahrheit“ sind. Und das gaben sie kurioserweise direkt
in ihrem seit Jahrhunderten gebilligten „Athanasianum“ wörtlich auch zu. Man
muss es nur unter die Lupe nehmen. Es ist und bleibt ein haarsträubender
Grundwiderspruch:
Zu sagen: a) „wir (sind) gezwungen, in christlicher Wahrheit jede einzelne Person für
sich als Gott und als Herrn zu bekennen,“
und b) „der katholische Glaube verbietet uns, von drei Göttern oder Herren zu sprechen.“,
bleibt ein Unding für jeden, dem
die Wahrheit wichtiger ist, als irgendein Ding unter der Sonne.
Welcher
gläubige Aufmerksame konnte solche Torheit akzeptieren? Ich
hatte die Gelegenheit in Hubertushöhe bei Frankfurt Oder, mit einem alten
Jesuitenpater zu sprechen. Er war sehr freundlich. Er betreute die dort im
Kloster „Arme Schulschwestern“ lebenden, vielleicht dreißig Nonnen.
Er versuchte sein Bestes
darzulegen wie wir den Dreifaltigen Gott zu denken haben. Mit einem Stock malte
er Zeichen in den Sand. Aber es blieb dabei: Es gab niemanden der auch nur
annähernd erklären konnte, warum 1 und 1 und 1 gleich 1 war.
Darüber hinaus sah ich mit der
Zeit immer deutlicher, dass Katholiken und Protestanten neben ewigen Wahrheiten
zeitgleich ihr Gegenteil lehrten, indem sie jedem Menschen die Willensfreiheit
absprachen. (Noch hatte Rom sich nicht mit Vatikanum II von dieser Lüge
distanziert)
Nicht wenige Praktiken die
Kirchenangestellte übten, waren unvernünftig. Pfarrer und Pastoren wurden nur
versetzt, wenn sie fremd gingen oder Kinder verführt hatten, statt sie zu
exkommunizieren und in den Alltag zu schicken.
Ich hatte einen guten Freund im
westlichen Mecklenburg, dem von der EKD lediglich ein neues Arbeitsgebiet
zugewiesen wurde, nachdem zutage lag, dass er seine Ehefrau wiederholt betrogen
hatte.
Schade, ich verlor ihn aus den Augen.
Natürlich darf jeder und muss jeder Buße tun, nämlich jahrelang beweisen, dass
sich das Ungute nicht wiederholt. Wenn das geschah, darf der Übertreter wieder,
unter Bedingungen und angemessenen Auflagen, amtieren. Und dann: Das Evangelium
Jesu Christi ist ungeeignet, mit seiner Verkündung Geld zu verdienen. Eine
christliche Gemeinde zu leiten, und dafür finanziell entschädigt zu werden,
hatte bereits Hippolytos von Rom zu Beginn des 3. Jahrhunderts scharf
verurteilt. „Die „schismatische“ Gemeinde der Theodotianer in Rom zahlte ihrem
Bischof ein monatliches Gehalt. Das sei eine gräuliche Neuerung.“ Jungklaus,
Full Text of: „Die Gemeinde Hippolyts“
Was meine Kirche in theologischer
Hinsicht und bezüglich des praktischen Lebens vertrat sah für mich in jeder
Hinsicht vernünftig und obendrein wahr und schön aus, nachdem ich viele Jahre
kritisch hingeschaut hatte. Immer ging es darum glückliche Ehen zu führen
und allen Menschen gegenüber wahrhaftig, bescheiden und freundlich aufzutreten.
In mancherlei Hinsicht waren unsere religiösen Kontrahenten erstaunlich
desinformiert. Das ergab sich aus vielen Gesprächen die ich mit ihnen suchte
und erlebte.
Ein Neubrandenburger Pfarrer der
mich zu einem Gespräch eingeladen hatte, sagte nach zwei Stunden. „Es wir
keine weiteren Begegnungen geben“ das allerdings widerrief er Jahre später.
Im Oktober 1958 …
besuchte ich einen katholischen
Gebetsgottesdienst der Katholiken in Neubrandenburg. Geleitet wurde diese
Veranstaltung, an der fast ausnahmslos ältere Frauen teilnahmen, von Pfarrer
Timmerbeil, der, - nach Aussagen junger Männer, die sie mir gegenüber, von sich
aus machten, - ein Sadist war. Dieser Pfarrer war es auch, der mir nach kurzem
Gespräch verbot die Bibel zu lesen. Grob war er mir über den Mund gefahren.
Das Ave-Maria wurde mit seinen
Zusätzen pausenlos wiederholt. Wie sehr mich das an mittelalterliche Exerzitien
erinnerte. Die Statistiken ‚guter Werke’ wurden damals gewissenhaft geführt.
Das „Vaterunser“ - das zwar nur wenige Worte umfasst - wurde in manchen
Klöstern rund um die Uhr gebetet: Sieben Millionen Ave-Maria hatte „... die Bruderschaft der 11 000 Jungfrauen
auf Vorrat gebetet, dazu 200 000 Rosenkränze und 200 000 Tedeum laudamus, sowie
3500 ganze Psalter“ Gustav Freytag Deutsche Bilder 2
So gut es gemeint sein mag, das
besserte die Welt nicht, worauf es jedoch ankommt. Wenn Religion Menschen nicht
veredelt, dann taugt sie nicht...
Damals
lernte ich Jochen Appel kennen
Er war Mitarbeiter
der Bezirksmordkommission. Er fuhr später so oft wie ihm möglich war mit mir
als Hobbyfischer auf den See zum Fischfang hinaus. Für ihn wäre es besser
gewesen er hätte mich niemals kennen gelernt.
Denn
unsere Beziehung endete mit seinem Selbstmord meinetwegen. Nachdem wir
zueinander Vertrauen gefasst hatten, erzählte Jochen mir mehr über seine Arbeit
und ich gab meinerseits zu erkennen, warum ich schließlich als Fischer
arbeitete. Ganz gegen meine Gewohnheit erzählte ich ihm eines Tages einen der
in Frageform gepackten politischen Witze, die damals schnell jedermann
Allgemeingut wurden. Unglücklicherweise plauderte er ihn einige Wochen später
an denkbar unpassendster Stelle aus. Als Offiziersanwärter auf der
Polizeischule zu Gera hätte er besser den Mund gehalten. Die gefährliche
Spottfrage lautete “Was ist der Unterschied zwischen Walter Ulbricht und
einer Rakete? Antwort: Da ist keiner! Beide werden von Moskau aus
ferngesteuert!”
Vierzig
angehende Polizeioffiziere hörten es, während sie auf einem LPG-Acker den
Bauern halfen die Zuckerrübensaat auszudünnen. Gelacht hätten sie allesamt und
mehrheitlich der Sache keine Bedeutung beigemessen. Schließlich gab es
schlimmere Anspielungen. Diese zum Beispiel: Auf die Frage welche
Lieblingskomponisten er habe, hätte Chruschtschow geantwortet: "Liszt,
Händel und G(K)rieg!"
Einer
seiner Mitschüler zeigte ihn an. Augenblicklich wurde Jochen zum diensthabenden
Offizier beordert. Der Mann wies ihn scharf zurecht: “Genosse Appel, von einem
künftigen Offizier der Volkspolizei erwarten wir ein klares Bekenntnis zur
Arbeiter- und Bauernregierung! Wer hat ihnen diesen Schwachsinn erzählt?”
Meines
Freundes Versuch, sich auf eine ihm unbekannte Person herauszureden misslang.
Sie sahen seinen Augen an, dass er log. Meinen Namen hätte er nennen müssen, um
die Inquisitoren zufrieden zu stellen.
Jochen sah natürlich die Folgen voraus, falls er reden würde.
Er hätte
für einige Minuten ernstlich geschwankt. Denn es ging um nichts Geringeres als
um seine berufliche Zukunft. Allerdings stand auch meine Zukunft und die meiner
Familie auf dem Spiel. Bis zu fünf Jahre Zuchthaus hätten mich erwartet. Ob
Erika das überstanden hätte?
Er
dagegen wäre für den Freundesverrat sofort belohnt worden und zwar mit jener
Beförderung die der Petzer tatsächlich erhielt.
Ich saß,
nichtsahnend, in trügerischer Sicherheit. Als Jochen mir nur wenige Tage später
völlig rückhaltlos mitteilte was sich ereignet hatte, stockte mein Herzschlag.
In breitem mecklenburgischem Plattdeutsch beruhigte er mich jedoch: “Jung,
ick künn die nich veroden!” (Ich konnte dich nicht verraten) Er hätte mich
immer wieder vor sich gesehen, wie ich während der Fahrt auf dem See in meinem
Boot sitze und in der Bibel lese. (Dabei las ich auf dem See viel häufiger
Feuchtwanger.) Er hätte es einfach nicht übers Herz gebracht.
Sie
verhörten ihn gnadenlos. Sie drohten und schickten ihn weg von der Schule. Nun
war er gebrandmarkt. Mit welchen Gedanken und Gefühlen wird mein Freund, der
sich entschieden hatte mich nicht zu verraten, heimgefahren sein? Den Aufstieg
so nahe vor sich, auch den finanziellen Vorteil, zerrann seine Hoffnung wie Eis
in der Sonne. Mit wie viel Bitterkeit wird er die Ahnung empfunden haben, dass
diese dumme Geschichte für ihn noch längst nicht zu Ende war?
(Nach der
Wende erfuhr Jochens Ehefrau, dass ich die gesuchte Person war. Sie bestellte
mich zu sich. Sie atmete tief durch. Monatelang holten sie ihren Mann zu
nächtlichen Verhören. Nichts weiter wollten sie von ihm als den Namen dessen
der ihm den Witz erzählt hatte.)
Jochen
nahm sich schließlich das Leben, weil er die Qualen nicht länger ertragen
konnte. Auch das hörte ich erst später.
Die großen, alltäglichen,
gefährlichen Lügen – und eine große Wahrheit
Sogar für mich erhob sich
gelegentlich die Frage, ob sich der Kommunismus aufgrund seiner Gummitaktik
nicht doch allmählich durchsetzen könnte. Natürlich, immer wieder werden die
Spitzenfunktionäre zuerst Fehler begehen und begehen lassen, um unwiderrufliche
Tatsachen zu schaffen, die sie für erforderlich halten, danach müssen sie
irgendwelche Sündenböcke finden, die sie für die unweigerlich eintretenden
negativen Folgen verantwortlich machen. Chruschtschow tat es so. Das hörten wir von Westsendern,
aber nun standen auch in der DDR-Presse immer wieder Informationen die das
bestätigten.
Erst machte Chruschtschow mit,
wenn Stalin Kardinalfehler beging, etwa als der große Diktator, 1929, die
Kollektivierung der Landwirtschaft erzwang, was zu Hungerkatastrophen mit
Millionen Toten führte, dann als der Kremlchef sich nicht mehr wehren konnte
nannte Chruschtschow ihn den großen Sünder und Verbrecher. Stalin habe die
Hungertoten Russlands und der Ukraine zu verantworten. Oder, wie gesagt im Fall Lyssenko, der
„Wunderbiologe“ der Sowjetunion, der ebenfalls vermeidbare Missernten zu
verantworten hatte, weil er log. Aber die Misere wurde den schutzlosen
Befehlsempfängern angelastet. Eingesperrt und gefoltert wurden die absolut
Unschuldigen. Das war das Böse des
Systems, das wir gut finden sollten, aber nicht konnten. Am 2. Juni 1959
schrieb Dr. Lothar Bolz in „Neues Deutschland“: „Westberlin darf nicht
länger Pulverfass sein.“ Natürlich, jeder DDR-Bürger las zwischen solchen
Zeilen: „Wir Kommunisten (Bolz war nur ein verkappter) müssen die
Situation retten, ehe wir allesamt zur Hölle fahren. Die Sowjetpanzer sollen
doch endlich losrollen und die „Kriegstreiber“ dahin schicken wo sie hingehören.“
Am folgenden Tag und an derselben
Stelle hieß es: „KPD (die westdeutsche kommunistische Partei) fordert
Verzicht auf Gewalt!“, und abermals lasen wir daraus: „Wehrt euch nicht,
wir wollen euch doch nur vor dem Weltuntergang bewahren.“
Und am 4. Juni: „Westberliner
Spionagezentrum von unschätzbarem Wert“ (für die Kapitalisten G. Sk.), aber „es
ist militärisch nicht zu verteidigen“, und „Franz Joseph Strauß
lässt zivile Fahrzeuge für den Tag X erfassen.“ (Damals war Strauß
Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland. Damit stand er der
DDR-Regierung als Feind gegenüber) Alle normalen Bürger ostseits des „Eisernen
Vorhangs“, verstanden es: Westberlin wurde von den führenden Mitgliedern des
militärisch hochgerüsteten Ostblocks als Stachel in ihrem Fleisch empfunden.
Diesen Peiniger wollten sie unbedingt loswerden.
Chruschtschow prahlte zeitgleich
mit seiner 20 Megatonnen Wasserstoffbombe. Befragt, wem er sie denn zugedacht
habe, antwortete er unverfroren: „Amerika“.
Es gab Leute die sich stolz
reckten: Wir sind die Sieger der Geschichte.
Und, als wäre nichts von
Bedeutung geschehen, schrieb „Neues Deutschland“ am 14. Juni 59: es gelte, den „deutschen
Militarismus zu bändigen“ Immer hielten sie uns namens des
„Friedenskampfes“ in Aufregung. Am folgenden Tag wagten die dummroten
Redakteure im selben Blatt zu fordern: „Bonn (die damalige Hauptstadt
Westdeutschlands) soll die Atomrüstung einstellen.“ Sowie 2 Tage später:
„Empörung über Adenauer Kriegskurs.
Da war auch dieses kurze, sehr
aufschlussreiche Gespräch mit dem Altkommunisten Ernst Kay, im Frühling 1960
gewesen. Kay gehörte zum Sicherheitsapparat des Panzer-Reparaturwerkes
Neubrandenburg. Wegen seines Status gehörte er sogar zum Leitungsgremium. Er
verfügte damit über geheimes Insiderwissen und besaß gesunden Verstand. Zu
seinen Aufgaben gehörte uns Fischer zu begleiten, wenn wir im „Sperrgebiet“
unsere Netze auslegen wollten.
An jenem Morgen hatte ich das SED-Blatt ND mit auf den See
hinausgenommen. Da stand in roten Lettern: „Nikita Sergejewitsch
Chruschtschow: Für eine Welt ohne Waffen.“
Welch großartige Schlagzeile! Das
sollte und musste imponieren.
Ich hielt dem dürren, alt aussehenden Ernst
Kay das riesige Blatt hin. Aus seinem müder Faltengesicht warf er einen kurzen,
schrägen Blick auf seine Parteipresse und sagte beeindruckend kühl, aber mit
jener ungeheuren Selbstverständlichkeit, die gewisse Wahrheiten eben begleiten:
„Hei lücht!“ (Er lügt!)
Das krachte wie eine platzende
Granate!
Seelenruhig setzte er hinzu:
keiner der Kremlchefs, samt ihren Beratern, weder Lenin noch Trotzki, weder
Stalin noch Tuchatschewski, geschweige denn Malenko, hätten jemals dermaßen
brutal auf militärische Rüstung gesetzt wie der derzeitige Herr der Sowjetunion
Nikita Sergejewich Chruschtschow.
Jedes Wort, das der fast sechzigjährige Ernst
Kay mit seiner heiseren, doch nicht unsympathischen Stimme so gelassen
aussprach, drang mir tief ins Bewusstsein. Dann schnitt er alles, was er
geäußert hatte, auch meine weiteren Fragen, mit der lapidaren Bemerkung
beiseite: aus Frauen und den Militärs mache er sich nichts mehr.
„Prost!“
Er trank etwas, das wie Wasser
aussah. Er betrachtete den Rest des Inhaltes traurig und steckte die kleine
Flasche zurück in eine Tasche seines weiten Jacketts, wo er sie hergeholt
hatte, wobei er mich mit einem weltmännisch klugen Blick auf die letzte Schlussfolgerung
seines bewegten Arbeiterlebens hinwies: für ihn sei die pünktliche Einnahme
seiner Seelenmedizin immer noch das Wichtigste.
Ich nickte unwillkürlich, mochte
ihn und bedachte sein Vermerk unter tausend gesammelten
Illusionen “Hei lücht!” (Er lügt!)
Ich resignierte soweit es meine politischen
Absichten betraf und wandte mich nun stärker meinen selbst gestellten Aufgaben
in der Kirche zu. Eines Tages, als ich von der Arbeit mit meinem Fahrrad
heimkehrte traf ich Herrn Wilke wieder. Mein Mitarbeiter Kurt Meyer und ich
hatten Wochen zuvor von ihm eine Einladung zu einem Gespräch erhalten. Er
wirkte als Katechet der evangelischen
Kirche. Wir gingen am vereinbarten Tag hin. Uns war klar, er hatte sich
vorbereitet und mit dem anstehenden Thema vertraut gemacht.
Er würde also nichts aus “dem Hut heraus”
sagen. Kaum saßen wir da, lehnte der etwa dreißigjährige freundliche Mann sich
in seinem Sessel zurück. Er schaute an die Zimmerdecke, schloss die Lider und
sagte dann: “Es tut mir leid meine Herren, dass ich heute ihren Glauben
zerstören muss.”
Kurt schaute mich augenrollend an, ich hob
die Stirn. Und dann kam der Satz: “Es ist unchristlich, dass die Mormonen
ihren Propheten Joseph Smith anbeten!”
Ich bin nicht sicher ob wir höflich genug
waren, nicht laut aufzulachen. Was sollten wir machen?
Ich stieg vom Fahrrad ab grüßte ihn und
fragte nach ob er das Buch Mormon gelesen hat, das ihm übergeben hatten. Mir
ist nicht mehr in Erinnerung was er dann sagte, aber ich werde nie vergessen,
dass ich ihm sagte: Wir alle müssen, wie Petrus, Gott um eine Antwort bitten.
Ich zitierte Matthäus- Evangelium: 16,
die Verse 13-17 „Da kam Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi und fragte
seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn
sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du
seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er
sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus
und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn! Und Jesus
antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch
und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.“
Ich gab noch den Hinweis, dass wir, gleich
Petrus, durch die Macht des Geistes Gottes bedeutende Wahrheiten erfahren
können.
Das gerade ausgesprochen, ergoss sich über
mich pure Freude und Licht. Es war die Gewissheit nun erhört zu werden.
Umgehend verabschiedete ich mich, stieg nicht aufs Rad sondern sagte in tiefen
Gedanken: „Mein Gott, nun hörst du mich.“ Sofort kam es zurück,
machtvoll im besten Sinne des Wortes, und erhebend. Ich ging die etwa 800 Meter
zu meinem Heim langsam. Bis ich dort ankam, war es über und in mir. Ich fragte
als Erstes: „Herr, war Nephi eine historische Persönlichkeit?“
Mit großer Kraft kam es wortlos positiv
zurück. In diesen zehn Minuten nannte ich jeden Namen von denen das Buch Mormon
Bericht gab. Jeder Name wurde mir auf dieselbe Weise bestätigt.
Da war die Gewissheit die ich fast drei Jahre
zuvor erbeten hatte. Ich kam oben in meiner Wohnung an, warf mich in den Sessel
und sagte zu Erika: „Jetzt weiß ich mit Bestimmtheit!“
Aber es hatte seinen Preis, zuvor musste ich
beweisen, dass die Verpflichtung die ich einging, von mir erfüllt wurde. Mir
kam seither oft in den Sinn, dass Nephi wenn er vor Gott seine wichtigsten
Fragen stellte, nicht einfach ein paar Worte sagte, sondern er stieg auf einen
hohen Berg. Damit war er Gott räumlich nicht näher, aber innerlich. 1. Nephi 17:7
Bei aller Erkenntnis müssen wir des Alltags
Mühen durchleben
Wir erlebten im Frühling 1961, wie
hunderttausende Kleinbauern, - oft Flüchtlinge die in Hinterpommern und
Ostpreußen ihre Existenzgrundlage verloren hatten - infolge der Enteignungen
der Großbauern, Eigentümer von durchschnittlich 10 Ackerland, Wiesen und Wälder
wurden, nun erneut alles verlieren sollten. Die Aktion lief unter dem Namen
„sozialistischer Frühling“. Alle erdenklichen Mittel wurden eingesetzt die
Eigner zu überzeugen und letztlich zu zwingen ihr Eigentum aufzugeben. Sie
sollten nun als Genossenschaftler gemeinsam wirtschaften.
Sie wiesen den heftig drängenden
SED-Agitatoren ihre Besitzerurkunden vor. Vergeblich.
Sie beriefen sich auf den DDR-Staatschef
Walter Ulbricht, der im Herbst 1945 versprochen hatte, dass "den
Bauern, die den Boden haben, keine Macht der Welt ihn wieder wegnehmen könne.“
Es half alles nicht. Die „Partei“ hatte beschlossen, dass ausnahmslos alle
„Neubauern“ ihr Land und Vieh zusammenlegen mussten. Natürlich brachte die
gemeinsame Bewirtschaftung große Vorteile, aber es war der Zwang, der sie
niederdrückte. Bislang waren sie ihre
eigenen Herren, nun wurden sie degradiert zu Befehls- und Lohnempfängern. Sie
hatten sich zu beugen. Viele flohen daraufhin in den Westen.
Am 13. August 1961 errichte die Partei die
Berliner „Mauer“ über Nacht und zuerst nur mittels Stacheldrahtes, und umgehend
mit Beton. Es bestand die Gefahr, dass den Herrschenden eine weitere Million
Menschen oder sogar mehr, die teilweise kostspielig gut ausgebildet waren,
davonlaufen würden.
Im
Monat Juli waren es schon 30.000 und am 12. August 1961, also an einem einzigen
Tag, flüchteten 3.200 Personen.
Großeltern die ihre Kinder in der
angrenzenden Straße besuchen wollten standen hilflos da.
Ich selbst hatte das Gefühl, dass sich hinter
mir eine Gefängnistür für immer schloss. Walter Krause beruhigte mich:
Präsident David O. McKay habe gesagt.: Es kommt nicht zum Krieg.
Ausgerechnet zu dieser Zeit, oder wenig später
gab es ein fischereiliches Großereignis. Wir gingen Tag um Tag derselben immer
neuen Arbeit mehr oder weniger erfolgreich nach.
Es kam der November herauf
Wilhelm Bartel und ich wurden zum Rat des
Kreises bestellt. Dort legte man uns ein Papier vor. Es handelte sich um einen
-
Aufruf zur Planerfüllung und Übererfüllung.
“Wettbewerb für sozialistische Genossenschaften” stand da oben geschrieben.
Wenn wir die staatliche Planauflage allseitig erfüllten, dann erhielten wir die
Summen oberhalb einhundert Prozent aus dem Betriebsgesamtplan steuerfrei als
Nachzahlung. „Das gibt es nicht!”, erwiderte Wilhelm Bartel und steckte
sich vor Schreck an der heruntergebrannten anderen ein neues Zigarillo an.
Meistens unterbrach er das Rauchen nur für zehn Minuten. Diesmal nicht.
Wir fuhren mit unseren Fahrrädern wieder
hinunter zur Fischereibaracke. Während wir radelten, rechnete er mir
überzeugend vor, dass es uns ohnehin leider nicht betreffen würde. Wir könnten
allenfalls den Finanzplan, auch noch den Konsumfischplan erfüllen und
übererfüllen, aber im Bereich Feinfische blieben wir, wie üblich, weit vor dem
Ziel stecken.
Schade.
Wann gäbe es eine Chance wie die uns soeben
angebotene wieder? Steuerfreiheit für Gewinne? Nie. Biederstaedt bekräftigte
dieses Unmöglich! Von den geplanten 28 Tonnen Feinfischen (Edelfischen) fehlten
zehn. Die Fehlmenge war, nur finanziell allerdings, durch vermehrte Anlandungen
anderer Fischarten ausgeglichen worden. Im November ereignen sich keine
Fangwunder mehr. Jedenfalls nicht in dieser Größenordnung. Das sei gewiss. Auch
er zog die Achseln bedauernd und schüttelte den Kopf. Illusionen gäbe er sich in
seinem Alter nicht mehr hin. Gegen uns drehte sich sogar der Wind. Er blies in
den ersten acht Novembertagen heftig aus Ostsüdost. Der durch ihn erzeugte
Tiefenstrom würde allenfalls die großen Barsche in Zugnetzbereiche treiben.
Aber zehn Tonnen große Barsche gab der Tollensesee selbst in besten Fangjahren
nicht her. Das leuchtete mir ein, obwohl ich erst fünf Jahre dabei war. Vom
langgestreckten Tollensesee konnten, mit den uns derzeitig verfügbaren Mitteln,
etwa 85% der Gesamtseefläche fischereilich nicht erfasst werden. In diesen
Rückzugsgebieten bleiben die besten Fische stets ungestört. Bartel versuchte
uns zu ermutigen, dennoch das Mögliche zu tun. Die Lieps habe ihre Mengen zwar
längst abgegeben. „Doch wir haben den Krickower und den Neveriner See noch
nicht abgefischt.” Zusammen könnten uns die beiden Gewässer zwei Tonnen
Feinfische bescheren.
Wo jedoch ließe sich eine dritte, vierte,
achte Tonne Feinfische fangen?
Da zuckte alle resignierend die Achseln. Nirgendwo!
Das Zugnetz und die Kähne wurden zunächst
eiligst nach Neverin transportiert, wo -
auf dem 12 ha kleinen Gewässer mit bekanntlich hoher Produktivitätsrate
- tatsächlich, wie vorausgesagt, eine Tonne Zander gefangen wurde. Anschließend
ging es nach Krickow. Phantastische Gedanken- und Zahlenspielereien zogen durch
unsere Köpfe. Aber bei genauer Betrachtung kamen immer nur Minuszahlen heraus:
zum Schluss werden uns, selbst im günstigsten Fall, mehr als sechs Tonnen fehlen.
Eifrig, begleitet vom Sausen des starken Ostwindes, setzten wir die Netzteile
im steilscharigen Krickower See aus. Sofort, als wir das Zugnetz in Bewegung
brachten, ging das von Plasteschwimmern an der Seeoberfläche gehaltene Netz der
rechten Seite unter. Es hakte. Die Männer, die diesen Flügel zogen, begaben
sich so schnell wie sie konnten an jene Stelle der Netzwand die zuerst
abgetaucht war. Dort musste ein Hindernis in der Tiefe liegen. Eine Stunde lang
wühlten und stöhnten sie. Es kam nach und nach ein sonderbarer Aufbau,
schließlich eine ganze komplette Kutsche zum Vorschein. Fünfzehn Jahre lang
muss das Netz günstiger ausgelegt worden sein. Der Riss, von der versenkten
Kalesche verursacht, konnte schnell ausgeflickt werden, doch alle Mühen waren
schließlich vergebens. Denn Feinfische gab es dort nur kiloweise. Wir rochen
die Frostluft. Das Ende der Saison stand uns also aus Witterungsgründen
unmittelbar bevor. Bartel zog das schiefe Gesicht wieder gerade. Er hatte es ja
gleich gesagt. Er habe sich nun endgültig damit abgefunden, dass schöne Träume
bleiben, was sie sind.
Nur Witte und ich wollten es noch einmal mit dem Einsatz des Zugnetzes auf dem
Tollensesee versuchen. Einige beschimpften uns als Spinner. Es habe ja doch
keinen Zweck. Zehn Tonnen Hechte oder große Bleie fing man nicht mehr im
vorgerückten November, schon gar nicht bei Ostwind, sondern höchstens die
minderwertigen Plötzen. Wir zankten uns. Es dunkelte bereits, aber schließlich
mit Unterstützung anderer, die mir gegen alle Vernunft halfen, verluden wir das
Zeug, verbissen, in der Hoffnung auf ein Wunder, um dann zur Nachtzeit die
nächsten erforderlichen Voraussetzungen für weitere Züge zu schaffen.
Der 13. Novembertag des Jahres ‘61 begann
trist. Nur weil es ihre Pflicht forderte zu fischen, fuhren auch die Spötter
mit uns auf den See. Meine Hoffnung brannte noch lichterloh. Natürlich,
manchmal gibt es nichts mehr zu hoffen und man rennt dennoch. Wir legten das
große Zugnetz auf halbem Wege zwischen Neubrandenburg und Buchort vierhundert
Meter von Land aus. Je zweihundert Meter parallel zum Uferstreifen. Allen
Bemühungen zum Trotz fingen wir innerhalb fünf Stunden nur vier Stück Kleine
Maränen, eine Art Forelle. ![]()
Coregonus albula Stückgewicht bis 400 Gramm
höchste Qualitätsstufe wenn geräuchert. Seltene Delikatesse
Das war noch nicht einmal ein einziges
Kilogramm Fisch. Die einen freuten sich, wir andern zogen die Mundwinkel
herunter. Die Klügeren hatten Recht behalten. Enttäuschung ist wahrscheinlicher
als Erfüllung.
Bösartig argumentierend könnte man sagen: der
See sei bereits „überfischt“ worden. Die Uhrzeiger rückten auf die zweite
Nachmittagsstunde vor. Winterluft wehte wieder spürbar. Der Wind blies nun aus
Nordwesten. Doch so plötzlich wie er aufgekommen war, legte er sich wieder, wie
das an Nachmittagen häufig üblich ist. Selbst Biederstaedt verspürte nur noch
wenig Lust, noch einen weiteren Zug anzulegen. Sie entmutigten einander und ich
gab ebenfalls auf. Wir dachten an die uns bevorstehende Freizeit. Also fuhren
wir, die nächste Enttäuschung hinter uns lassend heim. Der Motor brummte. Kurt
Reiniger legte den Gang ein. Schäumend wirbelte des Kutters Heckwasser. Kurt
mied die gefährlichen Steine unterhalb des Steilufers von Belvedere. Er
steuerte auf Augustabad zu. Dieser kleine Umstand sollte große Folgen haben.
Denn da, fünfhundert Meter von Land,
passierte etwas. Da, noch einmal! Das dürfte keine Täuschung gewesen sein. Fast
unbemerkbar, wie ein Lamettafaden aufblitzt, der in der Dunkelheit der Nacht in
einhundert Meter Entfernung nur kurz vom schwachen Mondlicht beleuchtet wird.
Wieder! Diesmal zwei oder drei dieser winzigen nur für den Bruchteil einer
Sekunde erscheinenden Silberstreifen, aber bereits nur noch sechzig, siebzig
Meter von uns weg. Sie rissen mich aus der Lethargie in die Höhe. Biederstaedt
bemerkte es ebenfalls. Er legte die Hand beschattend über seine starken
Augenbrauen. Wir starrten nun zu zweit. Wie elektrisiert und in Hochspannung
versetzt und abwartend wandten wir unsere ganze Aufmerksamkeit der plötzlich
sich völlig glättenden Wasserhaut zu. Fritz Reiniger stieß die rechte Hand vor.
„Maränen!”, rief er. Auch er erregt. Jetzt erschienen vier, fünf Silberfunken
auf einmal, mehrten sich.
Alle sahen nun das sich unglaublich schnell entfaltende Bild. Immer mehr Fische
sprangen aus dem Seespiegel heraus. „Maränen, Maränen! Überall Maränen.”
Nur der Kutterfahrer Kurt Reiniger ahnte nichts. Er saß in der Kabine und hatte
lediglich den stumpfen Turm der Marienkirche im Blick. Purer Übermut trieb diese auf Hochzeit
gestimmten Winterlaicher. Nur für zehntel Sekunden ließen sich die
Einzelexemplare blicken. Mit großer Geschwindigkeit sausten sie knapp über den
schnell durchschnittenen Wasserspiegel hin. Geräuschlos für uns, noch, solange
der Kuttermotor lief. Von meinem Arbeitskahn aus schlug ich mit ziemlicher
Wucht und mit der flachen Seite meines Ruders auf das Dach der Fahrerkabine,
unseres neuen Kutters. Jäh aus seinen Träumen gerissen wandte sich Kutterfahrer
Kurt Reiniger um. Wütend stieß er das kleine, hintere Fenster auf. Seine Stirn
furchte den Ausdruck unbeherrschter Wut. Sein stets gebräunt wirkendes
Grobschmiedsgesicht schien Hass zu sprühen. Er fauchte mich an und ich fauchte
zurück: „Bist du blind?” Ringsherum spritzten die Silberlinge inzwischen
zu Tausenden immer mutiger, immer höher hinaus, immer weiter. Fritz Reiniger,
Kurts Bruder, gab ihm Weisung, er möge sofort wenden. Seinem älteren Bruder
laut zu widersprechen, hätte Kurt nie gewagt. Doch offensichtlich immer noch in
Zorn zog Kurt sich zurück. Ich vermutete richtig, dass er da im Motorenraum
maßlos vor sich hin geflucht hat und dennoch gehorchte. Er muss das Steuerrad
aus Ärger gefühllos herumgerissen haben, denn sofort schleuderten die Kähne
bedrohlich scharf nach außen. So sind selbst schon höherbordige Boote zum
Kentern gebracht worden. Noch befanden wir uns vier-, fünfhundert Meter von der
Einfahrtsrinne zum Oberbach entfernt. Da war der See noch tief genug. Noch
konnte Kutterfahrer Kurt einen Halbkreis mit Vollgas ausfahren. Das mutete er
uns auch zu. Wir gerieten unnötigerweise in diese Schieflage. Lediglich
Millimeter fehlten und das schäumende Wasser wäre nicht nur spritzerweise,
sondern massiv in die Arbeitskähne hineingeschlagen. Wo das passiert war, da
gab es bereits der Netze wegen, die dann automatisch über die Gekenterten
hinweggeschleppt werden, Tote. Dem Umkippen immer noch nahe, noch während des
hitzig ausgeführten Wendemanövers wiederholte sich das Schauspiel unmittelbar
neben uns. Aus den von uns verursachten Wellen sprangen nun die kostbaren
Fischchen und zeigten sich jetzt in voller Pracht ihres Gruppenfluges. Das war
einmalig betörend und aufregend. Als wir auf Höhe der Linie Belvedere -
(ehemalige) Torpedoversuchsanstalt ankamen, warfen wir das Netz zum zweiten Mal
aus. Die Sonne färbte den Horizont bereits rötlich zu Rot, dann violett zu
herrlicher Farbenvielfalt. Von der Trommelwinde fuhren wir jeweils ungefähr
vierhundert Meter Drahtseil ab. Dann im flachen Seebereich steckten wir unsere
Haltepfähle in den sandigen Seeboden, kurbelten die kleinen Dieselmotoren der
Maschinenwinden an und warteten eigentlich eher ungewiss darauf, wann das zwar
recht lange, aber nicht sehr tiefe Netz endlich auftauchen würde. Denn durch
den Wasserwiderstand, der den Maschen entgegensteht, baucht das Fangnetz
während der Windephase beträchtlich aus. Manchmal ist es dann nur noch sechs
Meter hoch. Reduziert um fast die Hälfte der theoretischen Stauhöhe. Solange
also die Flottenleine nicht an die Seeoberfläche stieß, war den Fischen der
Ausbruch durch einfaches Überschwimmen des Netzes allemal möglich. So können
selbst die größten Fischschwärme bis auf den letzten Schwanz entkommen. Ihrem
Instinkt folgend haben sogar die in Laichstimmung hineintaumelnden Fische stets
noch ihre Fluchtchancen. Deshalb sahen wir dem Zeitpunkt des Netzauftauchens
eher gelassen, als mit hochgespannter Erwartung entgegen. Zu oft hatten wir es
erlebt, dass Großfische mitten auf dem ‚Zug’ im scheinbar sicher eingekreisten
Bereich aus Lust oder Erregung herausplatschten und dann war es doch nicht
gelungen, sie zu fangen. Die Unberechenbarkeit der stets nur teilweise
eingekreisten Fische machte die Arbeit so spannend. Trotz enormen Fleißes
unsererseits blieb sie ein Glücksspiel, und deshalb gewöhnte man sich nach und
nach, selbst bei allerbesten Anzeichen ab, irgendeine Fanghoffnung zu
übersteigern. Doch, wo immer die ‚Springer’ ihre Anwesenheit demonstrierten, da
bemühten wir uns auch, sie zu fangen. Es geschah in diesem Augenblick bereits
das nächste wunderbare Ereignis. Wie von Geisterhand bewegt flog das Netz
plötzlich auf einem guten Drittel seiner Gesamtlänge, also auf einer Länge von
etwa zweihundert Metern in die Luft. Wie mir schien, einen halben Meter hoch.
Ein Silberrand ohnegleichen. Das war eine Sensation. Mir ging vor Staunen der
Mund auf. Noch nie hatte ich - sowie meine Kollegen - Vergleichbares erlebt.
Gegen das Gesetz der Schwerkraft kann das tonnenschwere Netz sich nicht aus dem
Wasser in die Lüfte erheben, nicht einen einzigen Millimeter. Und doch war es
so. Die Männer vom nebenan liegenden Boot schrieen jubelnd: „Wir haben sie.”
Was war wirklich geschehen? Es gab nur eine Erklärung: Alle Energie,
die von aufgerüttelten Maräneninstinkten zur Überlebenssicherung in
zehntausenden Fischen zeitgleich freigesetzt wurde, verlor sich im gemeinsamen
Anrennen gegen die Netzwand. Die Vorderen rasten mit ihren spitzen Köpfen in
die Maschen, die nächsten stießen gegen die aufgeregt weiterschwimmenden, aber schon
gefangenen und die letzten, meisten, taten das Übrige. So schob eine Fischwelle
die andere in Panik vor sich her und verursachte auf diese Weise das
sensationell sichtbare Ergebnis dieses Massenansturmes. Unmittelbar hinter den
schon kahlen Buchenkronen und der Silhouette von dem im klassizistischen Stil
erbauten, tempelartigen Belvedere zog sich schon die Sonne zurück und färbte
den hinter dem Zugnetzsack liegenden Seeteil von violett zu blaugrau, strengen
Frost ankündigend. Über dem Wadensack in nahezu noch dreihundert Metern
Entfernung flatterten tausend Seeschwalben und Möwen. Wie aufgewirbelte, weiße,
schnell ihre Konturen ändernde Wolken wogten die Vogelscharen. Immer wieder
stießen die Räuber aus der grauweißgesprenkelten Höhe herab und zerrten mehr
oder weniger erfolgreich an den mit ihren Silberleibern in den Netzmaschen
steckenden Fischen. Rings herum tönte dieses wilde Kreischen. Inzwischen fuhren
wir mit unseren pechschwarzen Arbeitskähnen mittig im Flachwasserbereich
zusammen, um schließlich die Arbeit des Garneinholens vorzubereiten. Noch lag
die von weißen Ekazellflotten umrahmte Seefläche spiegelblank vor uns, als sich
plötzlich, ohne Windeinwirkung, eine erhebliche Woge auf uns zubewegte.
Ozeanische Massen Maränen! Niemand konnte sie aufhalten. Jedes Stellnetz, das
wir vielleicht als Sperre hätten einsetzen können, wäre von ihnen binnen
Sekunden zu Boden gerissen worden. Unter dem Verlust einiger hundert Leiber
hätte sich die Masse freie Bahn gebrochen. Das müssen hunderte Zentner gewesen
sein. Sie erschwammen sich ihre Freiheit durch Gleichzeitigkeit ihrer Flucht.
Wir sahen im niedrigen Wasser unter uns die zahllosen Fische, die Leib an Leib
gedrückt schnell dahinschossen. Entzückt und zugleich von Ärger betroffen sahen
wir staunend diese unglaublich großen, blauschimmernden Scharen. Oft stand mir
später dieses Bild vor Augen und irgendwann kam mir der Gedanke: Keine
totalitäre Regierung der Welt, könnte ihre Grenzzäune halten, wären
fluchtwillige Menschen fähig ihre Verstandeskräfte zeitgleich einzusetzen.
Endlich, bei allmählich schwindendem
Tageslicht konnten wir den Kreis schließen. Von dem Augenblick an, wenn die eng
beieinander liegenden Fangboote das Zeug einholen, mindern sich für die
restlichen, im Umfassungsraum herumschwimmenden Fische die Möglichkeiten zu
entkommen erheblich. Die beiden Netzwände kamen nun wie ein silbern genoppter
Teppich heran. Nach und nach, während des Zuladens des fischgespickten Garns
brachte die beiden Kähne fast zum Sinken. Wie Hirschgeweihe stießen die
Vordersteven unserer Boote in die Höhe, während die Heckteile nahezu mit der
glücklicherweise nun völlig ruhigen Wasseroberfläche abschnitten. Wir durften
uns kaum noch bewegen, sonst gingen wir unter. Massenweise versuchten die
verbleibenden Maränen im Wadensack Platz und Durchkommen zu finden. Da
schwammen sie zwar noch, waren aber, wie die in den Maschen steckenden,
endgültig gefangen. Anders wären wir der Fischmassen nicht Herr geworden.
Einhundertundsechsundsiebzig Zentner Maränen konnten wir in dieser Nacht aus
den Weiten des Wadensackes herauskeschern. „Fast neun Tonnen!“ jubelte ich, -
ich glaube laut. Glücklicherweise sanken die Temperaturen in den Minusbereich.
Wir fühlten uns mehr als beschenkt. Biederstaedt schlug lachend, wuchtig und
kreuzweise die steifen Hände und Arme über der Brust zusammen.
„Dat sünd de ollen Tieden!”, ("Wie in guten alten Tagen!")
frohlockte er. Sein flächiges Gesicht strahlte: „Dat sünd de teigen
Tunnen!” An der Möglichkeit zur Vollendung der nun unbedeutend
gewordenen Feinfischmenge zur Überschreitung der so bedeutungsvollen
Zehntonnengrenze gab es nun keinen Zweifel mehr.
Und mir kam zweierlei in den Sinn, die
Bibelpassage als der Auferstandene die von ihrem Fangergebnis enttäuschten
Jünger auf dem See Genezareth ermutigt: „Werft das Netz auf der rechten
Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und
konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es.“
Das war zugleich eine Metapher: Geht ihr
Menschenfischer und fangt mit dem Evangeliumsnetz so viele wie ihr tragen
könnt.
Ich schaute Fritz Biederstaedt an: wir beide
irrten: Da hat die Partei, die wir beide nicht mögen, doch etwas Gutes zustande
gebracht, in dem sie 1953 darauf drang in unseren See 5 Millionen
Maränenbrütlinge einzusetzen.
Das musste ich anerkennen.
Es war nur sonderbar, dass wir während der
Fangperioden über Jahre bloß hin und wieder ein paar Silberlinge gefangen und
sonst nichts von ihnen bemerkt hatten. Plötzlich schien der See von Maränen
überzuquellen. Geheimnisse der Tiefe. Sie hatten sich gesammelt. Aus den Weiten
der siebzehn Quadratkilometer Fläche, verteilt auf die durchschnittliche
Wassersäule von sechsundzwanzig Metern waren uns die Kleinen Maränen in letzter
Minute glücklicherweise entgegengekommen. Sie hatten gezeigt, dass es sie in Massen
gibt und ich erkannte, wie wenig wir vom Geschehen unterhalb der Wasserhaut
wussten.
In den folgenden Jahren setzte sich der
positive Trend fort und ich konnte mehrere fachliche Abschlüsse erwerben.
Verlockendes Angebot
Prillwitz liegt am malerisch schönen Südufer
der Lieps. Dieses Gewässer ist eines der vielen blau und grün-bunt schillernden
Pfauenaugen in der Mecklenburger Landschaft.
Dieter Helm, Vorsitzender der PGH “Heinrich
Hertz” spielte mit seiner goldenen Posaune zum Betriebsfest der Fischer auf.
Seine kleine Kapelle tönte herrlich. Aber nun schon weit nach drei Uhr morgens,
an diesem Junitag des Jahres 1964, konnten selbst die schönsten Töne keinen
Tänzer mehr auf das Parkett des Festsaales locken.
Ich ging langsam und nachdenklich zur
Anlegestelle für die Fahrgastschiffe hinunter. Da lag die “Fritz Reuter”, das
weißblaue Passagierschiff im Dunst des heraufdämmernden Tages und wartete auf
uns. Ich wandte den Blick zum roten Gebäude, indem unser kleines Betriebsfest
stattgefunden, und wo ich die Verse meiner humorige Spottzeitung vorgetragen
hatte. Es war das vielleicht
schönste der Schlösser der ehemaligen Mecklenburg-Strelitzer Herzöge, das ich
sah. Es schimmerte durch die Stämme und das Blätterdach einiger weniger, aber
gewaltiger Platanen hindurch.
Dann sah ich beide Göcks ankommen. Auch sie
erschöpft, wie man sah, aber beide in heiterer Stimmung. Hermann ging wie stets
ein wenig nach vorne gebeugt. Sie untersetzt und von sehr fraulicher
Molligkeit. Als sie eingestiegen waren, kamen sie näher und lächelten
freundlich. Am Nachbartisch nahmen sie Platz. Nach ein paar Minuten der
Entspannung schaute Hermann herüber: „Setze dich zu uns!” Ich nahm die
Einladung an. Ich mochte beide wegen der Herzlichkeit, die sie mir nun immer
entgegenbrachten. Die Sonne, im Begriff aufzugehen, rötete den Himmel im
Nordosten und seine Widerspiegelung befand sich am Horizont links über dem
Areal, wo das versunkene Wendendorf Bacherswall einst gelegen hatte. „Wie
geht es deiner Frau?” Es klang mir nicht nur angenehm, es war echt. Es
erinnerte an die erste Begegnung, als Erika mit unserem damals zweijährigen
Sohn Hartmut neben Göcks auf der Fischerinsel im Schatten der hohen rauschenden
Pappeln an einer Festtafel Platz nahm. Fritz Biederstaedt hatte sie so herrlich
arrangiert. Gekonnt war die aus einfachen Klapptischen bestehende, teilweise
mit weißen Tischtüchern abgedeckte lange Tafel dekoriert und hergerichtet
worden. Die frischen Räucherfische dufteten. Die Menge der Delikatessen bot
einen verlockenden Anblick. Die Gläser blitzten im Gefunkel der vom nahen See
spiegelnden Sonnenstrahlen. Nicht weniger beleuchtet sahen wir die je dreißig
Teller und Tassen.
Für jeden gab es einen ganzen, goldbraun
geräucherten Aal. Das sei ja unglaublich, hatte Helene Göck gerührt ausgerufen,
als wir gebeten wurden ungeniert zuzugreifen.
Erika trug an jenem Nachmittag ihr schönes
blaues Kostüm, Hartmut eine rotweiße Bluse.
Helene Göck nickte, als ich es erwähnte. Sie
denke ebenfalls sehr gerne an diesen Tag und die Harmonie der Feststunden
zurück.
Wie es Erika jetzt ginge?
„Danke für die Nachfrage!”, erwiderte ich. „Von
der letzten Herzattacke hat sie sich erholt. Es geht wieder bergauf.”
Hermann sagte: „Grüße sie von uns!” Dann fuhr er fort: „Wir haben
Dich beobachtet.” Seine Augen blitzten auf, als er feststellte: „Du hast
dich korrekt verhalten.”
Er meinte wahrscheinlich, ich hätte die
Gelegenheit des Betriebsfestes nicht genutzt, um mit hübschen Damen zu flirten.
Ich dachte mir meinen Teil.
Die anderen kamen inzwischen den nur etwa
einhundert Meter kurzen Weg vom Schloss zur Anlegestelle herunter. Hermann
Witte paffte eine Zigarre. Er trug einen braunen Schlips zu seinem hellen Anzug
und machte ein Gesicht wie ein kerngesunder VEB-Direktor, jedenfalls war er
auffallend runder geworden. Wenn er so ging, die Beine nach außen aufsetzend
und dabei langsam, genussvoll den Rauch seiner Kubazigarre in die Luft blasend,
signalisierte er, dass sein Glück vollkommen sei. So standen nun mehr als zehntausend
Mark auf seinem Konto. Er besaß ein neues Motorboot und hatte einen Bungalow in
schöner Uferlage gebaut. Von Woldegker Zeiten war keine Rede mehr, als
Fischkisten dreiviertel seines Wohnzimmer Mobiliars ausmachten.
Immerhin war ihm im Ausstickungswinter 63 die
Idee gekommen, mittels einfacher Stalllaternen, die er an die Eislöcher
stellte, die taumelnden nach Sauerstoff ringenden Fische anzulocken um sie mit
den vielen vom ihm speziell konstruierten Senken zu fangen. Sonst wären sie
verreckt.
In einer einzigen Nacht war ihm gelungen,
fast dreißig Zentner hochwertiger Schleien zu überlisten. Augenblicklich
gefroren die Schleien zu Stein. Das tötete sie nicht, nicht alle jedenfalls.
Denn vierundzwanzig Stunden später, begannen einige der noch in hölzernen
Kisten im Sortierraum stehenden Fische wieder zu zappeln. Ganz allmählich waren
sie aufgetaut.
Hermann Witte schuftete immer, sobald er sah,
dass es sich lohnen würde. Sein Pflichtbewusstsein hätte Faulheit gar nicht
zugelassen.
An diesem Morgen nach durchfeierter Nacht
muss ihm der Gedanke zu Kopf gestiegen sein, dass er nun wer geworden war.
Der Motor des Fahrgastschiffes begann
beruhigend zu schnurren. Das Boot legte ab und nahm eine Kurve beschreibend
langsam Fahrt an.
„Wie wäre es, Gerd Skibbe, wenn du den
Vorsitz in der PwF übernimmst?” Obwohl mich dieses Angebot Hermann Göcks
nicht wirklich überraschte, schmeichelte es mir. Er war Mitglied der
Bezirksleitung der SED, genauer gesagt Göck war der Vorsitzende der
Bezirkspartei-Kontroll- Kommission und hätte die Macht gehabt, mich im Verlaufe
der nächsten Monate an die Stelle des gesundheitlich doch schon recht
angeschlagenen Wilhelm Bartels zu setzen.
Wilhelm hatte seine sowjetrussische
Gefangenschaft, die mit dem Desaster der Stalingradkapitulation begann, mit Ach
und Krach einigermaßen überstanden. Doch sein Dauerrauchen ruinierte ihn.
Bereits als Gefangener hatte er nach eigenem Bekenntnis sein Brot gegen
Machorka eingetauscht.
Mittlerweile erreichten wir den Alten Graben,
den sechshundert Meter langen Kanal zwischen Tollensesee und Lieps.
Was beide Göcks eigentlich wissen mussten:
ihre wenn auch unausgesprochenen Bedingungen, konnte ich nicht akzeptieren.
Durch die Scheiben schaute ich hinaus, sah
die Birken, die den Wall der schmalen, gerade wieder ausgebaggerten
Wasserverbindung säumten, und dachte, nun bist du vierunddreißig. Das ist ein
guter Zeitpunkt noch mehr aus deinen Möglichkeiten zu machen. Hermann Göck
könnte dich nach vorne bringen. Ich käme meinem Ziel, einen Studienplatz an der
Fischerei-Ingenieurschule in Hubertushöhe zu bekommen, näher.
Zudem ging es in der DDR sichtlich voran. Wer
es sich leisten konnte, fuhr ein Auto, zumindest einen P 50. Die Schließung der
Grenze lag jetzt drei Jahre zurück und je länger ich das Eingesperrtsein
erlitt, umso mehr gewöhnte ich mich an diesen Dauerschmerz, der immer mehr
abnahm.
Nachdem ich mir ersparte, immer wieder
bewusst dem Verlust der Freiheit nachzutrauern, konnte ich ganz gut mit den
Verhältnissen leben. Schließlich bedeutete mir meine Frau und meine beiden
Söhne das höchst denkbare Glück.
Die Göcks betrachteten mich geduldig. Ihnen
war klar, dass es mich reizte, ihr Angebot anzunehmen: „Du kannst doch mehr
als Fische zu fangen. Komm zu uns in die Partei! Wirf deine Bedenken einfach
über Bord.”
Bis jetzt hatte ich mich ziemlich eng an
Polonius guten Rat gehalten: „Sei dir selber treu!” Und das hat seine
Konsequenzen: „Daraus folgt wie Tag der Nacht, du kannst nicht falsch sein
gegen irgendwen.”
Zwanzig lange Propagandajahre hatte ich mich
aus meinen Gründen gegen den auch mich gelegentlich nicht wirkungslos
anfallenden Atheismus gestellt.
Kaum eine andere Sache hatte mich mehr
beschäftigt als die dazu gehörenden Fragen. Mein Fazit war, dass meine
Mitmenschen nicht als Folge von Bemühungen Atheisten geworden waren, sondern
nach meiner Erfahrung ist es umgekehrt. Nach Formulierungen König Benjamins im
Buch Mormon, ist der Atheismus ein Naturgewächs. Es entspringt unserem Wesen
und diesem Wesen entspricht, dass wir wie Wasser den Weg des geringsten
Widerstandes suchen. Kulturgeschöpfe aber, wie der Glaube an einen liebenden,
planenden Gott, müssen sich gegen den Zerstörungstrieb der menschlichen Natur
wehren.
Schlimmer! Meinem Verständnis nach war und
ist der allgemeine Atheismus, eben weil er natürlich ist, das Einfallstor für
Opportunismus und inneres Chaos. Viele Genossen waren Opportunisten, auch wenn
sie das vehement bestritten. Wenn ich sie an dem maß, was sie mir unter vier
Augen sagten, glaubten die meisten den Direktiven und Parolen ihrer Partei
nicht.
Sie ordneten sich ihr nur aus taktischen
Gründen der Vorteilsuche unter. Sozialismus war für sie und mich dasselbe.
Nämlich eine künstlich erzeugte, erpresste Realität. Wie überstrenge,
herrschsüchtige Väter ließen die Protagonisten dieses Systems, keine andere
Meinung neben ihrer gelten. Es gibt keinen Menschen, der das mag.
Gemäß rotem Lehrbuch will der Kommunismus
jedes Erdenland erobern, um es nie wieder preis zu geben.
Auf dieses Ziel ausgerichtet balancierten
seine Cheferbauer Lenin, Stalin und Chruschtschow frech am Rande des Untergangs
der noch freien Menschheit. Die Kubakrise von 1962 bewies das.
Es darf nie vergessen werden, dass wir damals
allesamt vor dem völligen Aus standen. Zuerst schossen die Kubaner einen US-Aufklärer
ab. Ich hörte, glaube ich, die Nachricht am frühen Morgen des nächsten Tages,
weckte Erika und äußerte meine Bedenken. Das lassen sich die Amis doch nicht
gefallen! Und so war es. Wenig später überraschte uns die Information,
sowjetische Raketenstellungen bedrohten von Kuba aus die USA. Ein Blick in den
Atlas genügte. Von Santa Clara bis Miami war es nur ein Katzensprung. Anstelle
des bis dahin anscheinend eher harmlosen Inselstaates Kuba, befand sie
plötzlich ein mit tödlichen Waffen gespickter, unsinkbarer Flugzeugträger der
Roten Armee unmittelbar vor Florida.
Jeden Kommentar von Ost und West, den wir
hören konnten, verfolgten wir angespannt.
Da war mehr als ein Wortekrieg. Tatsächlich
erging von Präsident John Fitzgerald Kennedy Weisung ans Pentagon: „Sofort
sind die Sowjetschiffe mit Kurs Kuba im Bahamabereich zu stoppen“. Er
bestehe auf sofortigen Abzug der sowjetischen Raketen von Kuba, sonst... Sonst?
Wer da
nicht gezittert hatte, wusste nichts.
Wir ahnten, dass die US-Militärs von ihrem
Präsidenten die umgehende Besetzung Kubas verlangten. Das hätten die Russen mit
allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln unterbunden.
Stunde um Stunde setzten sie einander und uns
unter Hochdruck. Es mag ja Menschen geben, die selbst den Tod nicht fürchten.
Doch wer am Leben hing, wie wir, der verfolgte jede Nuance im Wechsel des
hochpolitischen Ränkespiels, das zwischen Moskau und Washington Zug um Zug mit
äußerstem Einsatz an Willenskraft und Intelligenz durchgezogen wurde.
Ein Fehlerchen hier oder ein Fehler da, und
schon verbrannte die entfesselte Atomkraft die ganze Welt.
Seit Hiroshima stand fest, wer im Besitz von
Massenvernichtungsmitteln ist, der ist auch bereit sie einzusetzen.
Wird Chruschtschow nachgeben? Oder wird er seiner Atlantikflotte befehlen
die Bahamaroute gewaltsam offen zu halten?
Eins zieht das Andere hinter her: Eingekreist
waren die alliierten Truppenteile in Westberlin, draußen nur durch ein paar hundert
Meter Mauerwerk und Luftlinie voneinander getrennt, standen die zig
hochgerüsteten Sowjetdivisionen. Sie waren allemal bereit Moskauer Befehle
umzusetzen.
Vier Tage und Nächte lang zerrte die
Ungewissheit an uns allen.
Nicht wenige DDR-Offiziere wurden nervös, das
konnten viele nicht verbergen.
Aber Chruschtschows Militärstrategen
errechneten sehr wahrscheinlich, dass sie die heraufkommende Auseinandersetzung
nicht eindeutig für ihre Seite entscheiden konnten.
Der Kremlführer gab folglich nach. Daran dachte ich an jenem frühen Morgen,
während ich an diesem herrlichen Sommermorgen in der Ecke der blaugepolsterten
Sitzbank auf dem blinkend neuen Fahrgastschiff saß.
Wir fuhren nun der gleißenden Sonne entgegen.
Der Tollensesee hatte uns wieder. Das Fahrgastschiff nahm große Fahrt an. Das
Seewasser rauschte nun kräftiger. Beide Göcks recht ermüdet sagten
übereinstimmend: „Lasse dir Zeit, Gerd. Überlege es dir.”
Wenn ich mich an diesem frühen Morgen nach
Hause begeben würde, werde ich an mindestens zwölf Schrifttafeln vorbeigehen,
alle gefüllt mit den SED-Parolen die auf mich und jeden, nach dem Prinzip
„steter Tropfen höhlt den Stein“ einwirken sollten. Constant dripping wears the stone.
Die
erste Botschaft würde mir bereits auf der Anschlagtafel am letzten Bootshafen
begegnen. Ich würde sie nicht aufmerksam lesen, doch ich kannte den Text längst
auswendig.
Dann rückte bereits am Haus der ‚Gesellschaft
für Sport und Technik’ der zweite SED-Spruch, einigen Quadratmeter groß, in
mein Blickfeld. Es war die Aufforderung, den Frieden wehrhafter zu machen.
In der Lessingstraße empfing mich dann die
dritte Losung.
Zwei weitere würden meine Aufmerksamkeit
schon wenige Schritte später beanspruchen. Sie hingen an der Frontseite der EOS
(erweiterte Oberschule): „Ewige, unverbrüchliche Freundschaft mit der
Sowjetunion” sowie die Behauptung, dass die Bonner Ultras auf Kriegskurs
sind.
In meiner Aufzählung, die ich schweigend
vornahm, kamen nun die beiden nächsten Schlagworte an den Gebäuden des
Wehrkreiskommandos auf mich zu.
Da hieß es, dass der Weg zum Sozialismus
gesetzmäßig sei.
Zwei weitere Plakate hingen seit einigen
Wochen im Kinobereich: auf Rot geschrieben hieß es: „Die SED ist die höchste
Form der gesellschaftlich-politischen Organisation der Arbeiterklasse, die
führende Kraft der sozialistischen Gesellschaft. Die Partei gibt diesem Kampf
Richtung und Ziel.”
Unentwegt fielen diese Sätze über uns her.
Niemand entkam diesem Einfluss. Wie die
Luftfeuchtigkeit war der Parteigeist allgegenwärtig. Es war unentwegt die
Machtfrage: Wer wen? Fortschritt durch Diktat!
Doch, wo bewirkten Zwang und Indoktrination jemals Gutes?
Als wir anlegten am Steg vor dem Badehaus und
von Bord gehen wollten, umfasste Hermann Göck mit seiner Rechten meine
Schulter. „Bleibe ruhig. Sage mir, wenn du soweit bist!” Seiner
Überzeugung nach hing mir eine überholte Denkweise an, wie einem alten
Galeerensträfling eine verrostete Kette. „Du musst dich befreien!”
Ihm war auch nicht annähernd klar, was er
forderte. Allein seine Vorstellung, dass selbst vermeintliche Erkenntnisse
fesselnde Funktionen haben sollen, verwunderte mich. Er war unfähig zu
erkennen, wie viel mir die Freiheit des Denkens bedeutete.

|
Hartmut war Bischof
in Berwick-Ward, Packenhamstake, Melbourne, an Mutters Hand. Matthias jetzt 2024
Ratgeber in der Tempel-präsidentschaft Freiberg. Erika verstarb im
November 2001 2004 heiratete ich
Ingrid. Wir leben in der Nähe zu Hartmut und der Familie des Enkels Daniel
Skibbe, der seine Mission in Brisbane erfüllte. |
|
|
Vaters Tod - Honolka
Im Januar 1965 wurde ich zum
Distriktpräsidenten Mecklenburgs berufen, nachdem ich zuvor in vielen
Organisationen der Kirche gedient hatte. Wir zählten damals nur dreihundert
eingetragene Mitglieder, die über das sehr große Land im Norden der DDR verstreut,
in sechs kleinen Zweigen wohnten.
Mein Vater, zu dieser Zeit Zweigpräsident in
Wolgast. Er nahm sich im November dieses Jahres in einer Phase tiefer
Depression das Leben. Wahrscheinlich waren das die Spätfolgen seines
Kindheitstraumas und die Folge seiner für ihn unerträglichen Monate der
Gefangenschaft
Psychiater hätten ihm helfen können,
möglicherweise schon ein Medikament. Das lehnte er rigoros ab. Danach gab es
nur noch mich. Ich wäre der einzige Mensch gewesen, der es hätte verhindern
können. Keiner wusste so deutlich wie ich, dass es nur ein scheinbarer
Widerspruch war, - eine fixe Idee - die ihn zu zerbrechen drohte.
Aber das wurde mir erst klar, nachdem das
Unglück passiert war. Ich haderte mit Gott und mit mir. Soweit hätte es nicht
kommen dürfen. Wäre ich doch häufiger nach Wolgast gefahren um ihn zu besuchen.
Hätte ich doch länger Urlaub genommen. Hätte ich doch mehr mit ihm gesprochen.
Denn ich verstand den Ansatz seiner niederdrückenden Gedanken. Mein Verständnis
für ihn riss ihn zeitweise heraus aus dem Kreis seiner eher unbegründeten
Selbstanklagen und Ängste. Es tat ihm sichtlich gut, statt in der Stube sitzend
und liegend zu grübeln, mit mir spazieren zu gehen und über ihn zu reden. Meine
Fehleinschätzung, er benötige mich nicht länger, hatte dieses vermeidbare Ende
mitverschuldet.
Beladen mit dieser Last besuchte ich damals
die Abendschule, um mich auf ein Fachschulstudium vorzubereiten.
Es war anstrengend, die Gedanken nicht immer
wieder abschweifen zu lassen.
mir saß, im Herbst 1965, in einer
Klasse der Volkshochschule, ein junger, langgewachsener Feldwebel. Er kam aus
methodistischem Elternhaus. “Das muss aber keiner wissen!” sagte er.
Mich wunderte seine Schamhaftigkeit. Mich ärgerte, dass der große, kluge und
gutaussehende junge Mann den Kopf einzog, wenn das Gespräch sich diesem Punkt
auch nur näherte. Da beschloss ich eines Tages, vor allen Anwesenden unserer
Vorbereitungsklasse, bei nächst passender (oder nicht passender) Gelegenheit
eine Diskussion zur Berechtigung des Glaubens an Gott auszulösen. Schneller als
ich dachte, wurde aus dem Funken ein Feuer. Unser Physiklehrer sprang sofort
auf meine provokatorisch gestellte Frage an, ob es heute etwa ein Verbrechen
sei, seine Kinder religiös zu erziehen.
“Selbstverständlich ist das ein
Verbrechen!”, erwiderte Hauptmann Honolka, der wie sein Banknachbar
Oberstleutnant Leumann, in voller Pracht ihrer Uniformen zwei Reihen vor mir
Ihre Plätze einnahmen. Er schaute sich um und schüttelte den Kopf.
Mit dieser Antwort die
offensichtlich von allen Anwesenden geteilt wurde, hatten sie sich schon
verstrickt. Andere Altgediente der Nationalen Volks-Armee, die in ihren Offiziersuniformen
dasaßen, wandten sich zunächst in scharfer Form gegen meine Ansichten. Aber als
ich sie daran erinnerte, dass Walter Ulbricht zum Meinungsstreit aufgefordert
habe, und da sie vermutlich nicht traurig darüber waren, dass der Unterricht und
damit die fällige Klassenarbeit verzögert wurde, ging es gleich zwei Stunden
lang hoch und heiß her. Mein ursprüngliches Anliegen war, herauszufinden, ob
ich meiner eigenen Logik trauen durfte und ob sie jeder Kritik nicht nur
widersteht, sondern mir zu einem kleinen Sieg im nun aufkommenden
Meinungsaustausch beschert. Und nebenher wünschte ich dem Methodisten
zuzusichern, dass sein Glaube, zumindest sein Glaubensansatz, doch in Ordnung
war. In Honolka fand ich meinen schärfsten Kontrahenten. Er zielte genauer als
die meisten meiner Gegenspieler. Ich hielt dagegen und verteidigte zunächst nur
die Richtigkeit der Morallehre Christi.
Aber an die habe sich die
katholische Kirche nie gehalten. Das sei wahr, erwiderte ich. Tatsächlich ging es dem Vatikan nur um den
Erhalt eben der Macht, auf die Jesus verzichtete. Ich warb mit aller Kraft um
Akzeptanz und sprach eindringlich von der allgemein vorherrschenden
Leichtfertigkeit mit der gerade die „fortschrittlichsten“ Leute über bewährte
Prinzipien wie Wahrhaftigkeit, Selbstbeherrschung und Güte, wie über ein Nichts
hinwegschritten.
Dann kamen wir zum Thema
Schöpfergott. Der martialisch auftretende Honolka pochte darauf, dass die
Evolutionslehre schon längst keinen Spielraum für den Glauben an Gott mehr
zulässt. Jede Verteidigung von Glaubenspositionen dieser Art sei chancenlos.
Unmittelbar vorher hatte ich aber
das Buch des katholischen Evolutionsforscher Freiherr von Hüne “Phylogenie der
niederen Tetrapoden” gelesen, der Indizien dafür fand, dass Evolution gesteuert
verlief. Mein sonst in der Kirche inaktiver Bruder Helmut hatte mich
dankenswerterweise darauf hingewiesen. Das Wissen um diese Zusammenhänge half
mir, des Physiklehrers und Honolkas Hauptargumente abzuschmettern. Ich sagte
nämlich: „Neues Deutschland“ warf gerade vorgestern die Frage auf, ob wir
alleine im Weltall sind. Es gäbe Signale aus den Tiefen des Universums, die
nahe legten, dass es andere Intelligenzen gibt.
Der Hauptmann drehte sich zu mir: „Na und?“
„Wer will beweisen, dass wir
nicht ihre Ableger sind…? Natürlich ist das reine Spekulation, das will ich gar
nicht bestreiten. Aber das Gegenteil ist ebenfalls nur Spekulation.“ Ich baute
das aus: „Die Sowjetunion schickt seit Gagarin, 1961, Planeten ins All. Ist
es abwegig zu glauben, dass Menschen eines Tages, vielleicht auf dem Mars
siedeln könnten? Dann sind wir eine Art Gott, zumal die Möglichkeit besteht,
dass wir Leben aus der Retorte zaubern können!“
Honolka war beeindruckt,
besonders als ich begann von der Watson-Crick-Spirale zu reden, dass ihre
Entdecker Watson und Crick, 1962 den Nobelpreis für ihre Arbeiten erhielt. Nun
stand fest, dass die Theorien des Sowjetstars Lyssenko falsch waren.
Ich sprach über die Konsequenzen.
Es sei unwahrscheinlich, dass alleine die blinde Natur das Erbgut festschreiben
konnte, dass umgerechnet zehn Buchbände zu je eintausend Seiten benötigt würden
um mit unseren Worten sozusagen eine Bauanleitung zur Herstellung eines
menschlichen Embryos zu verfassen. Dozent Lasse nickte. Er wusste schon mehr
davon, dass es Aminosäuren sind, die das Skript schreiben. Er gab zu, dass es
durchaus fragwürdig ist ob die Natur, wenn auch in Jahrmilliarden ein Lexikon
zustande bringen kann.
Nach und nach kamen wir zu mehr
Ruhe.
Dann sagte ich: „Meine Kirche
lehrt, dass viele Planeten bis in die entferntesten Galaxien bewohnt sind.”
Das sei meine persönliche
Interpretation, fuhr Honolka erneut auf. “Nein!”
Ich konnte beweisen, dass es Teil
unserer festgeschriebenen Religion war. K.P. Mose
“Wir glauben einfach, dass allem
Sein ein Plan zugrunde liegt, und dessen Ziel ist der ewige Fortschritt.”
Auf diesem Umweg gelang es mir,
ihren Blick darauf lenken, dass der Atheismus nur eine erst etwa
einhundertjährige Modeerscheinung war. Das zeige sich auch in der
Selbstverständlichkeit, mit der er vertreten werde. Das zeige sich in der
Leichtigkeit mit der er geglaubt wird. Es kostet keinerlei Mühe, mit der
Einstellung zu leben, dass es keinen Gott gibt. Aber jeder weiß, dass die
Entwicklung nach vorn und nach oben Anstrengung und Kraft erfordert.
Mit dem letzten Satz stimmten
meine 30 Mitschüler allesamt überein. Wir kamen einander immer näher, als sie
sahen, dass wir gemeinsam glaubten, es sei richtig sich zum Guten anzustrengen
und zu erwarten, dass solches Bemühen uns auf eine höhere Stufe auch der
Freiheit führen wird. Ich konnte weitere positive Argumente ins Feld führen die
sie nachdenklich stimmten.
Dieser rasche Wechsel aus
Widerspruch und Übereinstimmungen bewirkte, dass uns die zwei Stunden wie
Minuten vorkamen.
Physiklehrer Lasse fasste
schließlich zusammen: “Genossen, ich habe nicht geglaubt, dass es eine so
überzeugende Religion geben könnte. Ich kann nichts dagegen sagen. Oder seid
Ihr anderer Meinung?”
Es gab keinen Widerspruch!
Ich ging an diesem späten
Novemberabend nachdenklich nach Hause.
Hatte ich zu viel behauptet?
Beruhigend kamen mir plötzlich
die Worte aus dem Prolog des Johannesevangeliums in den Sinn: “Im Anfang war
das Wort (Jesus, der Gesetzgeber per Wort), und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch
ihn gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.” 1,1-3.
Die Sterne glitzerten.
Ich hob den Kopf, dachte an das
unselige Ende meines Vaters und plötzlich empfand ich ein Gefühl großer
Dankbarkeit, obwohl ich im Grunde immer noch tief traurig war. Ich spürte etwas
Erhabenes und Tröstliches. Ich erhielt das sichere Gefühl, ich würde ihn wieder
sehen. Ich war ihm immer verbunden gewesen, ich liebte die Lehren die er mir
übermittelt hatte, denn sie machten mich frei und reich. Vielleicht hätte er
über meine Argumentationsweise den Kopf geschüttelt, doch ich empfand
wunderbaren Frieden.
Immer wieder in den folgenden
Jahren und sogar Jahrzehnten sprachen mich ehemalige Klassenschüler an. Sie
hätten nichts vergessen.
Es sei vor allem die Atmosphäre
gewesen, die sie so nachhaltig beeindruckte: „da war etwas Besonderes!“
Ausgerechnet der Exkatholik
Honolka, der nebenbei gesagt, mit seiner straff am Leib sitzenden Kleidung eine
gute Figur abgab, setzte sich nach der Zeugnisausgabe, die wir in einer
nahegelegenen Gaststätte ein wenig feierten, zum Gespräch neben mich. Er mit
einem Bierglas in der Hand, ich mit meiner „Selters“. Hauptmann Honolka schlug
mir mit der flachen Hand aufs Knie und lachte. “Was Du gesagt hast, war
eigentlich verrückt. Einfach zu behaupten, dass Gott der Vater der Evolution
ist! Das hat mir noch keiner gesagt. Damit könnte ich leben – und wie Du Das
gesagt hast…” Sein noch junges, wen auch stark gefurchtes Gesicht blieb mir
für immer in Erinnerung.
Fritz
Nur wenige Wochen später
eröffnete mir Fritz Biederstaedt, fünfundzwanzig Jahre älter als ich und ein
Erzfeind der Kommunisten, völlig unerwartet, er würde jetzt in die SED
eintreten. Er habe sich für die letzten zwanzig Jahre seines Lebens noch viel
vorgenommen. Strahlend optimistisch behauptete er, noch könne er sein Leben
genießen. Er verband das Fantastische mit dem Gegenteil. Es sprudelte nur so
heraus aus ihm. Rückhaltlos versicherte er mir, seine innere Einstellung habe
sich nicht geändert. Nach wie vor dem hasse er den Kommunismus, das heißt er
verachtet die SED, wegen ihrer Lügen, er mag den ganzen politischen Quatsch
nicht. Aber noch an diesem Abend werde er sich von der Parteisekretärin Helene
Göck umarmen lassen.
Sein unbedingter Wille war,
bewusst das Falsche zu tun.
Er schimpfte an diesem Morgen, -
während wir an den Rändern der Torflöcher mit kleinen Sicheln Rohr ernteten, -
unentwegt auf Ulbricht den niemand leiden konnte.
Ich hielt ihm vor: “Fritz,
wenn Du so denkst, dann kannst Du doch nicht in seine Partei eintreten!”
“Doch,”
widersprach er und zwar auf Plattdeutsch: “Wenn Du wat warn wisst, denn mößt
Du dat!” (Wenn du etwas werden willst musst du zu Kreuze kriechen“ eat
humble pie
Unglaublich verworfen war diese
geknickte Kurve, die er mir als Kreis beschrieb. Ich fragte mich und ihn, was
er, der Sechzigjährige denn noch werden möchte. Was konnte er mehr sein als ein
Mann, der bei seiner Ehre und bei der Wahrheit blieb? Fritz fasste, in diesem
Augenblick, sein scharfes Werkzeug fester. Seine hochschäftigen Lederstiefel
patschten im schwarzen Sumpf. Er kam noch näher zu mir heran. Seine braunen
Augen funkelten. Es war ein Ausdruck, als wollte er niedermähen, was seinen
Aufstieg behindern könnte. Ich werde nie vergessen, wie wir uns inmitten dieser
von uns selbst geschaffenen Wände aus zehntausenden Rohrhalmen gegenüberstanden
und die unmöglichsten Gedanken gegeneinanderstellten. Nur der blaue Himmel war
unser Zeuge. Dann sagte er plötzlich mit dem charmantesten Lächeln der Welt: “So
dumm bist Du doch nicht, mich nicht zu verstehen!"
Mich schauten diese großen Augen
wieder friedlich an. Sie vermittelten diese sonderbare Mischung von Wissen aus
bitterer Lebenserfahrung, Spott und immer noch jungenhafter Unbekümmertheit,
die ihm stets zu eigen gewesen war.
Wir sahen ihn beide nicht, den
Todesengel, der schon lauernd hinter ihm stand. Wir ahnten gar nichts. 146
Lebenstage lagen noch vor ihm. Doch der kühne Mann, der übermütig seine eigene
Einsicht niedergerungen hatte, hoffte noch etwas erlangen zu können, das seiner
neuen Meinung nach, ohne Parteimitgliedschaft scheinbar in unerreichbarer Ferne
liegen bleiben würde. Ich wusste, was er meinte, aber es war mir fremd. Auch an
der Fischereiingenieurschule in Hubertushöhe, die ich dann einige Jahre lang
besuchte, bestätigten mir später einige Mitstudenten, zumeist schon ältere
Jahrgänge, sie wären der Partei beigetreten, weil man nichts erreichen kann,
wenn man sich quer stellt.
Prager Frühling 68
Alle Herzen, auch die der
Genossen, fühlten mit den Tschechen als während unserer Studienzeit der Prager
Frühling kam. Alle freuten sich darüber, dass Alexander Dubcek die Grenzen nach
Österreich durchlässiger machte. Begeistert verfolgten wir den Demokratisierungsprozess
in der Tschechoslowakei. Die bedeutenden Literaten des Landes und
Bürgerrechtler hatten mit Duldung der Regierung Dubček ein Manifest zur
Konstituierung eines Gremiums verbreitet, das für die Respektierung der
Menschenrechte in der CSSR eintrat. Diese Forderungen wurden Jahre später als
Charta 77 bekannt. Mit ungeteilter
Zustimmung und Staunen verfolgten wir im Februar 1968 die Entwicklung zur
Verwirklichung von mehr Bürgerrechten, sozusagen vor unserer Haustür. Dubček
hatte unglaublicher Weise die Pressezensur aufgehoben!
Unerwartet für nicht wenige wurde
der Wunsch nach mehr Freiheiten, plötzlich auch in der DDR immer lauter.
Hoffnung kam auf, auch wir dürften in den Westen reisen. War das nun ein
akzeptables Sozialismus-Modell, da sich da vor unseren Augen und Ohren entpuppte?
Kam nach dem endlos grauen Morgen endlich ein neuer Tag herauf? Würden auch wir
wieder ungestraft sagen dürfen was wir meinten und wollten? Wer die Hoffnung
schon aufgegeben hatte, erhob wieder den Kopf. Demgegenüber stellte sich den
empörten Machthabern des Kremls die Frage: Was tun? Die aus ihrer Sicht einzig
denkbare Antwort. lautete: Mit Gewalt einschreiten! Natürlich schraken nicht
wenige linientreue Mitdenker vor den daraus resultierenden Fragen und Folgen
zurück. Kann man es nach dem Panzerkrieg gegen Deutsche 1953, und gegen Ungarn,
1956, nur zwölf Jahre später, noch einmal wagen? Darf man, mitten in Europa,
vor den scharfen Augen der Weltöffentlichkeit, erneut eine Armee gegen
Friedliche schicken? Was werden die ohnehin kritischen Genossen dazu sagen?
Bis auf den heutigen Tag wissen
wir nicht, wie wenige Kommunisten eine militärische Intervention wünschten. Ich
glaube, dass nur die obersten
“Arbeiterführer” in den Hauptstädten Moskau, Berlin und Sofia pro-Moskau
Extremisten waren. Ihr Militär wird ihnen allerdings gehorchen, so wie die
Jesuiten ihrem General, auch wenn ihr Weiß, unleugbares Schwarz ist. Das, - den
bedingungslosen Gehorsam, - hatten sie ihren Offizieren und Mannschaften in
unendlich vielen Schulungen und mittels der guten Gehälter, beigebracht: nie
Fragen zu stellen, wenn die Partei befiehlt.
Spät in der Nacht zum 21. August
1968 marschierten Soldaten Polens, Bulgariens und der Sowjetunion in das
modernisierte Land ein. Ihnen wurde gesagt: „Es geht um den Weltfrieden. Der
Kapitalismus will sich im Osten wieder durchsetzen. Das dulden wir nicht.“
Etwa eine halbe Million Soldaten wurden benötigt, um die unbewaffneten
Demonstranten in die Knie zu zwingen. Deshalb rollten sie wieder, die Panzer
der Russen.
Vor und nach unserer Moskaureise
Gegen Ende meiner Fachschulausbildung kam mir
die Idee, Maränenbrut groß zu ziehen, so ähnlich wie wir Hechtbrütlinge in
Plasterinnen vorzustrecken begannen. Es müsste möglich sein, bei niedriger
Sterberate, sie wenigstens an Länge und Gewicht zu verdoppeln. Bei Forellen
funktionierte das doch ebenfalls.
Andernfalls würden mindestens 90 Prozent
dieser Winzlinge den Hungertod erleiden. Im letzten Studienjahr betrachteten
wir Neubrandenburger Binnenfischer dieses Vorhaben zwar gemeinsam, aber auch
ziemlich kritisch.
Was verloren wir also, wenn uns gelingen
sollte, die winzigen Maränen mit selbst gefangenen Zooplanktonten in den für
die Hechtanzucht bereits genutzten Plasteaquarien anzufüttern und so viele wie
möglich vor dem frühen Hungertod zu schützen? Denn genetisch besitzen sie
allesamt dieselben Über-lebenschancen. 1971 versuchte ich das Experiment.
Dreihunderttausend Stück frisch geschlüpfte Kleinmaränen setzten wir in sechs
Rinnen mit jeweils etwa sechshundert Liter Wasservolumen ein.
Das Neubrandenburger Leitungswasser erfüllte
glücklicherweise die erforderlichen Voraussetzungen, zumal wir es über eine
kleine Kaskade von Brettchen laufen ließen, um es so mit Sauerstoff
anzureichern. Die schnell und problemlos angefertigten großen Planktonnetze aus
Müllergaze fingen Hüpferlinge in Massen. Ich verkannte allerdings einen
entscheidenden Punkt, nämlich dass der Anteil der für uns interessanten
Vorstufen der Kleinkrebse, - der Nauplien - die sich noch in ersten
Häutungsstadien befinden, zu gering war. Es kam deshalb trotz großer
Futtermengen zu einem Massenmaränensterben.
Allmorgendlich lagen mehr und mehr tote
Fischchen auf den Böden unserer je vier Meter langen Rinnen. Erst der Biologe
Dr. Manfred Taege, genannt Männe, ein Verehrer des legendären Che Guevara,
Tiefseetaucher und persönlicher Freund des Bruders Fidel Castros, Buchautor und
Mitarbeiter des Institutes für Binnenfischerei Berlin-Friedrichshagen fand
heraus, dass wir kleineres Lebendfutter fangen und fortan sieben müssten. Ehe
wir allerdings die Erfolge erzielen konnten, von denen ich in meiner
Staatsexamensarbeit zu reden gewagt hatte, wäre ich doch noch um Haaresbreite
aus der Genossenschaft ‚geflogen’.
Das kam so: Mit unseren Ehefrauen planten wir einen 5-Tageausflug nach Moskau.
(Früher wurden Unsummen in alkoholischen Getränken angelegt. Jetzt floss das
Geld des Kulturfonds in andere Richtungen. Gewisse Umstände oder Zufälle
sollten einen großen Krach heraufbeschwören. Hermann Göck übernahm die Rolle
des Reiseleiters und das mit einer seinerseits überspannten Erwartungshaltung.
Zumal als Ehrenmitglied der PwF “Tollense” lag es nahe, ihm das Vergnügen zu
gönnen, für ein paar Tage unser Herr und Meister zu sein, aber nicht mehr. Der
geradlinige Altkommunist hielt allerdings die Zeit für gekommen, endlich den
Rest von Vorbehalten unsererseits gegen seinen geliebten Arbeiter - und Bauern
- Staat auszuräumen. Er hoffte und glaubte, wir würden Moskau mit seinen Augen
sehen und anschließend wünschen, seiner Partei beizutreten. So stand Hermann
Göck am Morgen des Tages unserer Abfahrt auf den breiten Stufen des “Hauses der
Kultur und Bildung” und ermahnte uns, in der Weltmetropole des Kommunismus als
würdige Vertreter der DDR aufzutreten. Wir landeten in Scheremetjewo 1 und das
gegen Abend. Um zu unserem Hotel in Ostankino zu gelangen mussten wir mit einem
Bus quer durch Moskau fahren. Natürlich hatten wir uns oft gefragt, wie die
Menschen in der Sowjetunion lebten. Eigentlich glaubten wir, dass wir in Moskau
ein Stück sozialistischer Zukunft erkennen würden. Moskau werden sie als
Schaustück hergerichtet haben, als Modell der Zukunftsplanung, dachten wir. So
wie den Moskauer Menschen jetzt, könnte es uns später einmal im vollkommen
verwirklichten Kommunismus ergehen.
Wie in einem Spezialfilm erhielten wir
während der späten Busfahrt Einblicke in eine Vielzahl Wohnungen, da sie sich,
fast ausnahmslos ohne Gardinen erwiesen. Wir sahen die Winzigkeit der von sehr
schlichten Lampen erhellten Stuben, die Armseligkeit der Ausstattung der Räume.
Die ganze Atmosphäre, in die ich auf diese Weise hineintauchte, wirkte
beklemmend. Ein Tisch, ein Wohnzimmerschrank, einer wie der andere gleich, vier
Stühle, ein Fernsehgerät. Diese elenden Löcher in den Massenquartieren sollten
der Gipfel der Errungenschaften sein? Aber was hatten wir denn erwartet?
Das jedenfalls nicht!
Ich konnte es nicht in passende Worte
fassen.
Doch andererseits: du hast es immer gewusst:
Das Individuum tritt vor der Masse Menschen in den Hintergrund.
Der Einzelne ist den führenden Kommunisten
gleichgültig. Mir war die Ungeheuerlichkeit solcher Anklage zwar bewusst, doch
ich fand sie hier bestätigt. Hermann Witte, der neben mir saß, stieß mich
unentwegt an.
„Süh di dat an!” ("Sie dir das an!") Seine Art und der
Rhythmus, in dem er mir seinen Ellenbogen in die Seite rammte, hieß, „hesst
du di dat so vörstellt?” ("Hast du dir das so vorgestellt?")
![]() Trotz vieler Negativberichte die ich mit der Zeit
erhielt, hatte ich diese Primitivität in ihrer Gesamtheit denn doch nicht
erwartet. Gemessen an der Formensprache durch die tempelartigen Hausriesen, die
ich von Bildbänden her kannte, war die individuelle Wohnkultur kläglich. War,
was ich sah, der ganze Ertrag von zwei Generationen Kampf und Arbeit und
Tränen? Natürlich, dazwischen war der Krieg gewesen. Was dagegen gelang den
„Kapitalisten“ in diesem Vierteljahrhundert aus den Ruinenstädten West-deutschlands
zu machen? Am folgenden Tag besuchten
wir den Roten Platz und in den beiden Freizeitstunden gingen zwei Ehepaare mit
Erika und mir in die naheliegende Kirche des Sergius von Radonesch, dann fuhren
wir, per Taxi, zur Epiphanienkathedrale. Die niedrige schlicht in braun bemalte
Decke des Hauptraumes beeindruckte uns. Alfred Voß unser Buchhalter und seine
Frau die aktive, evangelische Christen waren, staunten mit uns, was dort Jahr
1922 durch Malkunst ausgedrückt wurde. Wir wussten es ja: im Ringsum dieser
Kirche herrschte zu dieser Zeit Bürgerkrieg und Hunger.
Trotz vieler Negativberichte die ich mit der Zeit
erhielt, hatte ich diese Primitivität in ihrer Gesamtheit denn doch nicht
erwartet. Gemessen an der Formensprache durch die tempelartigen Hausriesen, die
ich von Bildbänden her kannte, war die individuelle Wohnkultur kläglich. War,
was ich sah, der ganze Ertrag von zwei Generationen Kampf und Arbeit und
Tränen? Natürlich, dazwischen war der Krieg gewesen. Was dagegen gelang den
„Kapitalisten“ in diesem Vierteljahrhundert aus den Ruinenstädten West-deutschlands
zu machen? Am folgenden Tag besuchten
wir den Roten Platz und in den beiden Freizeitstunden gingen zwei Ehepaare mit
Erika und mir in die naheliegende Kirche des Sergius von Radonesch, dann fuhren
wir, per Taxi, zur Epiphanienkathedrale. Die niedrige schlicht in braun bemalte
Decke des Hauptraumes beeindruckte uns. Alfred Voß unser Buchhalter und seine
Frau die aktive, evangelische Christen waren, staunten mit uns, was dort Jahr
1922 durch Malkunst ausgedrückt wurde. Wir wussten es ja: im Ringsum dieser
Kirche herrschte zu dieser Zeit Bürgerkrieg und Hunger.
Epiphanien-Kathedrale:
Wikipedia
Es war die Geschichte von der Samariterin am
Brunen. Zwölf Einzelbilder zeigten und erzählten was sich ereignete.
Hingebungsvoll sagt uns der Maler, wie Jesus eine Frau anspricht, die fünf
Männer gehabt hatte und die nun unverheiratet mit dem sechsten zusammenlebte,
was Jesus wusste. Ihr Erstaunen: „wie kannst du als ein Jude mich eine
Samariterin um Wasser bitten”, beschwichtigte er. All das fand hier seinen
schönen Ausdruck. Das war zeitloser Realismus der uns sagte, wie tiefgläubig
der Künstler war. Sowohl die Einfachheit wie die Ausdrucksstärke der Gesichter
Christi, der Samariterin und anderer sagten uns sehr zu. Ehrfurcht erfüllte
mich. Plötzlich laute, unangenehme Stimmen. Drei oder vier ältere schwarz
gekleidete Nonnen beschimpften uns. Ich verstand nichts, aber Alfred Voß. Er
hatte während seiner Jahre der Gefangenschaft in Russland immer wieder gewisse
Flüche gelernt. Auf meine Nachfrage sagte er: „Sie hält uns für rein
neugierige Gottlose. Wir sollen verschwinden.“
Draußen standen Mütter mit ihren in Decken
gehüllten Kleinstkindern Schlange, teilweise geschützt durch einen Holzzaun.
Sie brachten ihre Kleinen, die mindestens 40 Tage „alt“ sein sollten, zur
Taufe. Taufe ist ein dehnbarer Begriff. Er stammt aus dem griechischen
baptízein Untertauchen. Dreimal wird deshalb der winzige Erdenbürger durch
einen Priester, in einer Taufwanne, ganz und gar untergetaucht.
Wir sahen wenige Autos die vermutlich privat
gefahren wurden. Dafür gab es zahlreiche Taxis. Für wenige Kopeken konnte man
von Ort zu Ort gebracht werden. Aber, das Bemerkenswerte war: dass alle
zweihundert Meter ein Kilometer (Werst) Fahrstrecke angezeigt wurde. Billig war
es dennoch.
|
|
Bereits am zweiten Tag unserer Anwesenheit
erhielt Hermann Göck die auch ihm peinliche Information, dass wir am Mittwoch,
statt Freitag, abzureisen hätten. Moskau richte gerade einen internationalen
Ärztekongress aus. Es fehlten Hotelbetten und Verpflegungskapazitäten.
Unglücklicherweise saß ich am Morgen des rücksichtslos vorverlegten
Abreisetages neben einem Holländer, der mich angesprochen und in ein Gespräch
verwickelt hatte. Ich verabschiedete mich von ihm. Er stutzte, stellte
Nachfragen. Ich antwortete wahrheitsgemäß: „Wir haben nichts zu wollen. Uns
ist nur mitgeteilt worden, dass wir vorzeitig heimfahren müssen.” Der Mann
erwiderte: „Das gibt es nicht! Ihr habt doch einen Vertrag!” „Vertrag
hin, Vertrag her. Was sollen wir machen?” Im unpassendsten Augenblick, als
ein neuer mir nicht gerade gut gesonnener Kollege an uns vorbeiging äußerte der
Niederländer: „Dann müsst ihr eben streiken! Niemand darf euch zwei
Urlaubstage stehlen” Der Neue hatte schon immer gute Ohren gehabt und mir
bereits früher vorgeworfen, ich hätte ihn schon oft beleidigt. Ich sah es.
Meine Blicke verfolgten ihn. Sofort ging
mein neuer Mitfischer P. zu Hermann Göck. Seine Frau saß an Göcks Tisch und er
hätte ohnehin zu ihm gehen müssen. Doch ich fand, dass er sich sehr beeilte.
Ich sah, wie sie miteinander tuschelten. Meinem Eindruck nach redeten sie
ziemlich intensiv über mich. Hermann Göck würde nicht nur erfahren, dass und
wie ich mit einem westlichen Ausländer über einen Streik in der DDR gesprochen
habe, sondern auch von anderen Übertretungen, die ich mitunter beging. Ich sah,
wie sie nebeneinander hockend wiederholt zu mir herüberschielten. Mir schien,
ich könnte Hermann Göcks Ärger sogar verstehen. Er war mit dermaßen großen
Wünschen hierhergekommen und nun sah er seine Hoffnungen rapide schwinden. Er
liebte dieses Land, diese Menschen und das System. Er glaubte nun, ich würde
alles verachten. Aber ich missachtete weder Land noch Leute. Im Gegenteil. Ich
mochte nur nicht, wie in diesem Land mit Menschen umgesprungen wurde, was die
kommunistische Führung ihnen zum Leben übrigließ, was sie ihnen zumutete. Jeden
Rubel den sie für ihre Militärmacht einsetzten ging zu Lasten des Wohlstandes
der normalen Bürger dieses Riesenlandes.
Wie erst würde es im Hinterland aussehen? Wie
lebten sie in den Dörfern Sibiriens?
Hermann Göck hatte gehofft, wir würden von
seinem Moskau begeistert sein und so fühlte er sich nun verspottet. Ich spürte,
dass Hermann den Zorn aus maßloser Enttäuschung kaum noch unterdrücken konnte.
Doch er fraß den Ärger vorläufig in sich hinein. Er schwieg und grollte. Ich
musste ihm ja bald, wenn wir erst wieder daheim angelangt waren, über den Weg
laufen.
Wir besuchten jedoch noch Lenin. Das wurde uns als Trostpflaster zugestanden.
Vorbei an riesigen Menschenschlangen von Menschen aller Couleur, die allesamt
den einbalsamierten großen Revolutionär in seinem Mausoleum sehen wollten,
wurden wir bevorzugt. Zig Tausende mussten wohl stundenlang warten, während wir
an ihnen schnurstracks vorbeizogen.
Da lag er nun. Und ich starrte auf seine
geballte Rechte.
Ich sah sie, wie er sie – in Dokumentarfilmen
– reckte und seine Thesen verkündete, die das Land in noch tiefere Krisen
stürzen sollte. Mich überkam Kälte. Ich sah Lenins Kommissare mit der Pistole
und dem Strick agieren.
Hermann Göck dagegen zeigte sich ergriffen. Ahnst du nicht, was ich fühle und
denke? Natürlich war ich stets bemüht zu differenzieren. Ich meinte, ich könnte
mich in die damalige Situation ein wenig hineinversetzen. In diesem riesigen
Land musste damals, 1917, nach dreijährigem, sinnlosem Blutvergießen, zugunsten
der tatsächlich Unterdrückten etwas Entscheidendes geschehen. Eine Clique
gnadenloser selbstherrlicher Gutsbesitzer, Zaristen und Pfaffen übte die
absolute Vorherrschaft aus und forderte frech die Gerechtigkeit heraus.
Unheiliger konnte eine Dreifaltigkeit kaum sein. Viel zu lange schon verlief
die Grenze zur Unmenschlichkeit mitten durch das zaristische Russland. Das
konnte so nicht ewig weitergehen. Große Änderungen waren zwingend erforderlich.
Aber doch nicht so, wie du dir ausgedacht hast, Lenin.
Bis dahin empfand ich einen gewissen Grad
Respekt vor diesem Giganten der Weltpolitik. Das war mit einem Schlag vorbei.
Auch Stalins balsamierten Leichnam hätte ich gern gesehen. Aber einige Jahre
nach Chruschtschows Geheimrede 1956 war der zum Verbrecher erklärte Tote an der
Kremlmauer beigesetzt worden. Dort sahen wir nur die Grabstelle und die vielen
frischen Blumen, die seine Verehrer, wie wir hörten, täglich erneuerten. Nur
die Büste Stalins zu sehen, brachte mir nichts. Ich empfand weder Abscheu noch Kälte,
als ich dann unmittelbar vor ihr stehen blieb. Er war mir in dieser Situation
nur gleichgültig.
Da wir in Ostankino im Hotel wohnten, wo
möglicherweise immer noch die bittersauren Weintrauben in unserem Zimmer
liegen, die wir gekauft hatten, weil sie reif aussahen, durften wir
hinauffahren zum Restaurant des gleichnamigen Fernsehturms. Wir bewunderten die
ingenieurtechnische Leistung. Denn die Kuppel dreht sich einmal in der Stunde
um die Achse und bot einen herrlichen Ausblick über die riesige Stadt und das
sich weithin ausbreitende Grün. Auf der Busfahrt zum Flugplatz fragte mich
Helene Göck was ich denke. Sollte ich ihr wirklich sagen, was mir Lenin so
unsympathisch erscheinen ließ. Er kultivierte lediglich eine andere Variante
der Willenseinschränkung. Aber Menschen sind ausnahmslos freiheits- und
liebebedürftig. Doch Helene Göck gegenüber drückte ich meine Gedanken nicht so
scharf formuliert aus. Hermann Witte dagegen ließ seinem Unmut auf der
Rückreise freien Lauf. Er schimpfte und spottete darüber, dass sie sich
herausgenommen hatten, Vertragsbruch zu begehen und uns, mir nichts dir nichts,
abzuschieben und wegzujagen wie Geschmeiß. Hemmungslos beklagte Witte, dass es
in einer Weltmetropole kein Bier gab, jedenfalls nicht für sein Geld, dass es
dort für Rubel nichts Billiges zu kaufen gab, außer Brot und Salz und
Kofferradios. Die Schuhe und diese Preise, die Möbel. Tausend Tische in einem
Riesenladen, aber einer wie der andere. Hundert Wohnzimmerschränke, alle
gleich, so gleich wie die Partei, die von ihr regierten und dirigierten
Menschen machte. Hermann Witte war einer von der Art Leute, die, wenn sie zu
lästern beginnen, nicht wieder aufhören können. Wie ein alberner Schulbengel
reizte er mit dem scharfen Gegluckse seinen Lehrer. Vor allem während der Fahrt
von Berlin zurück nach Neubrandenburg hörte man im D-Zugwagen seine
durchdringende Stimme quäken und dröhnen: „Wenn dat de ganze Kommunismus is,
denn führt ji nächstes Mol alleen, lot mi man an Land.” ("Wenn das der
ganze Kommunismus ist, dann könnt ihr nächstes Mal ohne mich dahinfahren. Lasst
mich an Land!")
Wenn es für angebracht hielt, nahm er kein
Blatt vor den Mund. Einmal griff mich ein mit uns auf den See hinausfahrender
Stasioffizier, an. Ein Mann der mich persönlich nicht kannte. Das hätte er
unterlassen sollen. Zum ersten Mal in meinem Leben hörte ich Hermann
hochdeutsch reden: „Skibbe attackierst du nicht! Der ist dir überlegen!“
Helene und Hermann Göck schwiegen und schämten sich wegen Wittes Spott. Nachdem wir wieder daheim angelangt waren und unmittelbar bevor wir uns voneinander verabschiedeten, kündigte Hermann Göck für den kommenden Montagabend seinen Besuch in unserer Fischereibaracke an. Er wünsche mit allen Männern zu reden.
Das ist Hermann. mein langjähriger Kollege,
Hermann Witte, Geburtsjahr 1915, gewesener Frontsoldat im Osten, der die
anbefohlene Sprengung eines Gebäudes verweigerte, nachdem er als
Stosstruppteilnehmer, bis in die Schlafräume russischer Soldaten eindringen
konnte. Er hörte sie schnaufen und war unfähig seine Mitmenschen, die ihm
nichts zuleide getan hatten, zu zerfetzen.
Nicht nur einmal teilte er mit mir das letzte
Stück Brot, wenn wir nach einer Havarie nachts stecken blieben.
Er arbeitete fast dreißig Jahre lang im rechten
Kahn, ich eben solange im linken.
Hermann hatte drei Jahre lang, als Lehrling
im Mormonenhaushalt der Familie Paul Meyer, - Vater von Kurt - Cammin gelebt
und wusste nahezu alles von unserer Religion.
Bei seinem Naturell wurde dieses Wissen zu
einem nie versiegenden Quell seines Humors. Manchmal war es peinlich, manchmal
trieb sein Leichtsinn ihn hart an die Grenze des Anständigen. Stilblüten aller
Art in die Welt zu setzen, waren seine Selbstverständlichkeit.
Wo und wann immer ihm danach zumute war, mich
zu verspotten tat er das auf unnachahmliche Weise. Um Sachlichkeit ging es ihm
selten oder nie, immer nur um den Klamauk, ums Lachen der Anderen in das er mit
listig blitzenden Augen und breitem Grinsen einstimmte.
Er selbst war zu schallendem Lachen unfähig
und eigentlich sehr mitfühlend, kameradschaftlich und durch und durch ehrlich.
Allerdings in Worten rigoros.
Der Montag kam und ich wünschte am Morgen,
dass es schon Abend, und alles vorbei, wäre. Schließlich saßen wir beklommen
da. Alle spürten die Gewitterluft. Er kam, begrüßte jeden, lächelte sogar ein
bisschen. Das bleiche lange Gesicht mit der Thälmannfalte verhieß wirklich
nichts Gutes. Reinhard Lüdtke, der neue Vorsitzende, eröffnete die
Zusammenkunft.
Das Unbehagen war auch ihm anzumerken. Blond
und beherrscht saß der dreißigjährige Vorsitzende da, hilflos. Wie wir, sah er
voraus, dass gleich die Fetzen fliegen würden. Da war nichts abzuwenden. Er gab
dem Gast, der kein Gast, sondern stets als gleichberechtigtes Mitglied
behandelt sein wollte, sehr bald das Wort. Hermann Göck dankte. Zunächst
grummelte es nur verhalten aus seiner erregten Seelentiefe hervor. Der alte
Vorsitzende Bartel, seit Jahren Mitglied der Partei, senkte den Kopf. Auch er
hatte seine Lektionen erst bei dem Ehrenfischer Göck lernen müssen. Der fragte
nun Hermann Witte, ob es ihm selbst nicht peinlich gewesen sei, so furchtbar
kindisch auf die Sowjetunion zu schimpfen und herumzulamentieren. Im Zug, vor
fremden Ohren, die glauben müssten, er wäre in Moskau miserabel behandelt
worden. Solche faustdicken Lügen! Unerhört. Ob er nicht hervorragend verpflegt
worden sei. Hermann Witte saß den Buckel gewölbt, schuldbewusst und schweigend
da. Den kräftigen Kopf mit den auffallend großen wasserblauen Augen nach vorn
ausgestreckt, steckte er die Rüffel ohne Widerrede ein. Rot war er angelaufen.
Natürlich leuchtete ihm längst ein, dass er überzogen hatte. „Kein Bäär,
kein Bäär!”, (Kein Bier, keine Bier) versuchte Göck sich in Wittes
unnachahmlichem Tonfall. „Mensch kein Bäär! Säufst doch auch sonst nich
jeden Tag Bäär!” Betroffenheit breitete sich aus, erfasste auch die
Unschuldigen. Unser Reiseleiter und Ehrenmitglied ließ nicht nach: „Da ist
wohl noch viel Unkraut und mancherlei reaktionäres Zeug in den Köpfen einiger!
... Du, Hermann Witte, hast...” Von mangelndem Ehrgefühl und nicht dem
geringsten Empfinden für Takt und Anstand war die lange Rede.
„Ich hätte mehr von dir gehalten!” Ob Hermann Witte klar war, dass die
Schelte ihm nur in zweiter Linie galt? Ich wusste, Hermann Göck meinte mich.
Sein weißes Gesicht bekam Farbe. Dass ich mit einem Westdeutschen oder einem
Holländer offen DDR-feindlich geredet habe, hielt er sicherlich sowohl für
erwiesen wie auch für die Spitze denkbarer Bosheit. Ich war der Hauptverderber
dieser in mehrfacher Hinsicht misslungenen Reise.
Ich konnte nicht mehr abwarten. Was er mir
sagen wollte, solle er denn auch direkt an mich richten. Sofort, als ich ihn so
aufforderte doch unverblümt zu sagen, was ihn in Wahrheit bedrücke, brach es
mit elementarer Gewalt aus ihm hervor. Krachend flog der Vulkankegel weg.
Hemmungslos schrie er mich an und spuckte
minutenlang Feuer und Lava. „Beleidigung der Sowjetmenschen. Hast du
überhaupt keinen blassen Schimmer, was diese Menschen gelitten haben... du...
Streik... Rausschmeißen aus der Genossenschaft. Boykotthetze...Reiseverbot für
ewige Zeiten.” Seine Liebe für Menschen, Land und vor allem zu seiner
Partei trieb ihn in diesen Irrtum, aber auch seine bedingungslose Hingabe an
die große Idee, die ich in Frage zu stellen wagte. Ich, der Erdenwurm, hatte
mir erlaubt sein Heiligtum zu besudeln. All das war eins für ihn. So viele
Jahre hatte er vergeblich um mich geworben.
Seine Bitterkeit schmeckte auch mir wie Galle. Er konnte und wollte nicht
tolerieren, dass ich seine sozialistische Staatengemeinschaft nicht
wertschätzte. Besseres als sie konnte es nicht geben, für ihn. Da war es
wieder, was ich hasste, diese Unterstellung, wer seine Partei und die
Sowjetunion nicht liebte, der sei ein Volksfeind. Er goss seinen Zorn in neue,
stärkere Worte. Er beschuldigte mich weiterer Vergehen. Alles sehr laut und im
Brustton grenzenloser Empörung. Was er nun sagte, ich achte die Sowjetfrauen
nicht, war ihm ebenfalls geflüstert worden. Eindeutig! Nur einem bestimmten
Mann aus meiner Nachbarschaft, hatte ich, einen Tag nach der vorzeitigen
Rückkehr aus Moskau geschildert, wie ich, bei unserem Ausflug in die
Leningedenkstätte Gorki, bei einem Schrankenstopp gesehen hatte, dass acht
Frauen eine mächtige Eisenbahnschiene schleppten. Tapfer hielten sie das
Hebezeug und sie gingen Schritt für Schritt über den Schotter. Ich konnte
spüren wie diese Trägerinnen sich aufeinander absolut verlassen konnten, wie
ruhig sie nämlich arbeiteten. Nur, rechts und links der Schwerlastträgerinnen
befanden sich zwei Männer, die jeder mit einem Signalhorn bewaffnet seelenruhig
mitanschauten, wie die Mütter und Ehefrauen sich abquälten. Genüsslich indessen
bliesen die beiden Herren der Schöpfung den Zigarettenqualm in die blaue Luft.
Diese Selbstverständlichkeit auf beiden Seiten hatte mich ziemlich schockiert.
Jetzt hörte ich von Hermann Göck, ich wäre ein Feind der großartigen Idee von
der Gleichberechtigung der Frauen. Mir wäre es ein Gräuel zu sehen, dass die
Männer für die Sicherheit im Schienenverkehr sorgten. „Das sieht dir
ähnlich!”, schimpfte er. Ich hätte auch kein Recht, mich über die Preise
einfacher Schuhe aufzuhalten.
„Botten!”, sagte er höhnisch. Ich hätte sie ‚Botten’ genannt statt Schuhe. Das
stimmte!
Aber woher wusste er das? Jetzt war ich
gänzlich sicher. Nur S.H. gegenüber, unserem Nachbarn, der an sehr
verantwortlicher Stelle im Rat des Kreises Neubrandenburg saß, war ich, am Tage
der Heimkehr, so offen gewesen, sowohl die Schwerstarbeit durch Frauen, wie
auch die ungeheuren Preise für so grobe ‚Botten’ zu beklagen. Dieser
Opportunist S. H. hatte mich also bei Hermann Göck angezeigt. S.H. war nicht
ehrlich. Als Staatsfunktionär durfte er keine Westpakete erhalten, auch nicht
indirekt. Diese gingen, da er sie, wenn auch illegal, empfangen wollte, an die
Adressen seiner Verwandtschaft auf dem Lande. (Über Kindermund war diese
Tatsache an meine Kinder bereits seit Jahren ausgeplappert und an meine Ohren
getragen worden: „Ätsch! Unsre Sarotti kriegen wir doch! Die holt Papa immer
von unserer Oma ab!”) Diesem S. H., der nach außen hin so glatt und rot
war, und so tat, als würde er von allen der Linientreueste sein, als habe er
die Weisheit löffelweise gefressen, hatte ich mit diesen beiden Schilderungen
lediglich eine gewisse Frage gestellt: Ob er nicht manchmal Mitleid empfände
mit den in der SU lebenden Menschen, die sich in erster Linie für das ungeheure
Rüstungsprogramm des roten Imperiums abschuften mussten. Hätte er mir daraufhin
nicht eine sachliche Antwort geben können und mir ruhig erläutern können, wie
er das sieht? Statt hinzurennen ans Telefon und wutentbrannt die Göcksche
Nummer zu wählen?
Ich gebe zu, ganz unschuldig an dieser
Verpetzung war ich nicht.
Als ich nämlich am Samstag nach der Rückkehr
aus Moskau einem meiner Hausmitbewohner erzählte, dass ich S.H. mit gewissen
Tatsachen konfrontiert und mit heiklen Fragen attackiert habe, lachte dieser
und erzählte mir ebenfalls eine uns beide erheiternde Geschichte über S.H., der
auch ihn schon einmal auf so arrogante Weise behandelt hatte. Während wir
herausfordernd über ihn lachend im Vorgarten beieinanderstanden und
hinaufschauten zu einem gewissen Fenster in der Nachbarschaft, erschien
zufällig das Gesicht des Mannes im Fenster, auf dessen Kosten wir uns
amüsierten. Wir beide wussten nämlich die Sache mit den Westpaketen, die S.H.
klammheimlich empfing. S.H., obwohl er kein Wort gehört haben konnte, musste es
erspürt haben, dass wir ihn auslachten. Daraufhin ist er hingegangen, um mich
bei Hermann Göck anzuzeigen. Dass es so war, lag nun auf der Hand. Denn Hermann
Göck erwähnte zu alledem, nämlich in seiner anhaltenden Schimpfkanonade, ich
wäre ein verbohrter großer Esel, der nicht begreifen will, dass die gigantischen
sowjetischen Rüstungsanstrengungen den Menschen dort nicht weh täten und dass
niemand sie deshalb bemitleiden müsste. „Jawohl! Aber wer
sozialismusfeindlich eingestellt ist, wird das nie verstehen können...”
Ich wollte ihm nun in die Parade springen, kam jedoch nicht zu Wort.
Mir schien, ich dürfte nichts auf mir sitzen lassen, dem auch nur der Geruch
von Unrecht anhaftete. Er redete und redete. Er habe mir ein für alle Mal
verständlich zu machen, was ich anscheinend nicht begreifen wollte: „Millionen
haben im Befreiungskampf gegen den Faschismus ihr Leben verloren und du, du
...” Viele Worte prasselten weiterhin auf mich und uns herunter. „... endlose
Opfer... verbrannte Erde...” Wie durch einen Lautsprecher dröhnte er und
alle andern saßen wie versteinert da. Hermann Göck erklärte, ich sei unwürdig
Genossenschaftler zu bleiben. Das war der Augenblick, an dem es für mich
gefährlich wurde. Zwei, drei wirkungsvollen Sekunden lang stand seine Forderung
wie ein Ausrufungszeichen im kleinen ‚Kulturraum’, mit immer noch demselben vollgestaubten
Radio aus der Frühzeit der Genossenschaft. Mich packte ein ungeheures
Gefühlsgemenge aus Wut und Mut, aus Angst und Stolz. Zehn Dezibel lauter als
er, gab ich meine Gegenerklärung ab: „Ich bin maßlos enttäuscht, wenn das,
was wir gesehen haben, das ganze Ergebnis von sechzig Jahren Kommunismus ist.
Das will ich dir sagen, Hermann Göck, auch wenn du das anders hinstellen
möchtest. Mich dauern all diese zahllosen durch willkürliche Eingriffe
zerstörten Familien, es tut mir weh zu sehen, dass in Kriegs- und
Friedenszeiten Abermillionen für ein fast Nichts an Verbesserungen ihr Leben
hingegeben haben und jetzt für den Weltfrieden immer noch zuerst Panzer
und Kanonen bauen müssen, müssen, müssen. Ich weiß auch um die guten Sachen im
Sozialismus. Aber die decken nicht die Mängel und die Wunden zu. Ich kann die
Menschen dort nicht beneiden.” Weil ich unnatürlich laut und viel redete
war meine Wortwahl nicht gerade die Beste, feinste. In Wahrheit schrie ich, nur
weil ich meine Bedenken zu überwinden hatte, ich käme zu spät zu Wort. Er
setzte zu einer Erwiderung an. Es sei unerhört, dass ich nicht reuig in mich
ginge.
Nun aber ließ ich ihn nicht zum Zuge kommen. Entschlossen mich zu behaupten
riss es mich hin zu behaupten: „Deine niederträchtigen Informanten kenne
ich!” Er stutzte. Ich nannte ihm beide Namen. „Dieser S. H. und dein P.
hatten beide nicht den Mut, mit mir Auge in Auge ins Gericht zu gehen! Da haben
sie dich vorgeschoben! Das ist Feigheit vor dem Feind.” Ich wiederholte
dröhnend die beiden Namen und exakt das, was er nur von dem einen und was er
von dem anderen vernommen haben konnte. Viel lieber als mich so meiner Haut zu
wehren, wäre ich in ein Mauseloch gekrochen. Doch ich blieb fest, ich würde
keinen Millimeter von dem, was ich geäußert hätte, abweichen. Meine Kollegen
schauten mich betroffen an. Reinhardt Lüdtke rutschte auf dem harten Stuhl hin
und her. Ihm fiel nichts ein, die Richtung der immer noch unberechenbaren
Auseinandersetzung zu beeinflussen. Reiners Augen rollten, als wollte er mir
bedeuten sofort den Mund zu halten. Mein Trotz würde alles nur verschlimmern.
Mir blieb aber keine Wahl.
Mir blieb nur übrig, mich mit Hilfe der
Wahrheit zu verteidigen. Meine Tatsachen hatten ihre Wirkung auf meinen
hocherregten alten Freundfeind nicht verfehlt. Sie verschafften sich Gehör und
Raum. Ihn beeindruckte offensichtlich, dass ich immer noch zu dem stand, was
ich gesagt hatte: „Der Sozialismus hat bessere Seiten als die von mir
kritisierten.” Nun konnte ich ruhig hinzusetzen und erklären, was mein
Intimfeind nicht richtig verstanden, aber dennoch an ihn weitergegeben hatte: „Von
einem Streik, Hermann Göck, habe nicht ich, sondern der Holländer gesprochen.
Ihr habt doch für fünf oder sieben Tage bezahlt, lasst euch das nicht gefallen.
Das ist doch wohl ein Unterschied wie Tag und Nacht!“
„Aber das hättest du dem fremden Mann ja auch
nicht auf die Nase binden müssen.”
„Darum geht es ja gar nicht!”, hielt ich dagegen, „ich
bin genau so traurig wie du! Ich habe mich lediglich von meinem Tischnachbarn
verabschiedet!“
Göck schaute mich nun aus großen Augen an,
wie ich ihn. Seine, meinerseits befürchtete endgültige Erwiderung blieb
erstaunlicherweise aus. Er wiederholte betroffen und mit auffallender
Verwunderung den Namen S.H. Deshalb schwenkte er um. Er sagte plötzlich, aber
wieder in normaler Lautstärke: „Ich werde S.H. fragen, warum er vor dir
gekniffen hat.” Er kratzte ein Ohr. „Den kaufe ich mir!”, erwiderte
er. Er werde ihm den Marsch blasen! – „Ich! … ” So heftig wie die
Aussprache begonnen hatte, so jäh endete sie. Plötzlich war von seinem Antrag
auf meinen Ausschluss aus der Genossenschaft keine Rede mehr. Die ungeheure
Macht der Partei, die hinter ihm stand, bedrohte mich nicht mehr direkt. Dass
S.H. ihn vorzuschicken gewagt hätte, nahm er ihm übel. Wort für Wort hatte ich
in dieser Zusammenkunft unter zehn Zeugen offengelegt, was ich S.H. gesagt habe
und wie hinterhältig er reagierte. Die Westpaketgeschichten gehörten hier nicht
her und so vergalt ich es ihm nicht. Mir lag daran, die Situation weiter zu
entspannen. Ziemlich behutsam äußerte ich deshalb, dass mir stets gewisse
Bilder vor Augen stünden. Darum ginge es. Alles andere sei mir gleichgültig. In
riesigen primitiven Arbeitslagern hätten unschuldig inhaftierte russische
Menschen jahrzehntelang hausen und darben müssen. Fernab ihrer Familien mussten
sie sich aus einem einzigen Grund zu Tode rackern. Nämlich um Workutas Straßen
zu bauen. Alles wegen Stalins Größenwahn. Sogar in unserer DDR-Presse wurde der
Wahnwitz, als „Personenkult“ bloßgestellt. Wortwörtlich konnte ich
wieder und wieder aus seinem “Neuen Deutschland” zitieren. Ihm aber weitere
Grobheiten ins Gesicht zu schmettern, nahm ich mir nicht heraus. Man muss ja
nicht unentwegt im Klartext formulieren. Inmitten der Worte schwingen ohnehin
die Töne des echten Gefühls. „Ja, der verfluchte Krieg!”, erwiderte
Hermann, und ich war froh, dass er es so deutete. Als er schließlich
davongegangen war, ebenso mattgekämpft wie ich, klopften mir Witte, Fritz Sack
und andere Kollegen auf die Schulter. Dem hätte ich es aber gegeben. Das jedoch
war nicht meine Absicht gewesen. Es ging um mehr. Äußerlich erschien ich
wahrscheinlich gelassen, doch meine Knie zitterten und auch mein Gemüt bebte
nach. Dass es Verleumder gibt, ist eine Tatsache, dass man mit ihnen leben muss,
ist schwer. Mir wäre eine ruhige Auseinandersetzung auch lieber gewesen. Die
Angst der Ungewissheit blieb eine Weile bei mir.
Mein Glück, dass Mitfischer P. an diesem Tag elend genug zumute war und sich in
dieser Versammlung nicht sehen ließ.
Erst einige Wochen später sah ich Hermann
Göck wieder. Mir schien, er ginge gebeugt. Langsam setzte er seine langen
Beine. Er kam aus Richtung des Krankenhauses in der Külzstraße. Ich wich ihm
nicht aus, sondern ging auf ihn zu. „Lenchen liegt im Koma!” teilte er
mir mit und streckte mir die Rechte hin. Die innere Erschütterung stand ihm ins
Gesicht geschrieben. Seine Frau war stets nur freundlich zu mir gewesen. Ich
wusste, wie sehr beide aneinanderhingen. Unter den Blättern und hängenden
Zweigen einer bereits herbstlich eingefärbten Birke stand er mit seinem weißen,
sorgfältig gescheitelten Haar. Ein gebrochener Mann. Unerwartet muss ihn mit
Härte die Erkenntnis getroffen haben, dass uns allen Grenzen gesetzt sind. Als
alte Freunde, die ihren Streit längst vergessen hatten, redeten wir
miteinander. Es war auch ihm, denke ich, angenehm, dass wir einander nichts
nachtrugen, sondern damit leben konnten, dass unterschiedliche Menschen
grundsätzlich andere Denkansätze hegten.
1973 - und die Ungarnreise 1974
Die Kirche hielt in Europa ihre 3. Gebietsgeneralkonferenz in München ab. Nur
wer aus der DDR durfte daran teilnehmen?
Fünf Männer im arbeitsfähigen Alter waren wir, Henry Burkhardt der
Missions-präsident, Gottlieb Richter, sein 2. Ratgeber und drei
Distriktpräsidenten, Lothar Ebisch, Walter Schiele und ich, - mehr Nichtrentner
durften nicht nach München, in den kapitalistischen Westen reisen. Wir hörten
beglückt Präsident H.B.Lee und den Tabernakelchor! Es war großartig. Es
erinnerte mich an jene große Konferenz in Berlin 1938 mit Heber J. Grant. Da
erklang damals eine jubelnde Fanfare von der Nachbarloge unserer Tribüne. Unten
saßen die Missionarinnen auf dem Podium. An sie kann ich mich erinnern, weil
einige von ihnen schluchzend weinten. Als Achtjähriger konnte ich damals noch
nicht verstehen warum man bei einem freudigen Ereignis Tränen vergießen muss.
Um Haaresbreite wäre ich in München nicht
dabei gewesen. Zehn Stunden vor der Abfahrt mit dem letztmöglichen Zug wusste
ich noch nicht, ob die Regierung grünes Licht geben würde. Kurz vor Mitternacht
ruderte ich vom schwarzen See zum nächsten Telefon in einer Gaststätte. So
erfuhr ich gerade noch rechtzeitig, dass ich darf.
Unvergessen
für immer, rührte uns die Ansprache von Gordon B. Hinkley: „Das Haupt das
die Krone trägt ruht nicht bequem.“
Bei der Rückreise wurden wir kontrolliert.
Die ostdeutsche Zöllnerin fand mein kleines Liederheft, schlug es auf und las
den Titel „Mehr Heiligkeit gib mir”. Ihre Augen rollten. Sie blinzelte
mich leicht spöttisch fragend an. Ich zuckte mit den Achseln und dachte in ihr
angenehmes Gesicht hinein: nun ja, wir bemühen uns!
Sie fragte wortlos zurück: und worüber haben
sie Sechs sich noch eben, kurz bevor ich eintrat, so köstlich amüsiert?
“Wir hatten Spaß miteinander!”
Lothar Ebisch der in Sachsen eine
Papierfabrik leitete, hatte einen politischen Witz erzählt…Das musste sie nicht
wissen. Hätten wir erwidern sollen, wir freuen uns wieder in den Käfig zu
kommen?
Schon vor den Tagen des frühen Herbstes 1974, noch bevor wir unseren Betriebsausflug ins Land der Magyaren starteten, erinnerte ich mich deutlich der jüngeren, traurigen Vergangenheit dieses Landes.
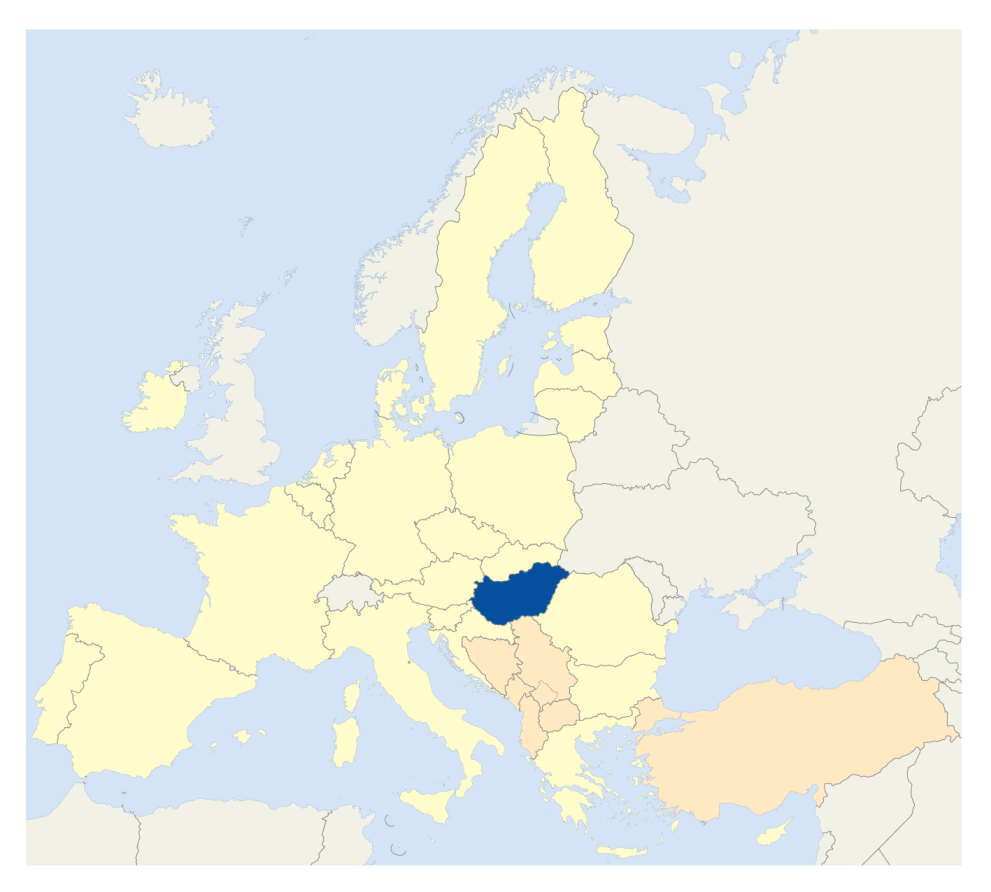
Das tragische Schicksal des damaligen Ministerpräsidenten Imre Nagy und seiner Unterstützer stand in Bildern vor mir. Menschen meines Schlages konnten und wollten nicht vergessen, dass 1956 in Budapest, wie drei Jahre zuvor in Berlin, demokratisches Denken und Wünschen mit Waffengewalt niedergewalzt wurde. Die breite Mehrheit der Ungarn wollte sich von beklemmender, sowjetrussischer Bevormundung befreien, und der reformwillige Kommunist Nagy ließ zu, dass seines Volkes Forderungen nach freien Wahlen straffrei erhoben werden durften.
Es ist wohl wahr, dass die Rote Armee, 1944/45, Ungarn von faschistisch und antisemitisch orientierten „Pfeilkreuzlern“ und deren Gesinnungsgenossen befreite: Aber, dass diesem Land der Bauern und Studenten anschließend die Lenin-Stalin-Ideenwelt aufoktroyiert werden sollte, lehnten, laut Ergebnissen der ersten und einzigen freien Wahl 1945, 83 Prozent ab. Die Partei der Kommunisten erhielt nur 17 Prozent der Stimmen. Mit List und Tücke, - sehr ähnlich wie Kuckuck-Babys ihre Mitkücken, als Überlebenskonkurrenten, brutal ins Verderben stießen – behauptete diese Minderheit bald die absolute Oberhand.
Aus Sicht Erz-kommunistischer Politiker hätte Imre Nagy insbesondere den jungen und alten Intellektuellen niemals freien Lauf zugestehen dürfen. Diesen Ideenträgern hätte, - so die Ansichten der Total-Roten, - die vom Kreml gebilligte Regierung Nagys, Paroli bieten müssen.
Was er zuließ, galt als Verrat an den „hehren“ Prinzipien der „neuen Gesellschaftsordnung“. Alle Menschen unter russischer Vorherrschaft mussten hinlänglich indoktriniert werden. Dissidenten zu gängeln, war oberste Pflicht jedes Parteisoldaten. Nun aber erhoben sich zehntausende Ungarn und demonstrierten mit Plakaten für Presse- und Meinungsfreiheit. Die Erhebung nahm um den 23, Oktober 56 Fahrt auf. Es kam seitens der Budapester zu Ausschreitungen. Parteizentralen wurden gestürmt, deren Personal angegriffen. Chruschtschow tobte und schwor Rache. Am 4. November rückten 15 Divisionen der Sowjetarmee mit 2.000 Panzern und etwa 200.000 Soldaten ein. Sie zerschlugen in den darauffolgenden Tagen den Aufstand unter erbittertem Widerstand. Mehr als 2 000 Menschen, zumeist die unter 40-Jährigen kamen bis zum 11. November zu Tode. Gnadenlos bestraften die sogenannten „Sieger der Geschichte“ zuerst die Aufständischen, dann Nagy. Er wurde erhängt.
Auch wenn die große Tragödie fast zwanzig Jahre zurücklag. Diese fernen Ereignisse gehörten nicht nur für mich zum Schlimmsten, was die Roten in Friedenszeiten jemals verbrochen hatten.
Es war ein warmer Septembertag, 1974, an dem wir DDR-Fischer-Touristen in Budapest eintrafen. Wir freuten uns auf Weintrauben, die es bei uns selten oder nie gab. Nach durchschwitzter Hotelnacht holte uns ein Bus ab. Sightseeing war angesagt. Am Budapester Platz der Nationen stiegen wir aus. Dort hielt unsere Dolmetscherin, - eine temperamentvolle, charmante und auffallend gut gekleidete Fünfzigerin, - in recht geschwindem Deutsch einen Kurzvortrag zu zwölf deutsch-österreichisch-ungarischen Kaisern und Herrschern, deren Statuen und Köpfe auf uns herunterblickten. Ehrlich gesagt, sie hatte den Vortrag heruntergeleiert, wohl in der Annahme, dass es uns ohnehin nicht interessieren würde. Ich stellte eine Nachfrage, weil mich Kaiser Matthias (Ungarns König) Handeln interessierte, hätte er doch die politische Weichenstellung, die dann bedauerlicherweise zum 30-jährigen Krieg führte, auch anders vornehmen können. Der ganze Jammer wäre vermeidbar gewesen. Wütend fuhr mich die Dame an, die sich selber als „Dolly“ vorgestellt hatte: “Passen Sie nächstes Mal gefälligst auf! Ich habe ihnen die Frage längst beantwortet!”
Sich auf den Hochhacken ihrer schicken Schuhe abdrehend, stürzte sie auf unseren himmelblauen Bus zu. Ich war schneller. Ihre Mimik warnte mich, sie anzureden. Ihr war anzusehen, was sie dachte. Es war unter ihrer Würde, einfachen Fischern, statt Hochschullehrern oder Künstlern zur Verfügung stehen zu müssen. Nicht der nicht vorhandene Geruch, der unserem Berufsstand anhaften sollte, sondern eher ihre Vorstellung davon war es, was sie möglicherweise als so unangenehm empfand. Glaubte sie im Ernst, dass sie mich durch ihre rigorose Unhöflichkeit abschrecken könnte? “Da fehlt aber der dreizehnte Nationalheld!” sagte ich. Sie stutzte. Ihre Augen rollten. Ihr Atem stockte, als ahne sie bereits, dass ich nicht nachgeben würde. Sie zog die Lider hoch. “Und der wäre?” Noch verriet ihr Gesicht, dass sie unerfreut war. “Imre Nagy!” erwiderte ich prononciert: „Notsch“
 (Imre Nagy 1896-1958)
(Imre Nagy 1896-1958)
"Um Gottes willen!”, stöhnte die Dame. Ihr Ausdruck änderte sich völlig. Sie griff halt suchend nach meinem Ärmel, schaute sich von offensichtlicher Angst erfüllt um. Zugleich war da das schöne Aufleuchten ihrer grauen Augen: “Die Redaktion!” flüsterte sie. Die Redaktion, das war ihre Umschreibung für Leute des ungarischen Staatssicherheitsdienstes oder solcher die ihm zuarbeiteten. Wenn das einer der „Redakteure“ gehört hätte! Ich wäre sofort festgenommen worden. Verblüfft hörte sie mir zu. Imre Nagy letzte, erhaltenen, auf Tonband gesprochene, Worte lauteten: „Ich bitte nicht um Gnade!“
Kaum war ich in den Bus eingestiegen und hatte ziemlich weit hinten, neben Erika Platz genommen, kam sie zu uns. “Darf ich mich nach dem Befinden Ihrer Gattin erkundigen? Sitzen Sie bequem? Kann ich etwas für Sie tun?” In mir lachte es vergnügt. Im Traum wäre ihr nicht eingefallen, einen einfachen Fischer und seine Fischerin so zuvorkommend zu behandeln. Aber so unverhofft einem deutschen Gesinnungsfreund zu begegnen, nun da doch alles längst Geschichte war, zu einer Zeit, da selbst den nachgeborenen Ungarn strikt verboten war, daran trauernd zurückzudenken. Es hatte sie überwältigt. Da kommt ein kleiner DDR-Bürger und erklärt seine Sympathie für ihren großen und geschmähten Helden. Erika lachte leise und zufrieden, ahnte jedoch nicht, wie sie zu dieser netten Geste kommen konnte. Ich verzog, hoffe ich, keine Miene. “Vielen Dank, alles OK.” erwiderte ich und tat viel bescheidener, als ich in Wahrheit war, und nickte ihr zu. Innerlich jubelte ich: Na also, lagen wir doch dieselbe Wellenlänge.
Ja, wir wussten es: Zumindest einigen unter den 2 000 sowjetischen Panzerfahrern, die am 4. November 1956 In Budapest einrückten, wurde weiß gemacht, sie befänden sich in Ägypten, wo die Briten zeitgleich kämpften, um der bereits Ende Juli 56 erfolgten Verstaatlichung des Suezkanals entgegenzuwirken. Ohne Absprachen mit London und Paris zu führen, hatte das mit der Sowjetunion befreundete Ägypten am 26. Juli dieses Krisenjahres die Suez-Kanal-Gesellschaft entmachtet. Es traf die Rechtsnachfolger der Macher und Finanzierer dieser Wasserstraße.
Irgendwie bestand eine Verknüpfung dieser beiden, fern voneinander liegenden Ereignisse, die unter den Augen der kommunistischen Machthaber stattfanden. Denn, zeitgleich weitete sich der überwiegend friedliche, aber antikommunistische ungarische Studentenprotest aus. Im hoch-katholischen Polen rumorte es um diese Zeit ebenfalls heftig. Chruschtschows Geheimrede, die er nur wenige Wochen zuvor, Ende Februar 1956, als neuer Kremlchef vor seinen hochrangigen Genossen hielt, war längst im Westen und in vielen Kreisen der Ostblockstaaten nicht mehr geheim. Alle Oppositionellen witterten Morgenluft. Chruschtschow hatte Stalin unversehens als Verbrecher oberster Kategorie klassifiziert. Gefängnisse öffneten ihre Tore und Rehabilitationen zahlreicher politischer Gefangenen erfolgten öffentlich. Tauwetter war angesagt. Jetzt wollten immer mehr Menschen noch mehr Freiheiten erlangen. Imre Nagy sagte diese Entwicklung durchaus zu, während Nikita Chruschtschow hoch besorgt sah, wie erheblich das Anwachsen der Lawine war, die seine Macht bedrohte. Obendrein bombardierten Großbritannien und Frankreich am 31. Oktober, ägyptische Flughäfen. Umgehend unternahm Israel einen Vormarsch; gegen Ägypten. Knapp eine Woche später, am 5. November, einen Tag nach dem Beginn ihres Einmarsches in Ungarn, drohte die außenpolitisch unter Druck stehende Sowjetregierung gegenüber Frankreich und Großbritannien, „mit der Anwendung von Gewalt die Aggressoren zu vernichten und den Frieden im Nahen Osten wiederherzustellen.“ Chruschtschow und sein engster Vertrauter Bulganin, damals Ministerpräsident, sprachen sogar von der Zerstörung der westlichen Hauptstädte mit Atomwaffen. Das bestätigten einige Quellen. Alles Wissen um diese Zusammenhänge wurde, nach dem blutigen „Sieg“ der rabiaten Supermacht, geschickt und so gut wie möglich unterdrückt und überspielt. Die Drohung Atombomben einzusetzen war auch eine Warnung an den „Westen“ sich Ungarn betreffend mit Kritik zurückzuhalten. Das war die Auswirkung der Ideenkombination von Panslawismus und Bolschewismus. Man wollte vergessen machen und herrschen…
In den folgenden Tagen überbot Frau Dolly sich uns Gutes zu erweisen. Am Programm des Abschiedsabends nahm ich allein, und nur für eine Stunde teil, weil es Erika bei der drückenden Hitze nicht gut ging. Als unsere Dolmetscherin bemerkte, dass ich aufbrach, winkte sie ein Blumenmädchen heran, kaufte schneller als ich begreifen konnte, einen Rosenstrauß und gab ihn mir mit besten Genesungswünschen für meine geliebte Ehefrau mit auf den Weg.
(Wie sich nach der Wende zeigen sollte, setzten die Russen auf den
durch Westeuropa führenden Transit-LKW-Routen häufig Panzerfahrer ein, damit
die sich schon, en passant, ein Bild vom künftigen Operationsgebiet verschaffen
konnten.)
Jürgen
1974 kamen Wolfgang Sittig, Gunnar Tews und Jürgen zu uns. Der erste als
Lehrling, der zweite als Diplomingenieur für Fangtechnik/Hochseefischerei, der
dritte als Gehilfe, der sich in der Ausbildung zum Meister befand. Gunnar, 24-,
und Jürgen, 30-Jährig, brachten großen Elan mit. Künftig mit den dreißig
Quadratkilometern Wasserfläche experimentieren zu können, würde ihnen einen
Riesenspaß bedeuten. Aber es sollte alles ganz anders kommen.
Gunnar war bei einer
früheren Operation mit Hepatitis B verseuchtem Blut infiziert worden. Jürgen dagegen trug einen anderen Keim mit sich, den wir natürlich
nicht erkannten. Jürgen, knapp dreißig, größer als eins
neunzig, mit einem Gesicht wie ein Senator, eindrucksvoll, schien von Beginn an
fest von Charakter zu sein. Wir fanden bald, dass er entschlossen im Verfolgen
seiner Ziele und der ihm gestellten Aufgaben war. Er wurde von uns als
Fangleiter für die vielen rings um den Tollensesee liegenden kleineren Seen
eingesetzt. Wir konnten nicht ahnen, dass er grausam sein konnte, und dass er
überheblich war. Er geriet sehr schnell mit den ihm unterstellten älteren
Kollegen in Konflikt. Er mochte insbesondere Horst Gruß nicht, der bereits kurz
vor mir Mitglied der Genossenschaft wurde. 45-jährig strebte er danach ein
eigenes Wohnhaus zu kaufen. Horst war durch und durch Praktiker mit
Einfallsreichtum. Er könnte ein Sinti gewesen sein. Hort und Jürgen Beide
ähnelten einander in ihrer Arbeitsweise. Sie konnten sehr geschickt mit Nadel
und Messer umgehen und schneller als alle anderen Männer, die nicht
unkomplizierten Fanggeräte herstellen.
Eines Tages beorderte
Jürgen, Horst Gruß an eine bestimmte Stelle im Kastorfer See, der aufgrund
seiner Geometrie eine besonders große Uferzone bot. Wir bewirtschafteten dieses
Gewässer zum ersten Mal. Der Rat des Bezirkes hatte uns die etwa 80 ha Wasserfläche
übertragen. „Hier baust du die Kastenreuse ein”, wies Jürgen den zwanzig Jahre älteren
Fachmann an. Horst tat, was ihm aufgetragen wurde. Jürgen arbeitete in ungefähr dreihundert Metern Entfernung mit
Gruß um die Wette. Den großen Kerlen zuzusehen, wie sie mit den
teilweise sechs und acht Meter langen Reusenpfählen umgingen, war ein
Vergnügen.
Anderthalb Stunden dauerte
das durchschnittlich für die Schnellen, wenn sie wollten. Beide wünschten es
einander zu beweisen. Sobald sein Fangeschirr stand, kam Jürgen angerudert.
Elegant mit über Kreuz gefassten Griffen an den Rudern, wuchtete er mit seinen
langen Armen den kleinen grünen Plastekahn voran. Als er
den jungen Mann ankommen sah, ahnte Gruß schon, er würde kritisiert werden.
Jürgen verzog sein Gesicht. Er schüttelte den Kopf missbilligend. „Die Reuse steht schief!” Gruß nahm die Zigarre, die er sich gerade angesteckt, ruhig aus
dem Mund und blies den Rauch sehr langsam aus. Diese Frechheit riss seine Seele
aus der Verankerung. Er war außer sich. Er hätte brüllen können. Seine Reuse
stand exzellent da und exakt an dem ihm zugewiesenen Platz. Kein Fisch käme an
ihr vorbei. Jürgen kommandierte. „Ausbauen?”, fragte Gruß ungläubig
zurück. Seine verwirrten, braunen Augen
schauten genau hin um herauszufinden, wie viel Spott da im Spiel sein mochte.
Schon zweimal waren sie
aneinandergeraten. Das erste Mal, als sie gemeinsam mit der Handelektrode und
mit dem tragbaren Stromaggregat unterwegs gewesen waren, um Aale zu fangen. Da
hatte Jürgen sich ebenfalls angemaßt, ihn ungerechtfertigt zu rügen. Er sei
nicht schnell genug. Man müsse den eiligst aus dem Spannungsfeld fliehenden
Aalen die Stange mit der Anode schneller hinterher stoßen, um sie zu lähmen und
anzuziehen. Stets entkam ohnehin mindestens die Hälfte
aller Fische dem Stromkreis, und zwar von denen, die nicht bereits vor den
ihnen ja bekannten, nahenden Geräuschen die Flucht ergriffen hatten. Beim
zweiten Mal ließ Gruß sich zu einem Fehler hinreißen. Er wagte es Jürgens Vater
zu tadeln. „Gewiss! Den Murks baust du wieder aus.”
Gruß zögerte eine Weile.
Schließlich gehorchte er, wenn auch zähneknirschend, weil Jürgen ihn beim
Vorsitzenden Lüdtke noch schwärzer malen könnte.
Er drehte und zog und
wuchtete die mehr als einen Meter tief in den Seegrund gerammten Reusenpfähle
wieder ans Tageslicht. Stück für Stück. Dreißigmal dieselbe Last und Plage,
dieselben gestöhnten Flüche.
Es ist allemal eine
ungeliebte Arbeit Großreusen ausbauen zu müssen, weil sich damit keinerlei
Fängerhoffnungen verbinden.
Horst Gruß wusste, das war
auch die Rache für den Streit, den er einige Zeit zuvor vom Zaune gebrochen,
indem er den Genossenschaftsvorsitzenden wüst beschimpft hatte, weil der in
sein Fangrevier eingefallen war. Jürgen stand an jenem Tage noch in voller
Manneshöhe hinter seinem Vorgesetzten. Was Lüdtke geschehen war, das konnte ihm
passieren. Dem wollte er vorbeugen. Hier sollten ein für alle Mal die Weichen
und Signale gestellt werden.
Definitiv wollte er die
Macht- und Rangfrage entscheiden.
Dabei herrschte ringsherum
tiefster Friede. Still wie ein Spiegel lag der schöne See. Aller Lärm der
Straßen und Plätze rauschte fernab. Rings um sie herum breiteten sich die
Bilder mit den weißstämmigen Birken, den Erlen, Eschen und den friedlich grünenden
Büschen aus. Wer die beiden Männer so gesehen, hätte
meinen müssen, gegen solche Harmonie könnten sich Vernunftbegabte nicht
stemmen. Gruß, der sodann zum zweiten Mal das Geschirr in den See stellte,
bemerkte, dass Jürgen ihn beobachtete. Noch einmal dürfte der ihn nicht
kritisieren. Das Maß war voll. Getraute er es sich dennoch, dann spränge er dem
Lulatsch an die Kehle. Dann wäre es eine
offensichtliche Schikane. Die wird er nicht hinnehmen. Nach
genau anderthalb Stunden kam Jürgen erneut angerudert. Mit denselben
Bewegungen, mit eben demselben aufregend abweisenden Gesichtsausdruck. Na, Freundchen, mach’ dich nicht unglücklich.
Gruß glaubte zu ahnen, was
sich im Innersten des jüngeren Mannes abspielte. Er spannte sich. Erkannte sein Brigadier nicht, dass er zurückschlagen wird?
Nein!
Der wollte seinen Kopf
durchsetzen. Als Jürgen den erfahrenen Altgesellen Gruß
abermals anmeckerte, stieß der seinen Arbeitskahn jäh vorwärts, um das in seine
Nähe vorgerückte kleinere Boot mitsamt dem hochmütigen Menschen zu rammen.
Jürgen wich diesem Angriff geschickt aus. Mit zwei kleinen, aber kräftigen
Ruderzügen drehte er das Wassergefährt auf der Stelle.
Grußens Angriff stieß ins
Leere. Damit war die endgültige Feindschaft zwischen
ihnen erklärt. Für Horst Gruß hatte Jürgen sein Konto weit
überzogen.
Gruß bekam Rückenwind, mit
Ausnahme von Willi Krage und Reiner Lüdtke. Gruß war nicht irgendwer, sondern
eine Persönlichkeit mit großem Kredit bei den anderen Kollegen. So bildeten
sich innerhalb der Genossenschaft zwei Parteien. Wenig
später stellte sich auch Dieter Giesa auf Jürgens Seite.
Hermann Göck rang die Hände
hilflos, als er irgendwann bemerkte, wie die Dinge sich entwickelten. „Wie ist
das möglich?”, klagte er. „In einer so kleinen Truppe, da muss doch Einigkeit
herrschen.” Es herrschte die Unausgewogenheit, die mich
selbst einbezog und demnächst vor unlösbare Probleme stellen sollte. Nicht der kühle Verstand, die hitzigen
Gefühle herrschten vor. Jeden Morgen, jeden Abend gab es fortan
ohrenbetäubenden Krach. Nichtigkeiten wurden aufgebauscht, Worte wie
Waffen benutzt. Jürgen hätte erkennen müssen, dass sich
niemand jemals völlig unterwerfen lässt. Wer sich die Köpfe und Herzen nicht
geneigt machen kann, der zerbricht eher die letzten Brücken als den Willen
eines Menschen. Um das zu wissen war er noch zu jung und zu hart.
Die nächste größere
Auseinandersetzung musste kommen. Sie kam sehr schnell. Es ging zunächst nur um
eine Frage, die Gruß seinem Brigadier stellte. Der verstand sie falsch,
glaubte, er wäre wieder einmal attackiert und gekränkt worden. Er fühlte sich
herausgefordert. Vielleicht hatte Gruß die Frage ausgeklügelt.
Jürgen sollte umgehend Auskunft geben über den aktuellen Stand der
Aalplanerfüllung. Bekannt war, dass Brigadier Jürgen seine
Zahlen nur ungern preisgab. „Albern“, fanden das selbst seine besten Freunde.
Denn jeder konnte die Summen, wenn auch ein wenig aufwendig, zusammentragen.
Ein Wort gab das andere. Gruß sagte, Jürgen könne wohl nicht bis drei
zählen. Jäh in Wut geraten, griff der große, junge Mann unbeherrscht zu. Er zog
Horst Gruß an seinem ohnehin langen Hals in die Höhe. Das war unerhört, und es war gefährlich. Wollte er ihm das Genick
verrenken oder die Halswirbel auseinanderreißen? Empört berichteten mir Horst
Gruß und der immer streitbare Werner Hansen, ein Choleriker ersten Grades,
(dabei von voller Männergröße und mit Pfoten die schon mehr als einen
ausgewachsenen Keiler aus dem Gebüsch zur Straße geschleppt hatten,) was
vorgefallen war. Ich kam gerade aus dem Kühlhaus und war über siebzehn leger
dastehende, mit Karpfen gefüllte, Fischkisten gestolpert.
Beide Männer
empfingen mich mit hochroten Gesichtern.
Jürgen musste kurz zuvor
diese zehn Zentner Karpfen auf die Leichtkühlfläche gestellt haben, statt sie
tief zu frosten. Wer sonst?
Das kann man für eine Nacht
machen. Aber nicht drei Nächte und Tage hindurch. Denn es war ein
Freitagnachmittag, an dem sich alles zusammen ereignete. Mir oblag es, das Kühlhaus zu kontrollieren, und da Reiner sich im
Urlaub befand, musste ich handeln.
Hier ging es um Gedeih und
Verderb von hochwertigen Nahrungsmitteln, für deren Behandlung es einen Katalog
von Vorschriften gab.
Und es ging nun auch um
Gedeih und Verderb der Genossenschaft.
Jürgen zog sich gerade an.
Er streifte sein weißes Hemd über den Kopf, als ich ihn zur Rede stellte. Sofort gereizt erwiderte er, was ich mir erlaube, ihn vollzunölen.
Er wüsste sehr wohl, wer mich vorschickte. Jetzt nütze ich die Gelegenheit aber
aus, den amtierenden Vorsitzenden zu spielen, wozu ich ja sonst nicht käme. Alt genug und demzufolge hinlänglich einsichtig, hätte ich mich
von ihm nicht provozieren lassen sollen. Seelenruhig hätte ich ihm sagen
müssen, er möge, obwohl bereits umgekleidet, die Karpfen in den Tiefkühlteil
stellen und betreffs des körperlichen Angriffs auf Horst Gruß bekäme er von mir
einen schriftlichen Verweis.
Aber mich juckte es, den
arroganten jungen Mann anzufahren.
Denn knapp zwei Wochen
vorher hatte er mich blamiert.
Was ein Hermann Witte sich
erlauben durfte, mich meiner religiösen Grundeinstellung wegen, lächerlich zu
machen, das nahm er, der fast zwei Jahrzehnte Jüngere, für sich nicht
ungestraft in Anspruch.
Hermann Witte hatte den
Zuschauern beim Fischfang in Strasburg, dem wahrscheinlich gesamten Kollektiv
des Landambulatoriums, detailliert mitgeteilt, was ich für ein Sonderling sei.
Er brachte die Lacher damit natürlich auf seine Seite. Nur Jürgen musste noch eins obendrauf setzen und erklären,
„Sonderling” sei wohl nicht der rechte Ausdruck, ich sei ein frömmelnder
Worteverdreher. Das traf mich, denn ich gab ihm kaum Anlass zu diesbezüglicher
Kritik. Es klang nicht nur so, er meinte, ich lüge wie gedruckt. In der
Öffentlichkeit wollte ich damals diesen Streit nicht austragen. Aber jetzt kam
ich unklugerweise darauf zurück.
Ich sprach nicht gerade
ausnehmend höflich mit ihm.
Da fiel er in seinem
unbeherrschten Zorn lautstark über mich her, glaubte wir seien unter vier Ohren
und er wäre der mir ohnehin Überlegene. Ungehemmt bezichtigte er mich der
Unlauterkeit. Jürgen schrie mich aus der Turmhöhe an, ich könne ihm den Buckel kreuzweise
herunterrutschen. Es musste ihn jemand, der Rang und Namen besaß, gegen mich
aufgewiegelt und ihm den Rücken gestärkt haben. Es so zu
formulieren war der Gipfel der Unverfrorenheit. Überhaupt, was ging ihn mein religiös
motiviertes Engagement an? Was hatte das mit den 500 kg Karpfen zu tun? Da betraten seine beiden Kontrahenten den Umkleideraum.
„Aha!”, höhnte er, raffte seine Siebensachen und verschwand ins
Wochenende.
Da wir die zehn Zentner
Karpfen nicht verkommen lassen konnten, brachten wir die gefüllten Fischkisten
in den Tieffrostraum. Mühsam beherrscht schrieb ich den Verweis.
Gruß kündigte. Satt vom Gezänk, erwog auch ich ernsthaft das
Kapitel Binnenfischerei aus meinem Leben zu streichen. Da verunfallte Reinhardt
Lüdtke, während er sich auf dem Weg zu einer Fischereifachtagung befand. Im
Gegenverkehr raste er mit seinem Wartburgkombi unter den Anhänger eines W 50.
Durch die Wucht des Aufpralls riss sein Auto des Anhängers Achse aus der
Verankerung. Lüdtkes Fahrzeug wurde in diesem Vorgang die Kabine komplett
weggeschnitten. Sie haben den Schwerverletzten, der wie ein zusammengestauchtes
Bündel dalag, mühsam aus dem Pedalraum herausziehen müssen. Die Gesichtshaut
war ihm vom Kinn an bis in Augenhöhe gerissen worden.
Wäre er angeschnallt gewesen, hätte Reiner
den Unfall nicht überlebt.
Zufällig war ich nur wenige Stunden später an
der Unglücksstelle vorbeigefahren. Verwundert bemerkte ich die Trümmer eines
Anhängers und eines Autos, die verstreut im Straßengraben lagen. Ahnungslos, um
wen es sich handelte, dachte ich: Das war ein tödlicher Unfall. Sofort,
als ich davon erfuhr, beeilte ich mich, ihn im Krankenhaus in der Pfaffenstraße
zu besuchen.
Als sie mich, am dritten Tag zu ihm ließen,
sah ich nur die Kissen,
die weißen Binden und eine kleine Öffnung um
den Mund herum und seine Augen.
Er sprach langsam, war jedoch klar bei
Bewusstsein. Reiner sagte mir an jenem Tag etwas, das ihm wichtiger als alles
andere zu sein schien. Er sprach zwar leise und langsam, doch mit gewissem
Nachdruck. Es betraf erstaunlicherweise nicht das innerbetriebliche Klima. Es
ging um seine Einstellung zur SED.
Er habe keine Wahl. Beitreten werde er der
Partei wohl müssen: „Aber mache dir keine Gedanken!”, setzte er hinzu. „Eingestiegen bin ich dennoch nicht. Sie haben es versucht.” Redete
er von der Stasi? „Ja, davon. Sie wollten, dass ich mit ihnen zusammenarbeite.” Er
stockte: „Nein. Da waren sie bei mir an der falschen Adresse.”
Reiner atmete schwer. Leise setzte er hinzu:
„Sei versichert, dass aus mir nie ein Kommunist wird!” Natürlich
begriff ich, was er meinte.
Nachdem er noch mehr dazu gesagt, schwieg er
und ich saß eine Weile ratlos. Immerhin galt für mich, er dürfte sich nicht
aufregen. Im Begriff aufzubrechen gab er mir ein Zeichen. Er
möchte mir noch etwas mitteilen.
Es dauerte, bis Reiner wieder reden konnte.
Er zögerte auch. Natürlich, da war es wieder. Diese Beklemmung derer, die den
Wunsch hegten, sich mir anzuvertrauen. Es gab Themen, die enorm vorsichtig
behandelt werden mussten. Man konnte nie wissen, was sich aus einem einmal
geäußerten Wort entwickelte. Jede, auch die kleinste Kritik am Regime konnte
sich zu einem Ungeheuer auswachsen. Aber das Umgekehrte gab es ebenfalls.
Lautstarke Attacken auf den Staat DDR verhallten manchmal auch folgenlos. Mochten
solche Tatsachen von Zufällen abhängen oder Taktik sein, die furchteinflößende
Ungewissheit spielte ihre Rolle in jedem Falle wirkungsvoll. Man konnte nie
wissen...
Ich kannte einen Oberst, der wurde
eingesperrt und musste danach lange einsitzen, nur weil er sich herausnahm,
während der Tage des Prager Frühlings, Alexander Dubcek einen tapferen Mann zu
nennen. Ein anderer teilte mir mit, welche Arbeit er im Kurierdienst zwischen
kommunistischen Bundesbürgern und ‚der Firma’ (dem Staatssicherheitsdienst)
leisten sollte, und dass er es strikt abgelehnt hätte, seinen guten Namen als
Deck- und Briefkastenadresse herzugeben. Danach fiel er in Panik, weil er sich
plötzlich fürchtete, mir gegenüber allzu offen gewesen zu sein. Kaum
jemand war mit seiner SED-Mitgliedschaft glücklich. Viele,
die im Verlaufe der Jahre der Partei beitraten, glaubten eine Möglichkeit zu
sehen, sich durch diese Zugehörigkeit in verschiedene Prozesse einmischen zu
können. Danach jedoch quälte sie das Gefühl, damit direkt oder indirekt einer
Sache zu dienen, die nicht sauber war. Einige Genossen gaben unumwunden zu,
dass sie immer wieder mit sich selbst im Hader lagen, ob und wie weit sie sich
mit der SED einlassen durften und ob sie die Herrschaft eines Systems stärken
durften, das wahrheitsgemäße Differenzierung wie die Pest mied, das nur die
Farben Schwarz und Weiß kannte, und Weiß bedenkenlos für sich allein
beanspruchte. Reiners Bedenken gingen ebenfalls in diese Richtung. Er hasse die
Bespitzelung und erst recht diesen Geist der Unredlichkeit, in dem die Partei
Berichte fälsche, um ihre Wirtschaftspläne wenigstens auf dem Papier zu
erfüllen. Zu jedem schäbigen Trick würden sie greifen, um ihre Führungsrolle
zu sichern und zu rechtfertigen. Reiner verurteilte die Privilegiensuche nicht
weniger maßgeblicher Genossen und distanzierte sich von solchem Benehmen. Dann
machte er eine vorsichtige Handbewegung und setzte hinzu: „Ich will
versuchen sauber zu bleiben, aber ich komme nicht umhin Genosse zu werden. Ich
wollte dir nur sagen, dass ich deshalb nicht blind bin.”
Wir und
der §5, Landbauordnung
Trotz
erzwungener Beteiligung an Fischveredlungsprojekten des Kooperationsverbandes
“Qualitätsfisch der Mecklenburger Seenplatte” dem wir anzugehören hatten, war
uns gelungen trotz Überweisung von sechshunderttausend Mark, bis 1975 weitere
achthunderttausend Mark anzusparen.
Diese Summe hätte ausgereicht, um eine neue Spundwand
rammen zu lassen, die wir dringend benötigten und dann endlich ein mittleres Wirtschaftsgebäude
hinzustellen, denn noch hausten wir in derselben uralten, kleinen Holzbracke,
wo die immer größer ausfallenden Reusengeschirre angefertigt und repariert
wurden. Geld floss nach der zweiten Agrarpreisreform reichlich. Nur wir konnten
dafür nicht kaufen, was wir wünschten oder benötigten. Wir mussten unsere
finanziellen Mittel in zwei Kategorien teilen. Es
gab dem Grunde nach verfügbares und nicht verfügbares Eigenkapital. Die zweite Agrarpreisreform war ein Trick.
Zahlenjongleure sollten und wollten Wirtschaftswachstum vortäuschen. Das waren
Anzeichen für das fortgesetzte Kriseln der DDR-Wirtschaft. Wir hätten zehn
Millionen auf dem Betriebskonto haben können, solange sie nicht in den Bilanzen
der zuständigen Kreis- oder Bezirksverwaltungen vorkamen, entsprach ihr
effektiver Wert Null. Das war seitens der Obrigkeit gewollt. Sämtliche auf dem Akkumulationsfonds geparkten
betrieblichen Finanzen konnten erst nach und durch einen vor dem
Finanzministerium der DDR zu verteidigenden Gesamtplan zum Zahlungsmittel
befördert werden. Statt wie früher für eine
Tonne Kleine Maränen 1700,-Mark einzunehmen, erhielten wir nun über 9100,-Mark.
Das war fast das Fünffache.
Anstelle von früher 3,50 Mark je Kilogramm Karpfen,
bekamen wir 14,00 Mark und das unter Beibehaltung der Endverbraucherpreise
(EVP).
Selbstverständlich konnte das nicht gut gehen.
Niemand dreht an der Preisschraube willkürlich und zugleich ungestraft. Günter Mittags Finanzwissenschaftler, die gehofft hatten
ihre Agrar- und Industriepreisreform sei die rettende Idee, forcierten damit
lediglich die bereits angelaufene, sich verselbständigende, sozialistische
Inflation. Wir erhielten jedenfalls, trotz
unserer guten Finanzlage keine Baukapazitäten vom Rat des Bezirkes. Es gab zwar
Versprechungen, weil wir so nicht weiterhausen konnten, aber eben keine
Planziffer dafür. Der Dachdecker und
Bauingenieur Jürgen Krüger gab mir, als wir wieder einmal gemeinsam zur Nacht
fischten, den guten Rat: „Baut doch nach §5, Landbauordnung.” „Und das wäre?” „Ihr
baut in Eigeninitiative!” Beim Rat des
Bezirkes wurde unser Antrag positiv gewertet. Sie gaben uns grünes Licht. Die
Ratsleute freuten sich über jede Eigeninitiative. Das war bekannt, einer der will, kann zehnmal mehr
erreichen als der, den sie antreiben müssen.
Zunächst musste einem von uns der Hut aufgesetzt
werden. Ich wollte ihn unbedingt haben und bekam ihn auch. Dann berieten wir im Vorstand, wie viel Aale ich zur
Beschleunigung des Vorhabens, Bau einer Betriebsstätte, zur freien Verfügung
hätte. Falls es partout nicht weiterginge,
beabsichtigte ich mit Räucheraalen nachzuhelfen. Rigoros wollte ich das kuriose
Geschäft betreiben, allerdings in keinem Falle anders als ausschließlich
zugunsten des Betriebes. Ich wollte vom Sozialismus nicht betrogen werden, also
betrog ich ihn auch nicht. „Hundert Kilo höchstens.“, sagte Reiner. Mir
schien ich käme mit fünfzig hin.
Schließlich sollten es zweihundert werden. Das erste Problem bestand darin, dass ich niemanden fand,
der umgehend die zum Zweck der Baugrunduntersuchung erforderlichen Bohrungen
auf unserem Torfgelände ausführen würde. Wir vermuteten, wir stünden über
ungefähr fünf Meter Torf.
Hier und da gab es Achselzucken. Kein der markanten
Bauunternehmen wollte meiner Bitte nachkommen. Dann ging ich zu einer Firma in
der Katharinenstraße. Wieder hing das Kinn des Zuständigen tief herunter. Das
kannte ich schon. Sie seien auf viele Monate hin ausgebucht. Deshalb lamentierte ich nach Kräften: „Wir haben es satt
in der Hütte am See zu sitzen und Wintertags zu frieren.” Die
Antwort lautete: „Andere Leute frieren mitunter
auch!” Mutig schoss ich hinterher: „Aber
ich habe Räucheraale zu bieten!” Kopfrucken.
„Wie bitte?”
„Na, ja, wir fangen welche, wenigstens die
Grünen...” Der betreffende Brunnenbauchef
schaute mich noch einmal an, und ich hielt dem argwöhnisch prüfenden Blick
selbstverständlich stand. Kess lachte ich ihm
ins runde Gesicht: „Für jeden Mann ein Kilo Räucheraale gratis.” „Moment mal!”, lautete
die nicht unfreundliche Erwiderung. „Ich muss mal in den Kalender sehen...
tja da haben wir... da hätten wir, ... sagen wir nächste Woche...”
Sie kamen sofort, bohrten von Hand, primitiv wie
vor hundert Jahren und stellten fest, dass wir sogar über sechs Meter Torf
bauen mussten. Die Bohrkerne mussten analysiert werden. In einem Labor im Industrieviertel gab es unerwartet freie
Kapazitäten, nachdem ich erklärte, Sonderwünsche nach Fisch könnte ich
erfüllen. Ebenfalls kein Problem die
fünfundvierzig Stück, zehn Meter langen Stahlbeton-Rammpfähle zu kaufen.
Rammkapazitäten standen uns desgleichen zur Verfügung, wenn auch nicht sofort.
Auch die Eisenbieger mussten nicht überredet werden,
da wir zur Ausführung der Flechtarbeit die Genehmigung erhielten, Fachleute für
die Feierabendtätigkeit zu werben und sie leistungsgemäß zu entlohnen. Aber dann stellte sich uns das erste größere Hindernis in
den Weg. Beton erwies sich als Engpass. Denn wir benötigten 180 Kubikmeter in
einem Ritt. Alle Lockungen mit Räucheraalen halfen nicht. In der ganzen Umgebung gab es keine Mischanlage, die uns
außerplanmäßig den Beton für die Fundamentplatte liefern konnte. Der April des
Jahres ‘78 verging, der Mai und der halbe Juni. Keine Aussicht. Hartmut Wißmann
vom Tiefbaukombinat machte mir dann wieder Hoffnung, zugleich winkte er
verächtlich ab. „Du mit deinen Räucheraalen!”, kritisierte er scharf. „Soll
ich mir die 200 Kubikmeter aus den Rippen schneiden? Ende Juli eventuell.”
Wenn die neue, aus dem Westen kommende
Mischanlage getestet würde, dann... vielleicht. Ich
rechnete. Wir hassten es, daran zu denken, dass wir noch einen Winter in der
Holzhütte zubringen sollten. Im Juli, das ginge noch. Wir könnten es schaffen,
im Januar ins neue Gebäude zu ziehen. Im Juli
erkrankte die Großmutter des Mannes, der die Westtechnik installieren sollte.
Im August wurde desselben Mannes Nichte krank. Im September gab es noch ein
Problem.
Mir leuchtete durchaus nicht ein, dass von der
Gesundheit unbekannter Westnichten und Westomas unser Wohlergehen abhängen
sollte. Hartmut Wißmann ärgerte sich
ebenfalls. So sei das mit den Abhängigkeiten
von BRD-Importen. „Hast du denn schon die
Steine und die Fensterrahmen? Hast du die Dachbinder und die Klempner-, die
Elektriker- und Fliesenlegergewerke sicher?”
„Ich habe Zusagen.”„Zusagen sind keine Steine. In
Eggesin kann man gelegentlich Hohlbetonsteine erwerben.” Telefonate. „Ne, sie
kommen in diesem Jahr zu spät. Wo denken sie hin? Steine sind Goldstaub!”
Ich schluckte. „Aber sie haben mir doch gesagt...”
„Gesagt, lieber Mann, gesagt habe ich gar nichts, nur
mal nachgedacht, wie ich ihnen helfen könnte.” „Ich habe Räucheraale!”
„Mögen wir gar nicht. Aber wenn sie Zeit und Leute
mitbringen, dann produzieren sie sich die Steine selbst.” Mir stockte der Atem.
Dem Vorsitzenden sagte ich: „Reiner, wir müssen
mit ein paar Mann nach Eggesin fahren und Steine machen.“ „Ihr habt Fische zu
fangen, ... aber wenn’s denn durchaus sein muss...” Wir setzten uns zu
viert in meinen kleinen Trabant Kombi und fuhren nach Eggesin, in fünfzig
Kilometer Entfernung. Dort schütteten sie uns den Fertigbeton auf ein
Freigelände hin. Von Hand schaufelten wir die
Mischung in die Formen am Fuß der von uns gemieteten Rüttelmaschine. In jeweils
ungefähr je fünf Minuten stellten wir vier Hohlblöcke her, die nur noch
abbinden und trocknen mussten. Das Gerät schüttelte uns genauso zusammen wie
das leblose Material. Noch im Schlaf spürten wir die Rüttelei.
Am letzten Tag, an dem wir die noch fehlenden
dreihundert Stück fertigen wollten, ließ sich plötzlich mein Trabantgetriebe
nicht mehr schalten. Immerzu, sooft ich es versuchte, es rastete der vierte
Gang nicht ein.
Wieder Telefonate hin und her. Wir mussten uns
beeilen. Schließlich mussten wir auch unseren Fangplan erfüllen. „Im
Augenblick haben wir keine Ersatzteile!”
„Auch nicht für Räucheraale? Naja! Zwei, drei
Kilogramm hätte ich übrig.“
„Tut mir leid.”,
erläuterte Werkstattmeister Roland. „Zwei Kilo kostet mich schon die
Überredung im Hauptlager.“ Mit Ach und Krach gelangte ich bis zur
Reparaturwerkstatt.
„Dann baut mir doch bitte auch gleich eine neue
Auspuffanlage ein.”
Großes Stirnrunzeln. „Mein lieber Mann, wir haben zwar zehn Stück
Vorschalldämpfer bekommen, aber nicht einen einzigen Hauptschalldämpfer...”
Am zweiten Oktober gossen sie endlich die
Bodenplatte, am fünften legten die Maurer der bunt zusammengewürfelten
Feierabendbrigade den ersten selbstgefertigten Hohlblock auf die als
Sperrschicht dienende Dachpappe.
Für Feierlichkeiten und große Reden war an diesem späten Nachmittag des
Baubeginns keine Zeit. Es dunkelte bereits. Noch konnte man die Zeichnung des
Architekten Robert Brenndörfers lesen. Große Lampen hatten wir bereitgestellt.
Doch die erhellten das Baugelände nur partiell taghell. Den betriebsfremden Handlangern und Maurern sagten wir eine
Prämie zu. „Wenn Ihr den Rohbau bis zum 20. hochgezogen habt, dann...”
Löthe, wie sie ihn nannten, der Baubrigadier, maulte,
„na, ja, bloß Geld...” Ich tröstete ihn. Es lag doch offen, was er
wünschte. „Jeder bekommt zwei Kilogramm
geräucherte Aale obendrauf.”
Da rief „Löthe” schallend: „Männer,
rangeklotzt, es gibt was für Muttern!”
Am siebenten ging es mit voller Kraft weiter. Zum
Glück war das ein Feiertag und wir hatten ganze zehn Stunden vor uns. Reiner,
unser Vorsitzender wuchtete und schob von früh morgens bis spät abends das
Baumaterial heran. Er lief, als wäre Steinekarren sein Hobby. So keimte
wiederum die Hoffnung auf, dass wir es bis zum Frosteinbruch doch noch schaffen
könnten. Inzwischen stand fest, dass wir die
Dachbinder der geforderten Abmaße und Norm nirgendwo erwerben könnten. „Meines
Wissens hat die Tischler-PGH ‚Vorwärts’ in Neubrandenburg Beziehungen zu einer
der Herstellerfirmen in Anklam und Pasewalk. Die sind zumindest im Besitz der
Nagelpläne.” Ohne weiteres erhielt ich in
Anklam außer den Nagelplänen noch ein paar gute Ratschläge, doch niemand ließ
sich von mir verleiten, die erforderliche Menge Latten und Bretter zu
verkaufen, um daraus die Brettbinder herstellen zu lassen. Die Tischlergesellen waren bereit, eine Sonderschicht
einzulegen, zumal ich unmissverständlich eine besondere Delikatesse in Aussicht
stellte. Nur konnte ich durchaus keine Bretter
bekommen.
Vorsitzender Emil Tilp zuckte mit den Achseln. Er
möchte, könne uns aber nicht helfen: „Material musst du mir schon
anliefern!” Sein Holzkontingent sei voll
ausgelastet. „Geh zum Rat des Bezirkes, die vergeben mitunter noch freie
Kapazitäten! Aber du musst dich durchsetzen.” Jürgen Meyer, den Leiter des Bereiches Binnenfischerei,
suchte ich da zuerst auf. „Wärst du doch ein Jahr früher gekommen, ich hätte
dir die dreißig Festmeter Holz besorgen können.”
„Mensch, Jürgen, ich brauche sie jetzt...”
„Tut mir leid. Geh mal zu Horst.”
Horst G., der an diesem Tag in der Abteilung
Forstwirtschaft seinen Dienst versah, hörte mich zwar geduldig an, schüttelte
jedoch hinterher missmutig den Lockenkopf. „Dat ihr Kerle auch immer auf die
letzte Minute angekleckert kommt. Bin ick die Feuerwehr?” Leider war das bezirkliche Forstamt nicht so schnell wie
die Feuerwehr, aber ich stand unter Druck wie ein erhitzter Dampfkessel über
Flammen. In meiner Naivität hatte ich zu lange
geglaubt, Binder problemlos einkaufen zu können. „Glaube macht selig, backen macht mehlig!” den Kinderreim hörte ich bis zum Verdruss. An jenem
Nachmittag im Spätherbst ’78 verließ ich das weiße Gebäude am
Friedrich-Engels-Ring mutlos. Weder wortreiche Überredung noch Betteln noch
meine massiven Bestechungsversuche hatten mir den ersehnten Erfolg beschert. Da
trollte ich mich nun niedergeschlagen davon, besaß zwar die Nagelpläne und die
Zeichnung für das planmäßig mit Eternitplatten zu deckendes Dach, hatte sogar
Räucherdelikatessen und konnte mit alledem nichts anfangen.
Ärgerlich rollte ich meine Papiere zusammen und
fluchte, weil ich mit leeren Händen dastand. Vor
Wut hätte ich explodieren können. In diesem
Augenblick sah ich einen stattlichen, mit geflochtenen Achselstücken
geschmückten Forstmann auf mich zukommen. Der
kam mir gerade recht. Wie durch ein Zielfernrohr visierte ich ihn durch meine
dreiviertelmeterlange Rolle meiner Pläne an. Als er bis auf zwei Meter
herangekommen war, fuhr ich ihn an: „Euch Förster müsste man samt und
sonders erschießen!” Er stutzte. Er musterte mich. „Genosse, was hast du
denn für Probleme?” Und wie mitfühlend er
das sagte! „Genosse!” Zum ersten
Mal, wie mir schien, verstand mich einer und litt mit mir.
„Ich muss spätestens im November das Dach auf
unser neues Wirtschafts- gebäude setzen. Wir haben nach § 5 gebaut. Niemand in
deinem Haus gibt mir ein Holzkontingent. Uns wird der Winter dazwischenkommen.”
„Wo kommst du her?” „Von Der Fischerei…so
und so!“ Er nickte: „Komm mal mit!“ Mir
war zumute, ich wäre in die Kindertage zurückversetzt worden und Mutter hebt
mich hilfeschreienden Knirps liebevoll vom kalten, nassen Fußboden auf. Genosse Skibbe!... Wären
alle Menschen der Welt so wie der da, mit seinen dicken Achselklappen...
Ich las das Schild an seiner Tür. Nur wenige Sekunden
telefonierte er, der Oberlandforstmeister Siegfried Schreib, mit irgendjemand.
Dann stand es fest: „Also dreißig Festmeter Lärche oder Fichte! Die kriegst
du! Für deinen Betrieb allemal.” Das war
es, was die Besten unter den ‘Kommunisten’ wollten, Solidarität. „Wann
bekomme ich das Holz?”
„Eingeschlagen ist es schon... muss nur noch
gerückt werden.” Es läge da und da in den
Tiefen der Neustrelitzer Forsten. „Du kannst die Stämme ab übermorgen
abfahren lassen!” Welch ein Wort
und doch biss ich mir sofort auf die Zunge: „Wir fahren übermorgen nach
Leningrad, Betriebsausflug.” Er schmunzelte,
statt mich auszuschimpfen. Ich lachte
innerlich, das war die Sorte Leute, die ich mochte. „Wird dir die Zeit knapp, was? Muss ja noch geschnitten
werden und noch genagelt, nich?” Ich
nickte ein bisschen hilflos, vielleicht tauschen sie. Er winkte ab. „Keine
Experimente! Ich lasse dir die Stämme nach Zwiedorf ins Sägewerk schaffen!”
Er setzte sich an einen anderen, mit Papieren übersäten Schreibtisch, schob den
Aschenbecher beiseite, nahm einen Kalender zur Hand und schrieb etwas auf. „Hier
hast du den Termin für den Schnitt.”
Mit Schrecken sah ich, das war die hohe Zeit für die
Nachtfischerei auf Maränen.
Meine Reaktion fiel ihm auf. Er fragte nicht lange.
Nur ein kurzer Blick.
„Ich sehe schon. Diesmal fahrt ihr in den
Kaukasus. Hier hast du einen neuen Termin fürs Sägewerk.” Ich war gerührt: „Dafür gebe ich dir fünf Kilogramm
Räucheraale!”
Er schüttelte den geröteten, breiten Kopf. „Deinen Aal will ich nicht. Es
war mir eine Freude, dir helfen zu können.” Bescheiden
wehrte er ab: „Ach was“, auch weil ich ihn lobte und mich bedankte: „Sieh
zu, dass du das Dach draufbekommst!”
Mitte Januar, einen Tag bevor der Winter richtig
zuschlug, zogen wir in unseren durch Nachtspeicheröfen herrlich beheizten
Neubau ein. Es gab im Sozialismus tatsächlich noch Freude.
Coregonus lavaretus oder nasus?
Unmittelbar nach der Moskaureise entwickelte sich aus der Idee, Kleine Maränen
vorzustrecken, der Gedanke, eine neue Fischart einzubürgern.
Erika, meine Frau, äußerte ihre Bedenken. Vor allem wegen der Art, wie ich es
tun wollte. Ich aber schwärmte von den Möglichkeiten, die sich uns böten.
„Du musst dir vorstellen, dass der Seeboden des Tollensesees, das Profundal,
mit Zuckmückenlarven rot übersät ist. Wo immer der kleine Greifer einen
Ausschnitt der Bodenoberfläche aus der Tiefe heraufbeförderte, zählte man
zehnmal mehr Chironomiden als auf anderen vergleichbar großen Seen.” Das
ganze Jahr hindurch ist somit der Tisch für die ‚Friedfische’ überreichlich
gedeckt. Nur, es ist da unten zu kalt für die meisten Fischarten. Deshalb wird
diese Kinderstube dieser nichtstechenden Mückenart kaum aufgesucht und ihre
Bewohner werden deshalb nicht dezimiert.
Deshalb staunt der bootsfahrende Beobachter
und Naturfreund, wenn im Mai, der sonst überwiegend blaue See plötzlich schwarz
aussieht, obwohl die Sonne scheint und die Himmelsfarben sich auf ihm spiegeln
müssten. Abermilliarden vier, fünf millimeterlanger Larvenhüllen schwimmen auf
der Wasserhaut und dazwischen bevölkern ebenso viele, ebenso lange schwarze
Geschöpfe die riesige Fläche. Ehe sich die aus der Tiefe aufgestiegenen
Insekten in die Lüfte erheben können, stehen sie mehrbeinig auf der
Seeoberfläche und lassen sich vom Wind leicht dahintreiben. Ihre
verhältnismäßig großen, sehr unterschiedlich gestalteten, gefiederten,
büschelartigen Fühler dienen ihnen dabei als Segel.
Seeschwalben und Möwen stürzen sich zu Tausenden auf die soeben ins Tageslicht
aufgestiegenen Zuckmückenmassen. Sie picken sie als Delikatesse auf oder
vielleicht ist es nur Notnahrung, was sie da als winzige Häppchen aufnehmen.
Sobald die Sonne etwas höher kommt, surrt es in den Lüften. Wie wehende
Rauchfahnen stehen die Zuckmückenschwärme ab der elften Tagesstunde über den
Wipfeln der ufernahen Bäume und halten Massenhochzeit. Im Fluge paaren sie sich
und wenig später treibt sie der Wind und ihr Instinkt über die Seefläche hin,
dann werfen sie ihre befruchteten Eier aus der Höhe ab. Ein neuer Kreislauf
beginnt. Dreimal im Jahr vollendet sich dieser Kreis, aber nur einmal, im
Frühling, in dieser Pracht und Fülle. Von allen in Europa vorkommenden
Wildfischen ist nur die Große Maräne, die Bodenrenke, geeignet, da in die kalte
Tiefe hinabzutauchen und die Larvenbestände abzuweiden. Zwei Typen gibt es
unter den Maränen, erstens die im freien Wasser lebenden Kleinmaränen und
zweitens die großen bodenständigen, Chironomiden-fressenden. Letztere wollte
ich in den See einsetzen. Lüdtke unterstützte meine Idee Wo aber gäbe es die
Brut dieser Spezies Edelmaränen? Und würden wir einen Weg finden, sie zu
erwerben? Die Antwort kam aus unserem Nachbarbetrieb in Prenzlau. Am Madüsee,
in der Nähe Gollnows, das jetzt Golienow heißt, gibt es eine leistungsfähige
Fischbrutanstalt. Sie stünde unter der Leitung des Szczeciner
Landesanglerverbandes. Herr Marczinski sei der Chef.
Aber haben die polnischen Kollegen auch Edelmaränen aufgelegt, das war die
Frage und würden uns die Polen zu vertretbarem Preis Brütlinge verkaufen?
Kurt Reiniger sprach fließend polnisch und ich besaß außer der Lust aufs
Abenteuer einen Trabant Kombi. Wir wollten einfach hinfahren und sehen, was
sich machen lässt. Lediglich Geld benötigten wir noch. Mit Reiner Lüdtkes
Einverständnis versuchte ich unseren Buchhalter Alfred Voß, Adi, zu überzeugen.
Mit Adi konnte sich niemand erzürnen. Er war gerade Altersrentner geworden,
aber noch im Dienst. Er schaute mich freundlich nachdenklich an. ‚Schwarze Kasse?
’ Er schmunzelte: „Wozu schwarze Kasse? Wenn die Sache ok ist, gibt es keine
Probleme.” Nun ja, die Polen wünschten, wie wir aus Erfahrung wussten, Bargeld
ohne Quittung und Belege. Ob ich auch dazu Reiners Genehmigung hätte. „Ich
will ihn da nicht in diese Geschichte verwickeln.“ Irgendwie sei es doch
eine Art von Spitzbüberei, was wir vorhatten, eine Nacht- und Nebelaktion.
Eigentlich hätten wir erst Anträge stellen müssen, Zertifikate für den
grenzüberschreitenden Tiertransport besorgen, lauter bürokratische Hürden
nehmen müssen und dann vertagte sich unser Anliegen um Wochen. Doch in einigen
Wochen gibt es keine Großmaränenbrütlinge mehr, sondern gerade jetzt, noch.
Außerdem stünden die Plasterinnen seit der Beendigung der Aalbrutüberwinterung
zur Verfügung. Besser sei, Reiner als Vorsitzender bliebe ‚außen vor’. Adi
schmunzelte und dieses sonderbare, stets überlegen wirkende Spötteln aus seinen
Augenwinkeln und aus seinen immer freundlichen Gesichtszügen heraus war harte
Kritik für mich. Es besagte, was würdest du dazu sagen, wenn du der Vorsitzende
wärst und würdest auf diese Weise überfahren? Muss er nicht schließlich alles
wissen, was im eigenen Betrieb passiert? Er zog die Augenbrauen nur um ein
Winziges in die Höhe. Das war seine Art zu kritisieren. Durch Mienenspiel,
Stirnrunzeln dirigierte er uns. Ich konnte mir gut vorstellen, wie er es
damals, als Frontsoldat auf Urlaubsfahrt in die Heimat einer gewissen, schönen
Wienerin erklärt hatte, dass ein Mann wie er immer nein sagen wird, wenn sein
Gewissen auf dieses Nein besteht.
Übrigens, als Buchhalter Adi Voß uns
anderthalb Jahre später, im September ’73 verließ, überreichte er uns unter
anderem einen alten Briefumschlag. Das war die in zwei Jahrzehnten gefüllte,
nie angetastete, niemandem außer ihm bekannte ‚Kaffeekasse’, Geld von Kunden,
die berechtigt waren, Kleineinkäufe vor Ort zu machen und die Pfennigbeträge
nach oben aufrundeten. Der Inhalt war 312, 73 Mark. Nie gab es in seinen
Bilanzen echte Differenzen. Ehrlichkeit ist bares Geld, pflegte er zu sagen,
dabei zeigte er seine kräftigen Zähne. Das war seine tiefste Überzeugung: Ohne
Ehrlichkeit geht die Welt zum Teufel.
Reiner nickte, als ich ihm beichtete, sofort Zustimmung: „Wie viel
Schwarzgeld benötigst du?” „Schätzungsweise eintausendzweihundert!” Eine
Stunde später hielt ich die zwölf Hunderter in meiner Hand. Gemessen an unseren
Preisen hatte ich mir ausgerechnet und vorgenommen, dafür eine viertel Million
Brütlinge zu bekommen und diese schwarz über die Grenze zu schmuggeln.
Reiner meinte, dass wir wahrscheinlich nur fast ausgebrütete Eier erhalten
würden. Dieser Hinweis war wichtig. Wir mussten also Zugergläser aufstellen.
Versehen mit einigen großen Plastetüten
fuhren wir am nächsten Tag nach Szczecin. Die Zeit drängte. Für den Nachmittag
würde Herr Marczinski uns zur Verfügung stehen. Mehr wollten wir fernmündlich
nicht vereinbaren. Denn wir waren es gewohnt, stets daran zu denken, dass
Telefonate abgehört wurden. Wer weiß, zu welchen Schlüssen die Horcher gelangt
wären, wenn sie zufällig unsere Absprache mitbekommen hätten. Szczecins
Anglerpräsident Marczinski saß in seinem gelblich eingetönten Büro an seinem
ebenfalls gelb schimmernden Schreibtisch unter einer präparierten riesigen
Madümaräne, die auf einem gewaltigen Bücherschrank einen zentralen Platz
einnahm. Acht Kilogramm oder mehr muss dieser Fisch einst gewogen haben. Kurt
und ich waren sehr beeindruckt. Immer wieder gingen unsere Blicke dahin.
Genauso große Fische, der Art Coregonus lavaretus, wünschten wir uns. Ich
wunderte mich laut darüber, dass Madümaränen zu so stattlichen Exemplaren
heranwachsen könnten. Marczinski nickte, während Kurt übersetzte. Zwei- dreimal
erwähnte er, mich unterrichtend oder berichtigend: „Coregonus lavaretus nasus.”
Nasus, nasus, dachte ich, das ist eine Spezies, die wir nicht haben wollen.
Marczinski wies mit dem Daumen nach oben, hinter sich: Ostseeschnäpel! Oje.
„Keine Ostseeschnäpel, die benötigen zum Gedeihen Brackwasser.“
Ein Schwall anscheinend wohlmeinder Worte fiel in Polnisch über uns her. „Sie
können sogar in Teichen, in Süßwasserteichen! mit Nasus wirtschaften!”
Ich glaubte ihm nicht. Kurt zuckte die Achseln. Da saßen wir nun, mit
unserem DDR-Geld. Was tun? Ich konnte Marczinski aber auch nicht das Gegenteil
beweisen. „Probieren wir es? Kurt?” Kurt, der Mann mit der großen
Stupsnase nickte. Aus dem vielfach gekerbten Gesicht, das in hohem Maße der
Ausdruck seines von vielen Nackenschlägen durchkreuzten Schicksals war, kam das
schulterzuckende Einverständnis. Marczinski nahm ein Stück Papier zur Hand und
rechnete schnell. „Dreihunderttausend Eier erhalten sie dafür. Schlupfreife!”
Es sei höchste Zeit.
Hatte Reiner also Recht. Wir müssten denn
sofort aufbrechen, um nach Golienow zu fahren. Da es noch März war, begann es
früh zu dunkeln. Mir schien, die vierzig Kilometer würden nie enden. In einer
dunklen Waldecke
angekommen, lauteten die Weisungen rechts fahren, rechts, na prawo, na prawo.
Was ist, wenn ich viermal rechts herum fahre? Überall nur Bäume wie es schien.
Mattes Scheinwerferlicht erhellte nur den Sandboden, indessen schimmerten die
Gehölze an den Seiten umso dunkler, wie schwarze Wände. Plötzlich zeichneten
sich neue schwarze Konturen gegen den sich öffnenden Nachthimmel ab. Kurt
übersetzte: „Die Brutanstalt!” Jemand musste die winzige Hofbeleuchtung
angeschaltet haben. Eine nicht große, leicht gebeugte Gestalt erschien. Ob die
Person männlich oder weiblich war, ließ sich noch nicht sagen. Wir stiegen aus.
Völlige Stille umfing uns. Der gebeugte Mensch schritt auf Herrn Marczinski zu.
Ich erkannte, dass es ein alter Mann war, ein kleiner mit fester Hand und
weicher Stimme. Als er bemerkte, dass ich außer „dobri vetschor“ nichts
verstand und auf Kurts Dolmetscherdienste angewiesen war, wechselte der
sympathische Alte in einwandfreies Deutsch. Er drückte sich sehr gewählt aus.
Siebzig Maränenarten gäbe es auf der nördlichen Erdhalbkugel, vielleicht noch
mehr, wer könne das noch auseinanderhalten? Vom Omul im Baikalsee bis zu der
kurioserweise im Sommer laichenden Spezies in den Feldberger Tiefseen, der
Coregonus albula baunti, reiche das Artenspektrum. Mein Problem bestand darin,
dass ich auch ihm zunächst nur schwer glauben konnte. Sollte der Ostseeschnäpel
das von uns begehrte Objekt sein? Dass dieser Wanderfisch, der schwach salziges
Wasser bevorzugt, in Seen und Teichen ausgesprochen gut zu halten sei,
bezweifelte ich. Allerdings hatten wir den Kauf bereits perfekt gemacht. Eine
große dunkle Tür öffnete sich vor mir und das vertraute Wasserrauschen ließ
sich vernehmen. Da plätscherte es aus den Zugergläsern. Je sieben Liter Wasser
befanden sich in je einer dieser vielleicht siebzig überdimensionierte Kopf
stehenden Seltersflaschen, die in mehreren Reihen in Gerüsten aufgestellt
dastanden. Fortwährend wälzten sich in jeder der unentwegt überlaufenden
Flaschen zehntausende bernsteinfarbener Maräneneier. Alle nur etwas größer als
Stecknadelköpfe. Mit einer Pipette entnahm der alte Herr ein paar dieser vor
dem Lampenschein goldschimmernden Coregoneneier. Er hielt sie mir dicht vors
Gesicht. Deutlich sah ich die Zuckungen der Ungeborenen, dann die
schwarzsilbernen Embryonenaugen, den Dottersack mit dem Fettauge, das dem Ei
die Farbe gibt. Immerzu drehten und wanden sich die noch in ihren Umhüllungen
gefangen gehaltenen Schnäpelchen. Mit dem Zählglas literte der alte Herr uns
dreihunderttausend Maräneneier aus, und zwar ziemlich genau wie wir später
bemerkten. Wir kannten nur das Zählverfahren für Brütlinge.
Sprudelndes Wasser füllten wir in die auf Reißfestigkeit geprüften fünfzig
Liter fassenden Plastesäcke und entließen dahinein die je
einhundertund-fünfzigtausend Eier. Obenauf, beim Vorgang des Schließens der
Tüten, gaben sie uns einen Schuss reinen Sauerstoffs aus einer
Pressluftflasche.
Dann machten wir uns schleunigst auf den Heimweg.
Die Stimmung war gut. In Szczecin wollten wir Herrn Marcinski absetzen.
Kurz bevor wir die Stadtgrenze erreichten ging es zwischen Kurt Reiniger und
unserem Geschäftspartner plötzlich laut zu. Ich spitzte die Ohren. Was mochte
der Streitpunkt sein? Mir schien, dass ich den Begriff Katyn wiederholt
vernahm. Mich einzumischen wäre unhöflich gewesen. Teilnahmslos dazusitzen und
nur Gas zu geben unmöglich. „Was ist los, Kurt?”
„Er wirft mir vor, ich wäre ein Überläufer
gewesen! Kann doch nischt dafür!” Ich ahnte, um welchen Vorwurf es ging.
Hatte ich ihn doch einmal auf einem Foto als jungen Mann in polnischer Uniform
gesehen. Es lag alles weit zurück, über dreißig Jahre. Die Emotionen gingen auf
beiden Seiten hoch. Für beide Männer schien der Sprung über eine fast
vierzigjährige Epoche nur ein winziger Schritt zu sein. Sie erregten sich sehr.
Kurt Reiniger war tatsächlich auf polnische Fahnen eingeschworen worden, 1939, und
bald darauf, nach der großen polnischen Niederlage, von der Deutschen Wehrmacht
auf Gestellungsbefehl eingezogen worden. Ein Schicksal, das er mit Tausenden
Halbdeutschen teilte, die damals im Raum Bromberg gewohnt hatten. Dass sein
Familienname Reiniger lautete, deutsch war, ließ Marczinski nicht gelten. Den
Polen ginge es immer um die Ehre ihrer Nation! Das zu verstehen, sei Kurt
Reiniger wohl nicht gegeben. Kurt war wirklich gekränkt. Immer hackten sie auf
ihm herum. Wenn es nicht dies war, dann jenes, das ihnen an ihm missfiel. Den
einen trank er zu viel, den andern zu wenig.
Es ging um Katyn! Und um Marczinski Bruder. Das ließ ich mir übersetzen. Wenn
sie sich schon aus politischen Gründen zankten dann wollte ich auch wissen,
warum. Der Bruder des Anglerpräsidenten habe zu jenen tausenden polnischen
Offizieren gehört, die durch Stalins Heimtücke in sowjetische Gefangenschaft
geraten waren. Eine Schande an sich. Sie hätten sich entschieden geweigert,
ihre Pistolen und Ehrenabzeichen an sowjetische Schergen auszuliefern. Die
Russen seien der Republik Polen 1939 zugunsten Hitlerdeutschlands brutal in den
Rücken gefallen, auch weil diese „verfluchten Kommunisten“ Landräuber
allergrößten Stiles wären. Finnland hätten sie beklaut, das ganze Baltikum sich
einverleibt, Moldauer Gebiete, Ostpolen. Vor Verrätern wollten sich die Gefangenen
in Katyn nicht demütigen. Schließlich seien sie ausnahmslos erschossen worden.
Ich hatte richtig gehört.
Marczinski verfluchte den russischen NKWD als
faschistische Mörderbande. Hitler hätte mit den Sowjets, damals, als Kurt in
die Deutsche Armee übergelaufen sei, gemeinsame Sache gemacht. Mich
interessierte das Thema brennend. Im letzten Urlaub hatten wir mit Freunden das
Verbrechen von Katyn sehr konträr diskutiert. Es ging ganz einfach um die
geschichtliche Wahrheit, und die Frage, ob Hitlers Männer oder die Kommunisten
die nichtaufständischen, wenn auch sturen polnischen Kriegsgefangenen
massenweise erschossen hätten? Mich wunderte damals, Monate zurückliegend, auf
Usedomer Strandsand mit Freunden diskutiert zu haben, dass es überhaupt Zweifel
an der sowjetrussischen Täterschaft gab. Sogar mein Bruder Helmut war der
Auffassung, dass es eher Hitler als den Russen zuzutrauen gewesen wäre, das
Massaker anzurichten. Für uns war es ohnehin eine ungeheure Vorstellung, dass
Menschen so miteinander umgehen können. Mit Fanatismus habe das nichts mehr zu
tun, sagten wir damals, sondern nur mit den atavistischen Neigungen
degenerierter Kerle, die von dem einen oder dem anderen System bewusst gefördert
wurden. „Ich kann es Ihnen nachfühlen, Herr Marczinski.”, erklärte ich,
wusste aber nicht, was Kurt übersetzte. Ziemlich böse äußerte Marczinski: „Rückfälle
haben immer schlimme Folgen.“
Auf meine Nachfragen reagierte er
leidenschaftlich. Diesen Angriff auf die Blüte der polnischen Nation werde
Polen den Sowjets niemals verzeihen. Das werde niemals verjähren. Daran möge
ich mich später erinnern.
„Sie wollten die polnische Intelligenz und damit die Seele der Nation
ausrotten! Nicht mehr und nicht weniger. Die Sowjets fürchten immer noch ein
starkes Polen, so wie sie es früher zu Zeiten des Zaren hassten.” Beide
Seiten, die deutsche und die russische, hätten deshalb gemeinsame Sache gemacht
um Polen von der Landkarte zu tilgen. Marczinskis Gefühle in allen Ehren. Warum
war er wütend auf uns, warum auf mich? Ja, die Preußen! Gemeinsam haben die
Preußen Polen mit den Österreichern und Russland 1772, 1793 und schließlich
1795 in Stücke gefetzt. Es loderte wie
das Feuer eines Hochofens: „Sehen Sie sich an, was die mit uns anstellten:
Ausrottung, Löschung jeder polnischen Existenz.” Marczinski erklärte mir
die Landkarte Polens, während der von ihm erwähnten Teilungsjahre: Zuerst
nahmen die Preußen den Polen den Bromberger Raum bis Danzig weg, die
Österreicher kamen bis vor die Tore Krakaus, das zaristische Russland nahm
Wittebsk. Ein Jahr darauf einverleibte Russland sich Minsk und Pinsk, die
Preußen Posen und Thorn. Und schließlich verschwand das Land Polen 1795. Der
Funke sprang zu mir über. Das Viertel Teil Slavenblut in mir erhitzte sich. Ich
erinnerte mich in verschiedenen Napoleonbiographien gelesen zu haben, dass auch
der große Bonaparte die Polen zwar als Elitesoldaten in all seinen Feldzügen an
den schwierigsten Kampfabschnitten einsetzte und dass er sie stets mit neuen
Versprechen zu höchsten Mutleistungen zu motivieren vermochte, doch dass er
wahrscheinlich niemals ernsthaft daran gedacht hatte, Polen mit jener
Souveränität auszustatten, welche die hochherzigen Söhne des jahrhundertelang
immer wieder in Abhängigkeiten gestürzten Landes so heiß begehrten. In dieser
Märznacht 1972 fragte ich mich erneut, ob dem Kreml jemals die echte
Integration, der so genannten Volksrepublik Polen, in ihren Herrschaftsbereich
gelingen könnte. So viel unverhüllt ausgedrückten Unmut und Widerstand, wie ich
ihn von Seiten Herrn Marczinskis gegen den Sozialismus spürte, hatte ich bisher
nur selten erlebt. Kurt übersetzte, während wir den Stadtrand Stettins erreicht
hatten, fleißig, und wie ich annehmen durfte, auch einigermaßen präzise. Herr
Marczinski ließ mir sagen, wir wären angelangt. Ich stoppte und schaltete den
Motor ab. Er drückte mir die Hand und sagte zum Abschied: Wie er dächten und
empfänden alle Polen: „Wir werden frei sein oder tot!”, und dann
erklärte er etwas, das Kurt mir lachend mitteilte: „Noch ist Polen nicht
verloren.” Herr Marczinski sang es und Kurt stimmte ein. Unser Partner
stieg nun an dieser unbelebten, recht trostlos erscheinenden Straßenecke aus.
Er winkte, wir winkten zurück und fuhren langsam davon. Mich beschlich, als wir
ihn zurückließen, wiederum das ungute Gefühl, dass wir schlechten Zeiten
entgegen gingen. Jeden Tag, jeden Abend überschütteten uns die östlichen wie
die westlichen Sender direkt oder indirekt mit Verdächtigungen, die andere
Seite plane den großen Krieg. Manchmal schien es uns, es gäbe gar keine anderen
Themen mehr. Schließlich war die Gefahr, dass der so verheerend in Vietnam
tobende Krieg, aus denselben Gründen, auch in andere Erdteile getragen werden
könnte, sehr real. Noch lagen der Süden Afrikas, Angola, und der November des
Jahres 1975 scheinbar in weiter Ferne. Sechzehn lange Jahre hindurch sollten
dort jedoch die sowjetisch-kubanischen Interessen und die südafrikanischen
Absichten tödlich kollidieren. Millionen Afrikaner sollten Flüchtlinge werden,
hunderttausende Unschuldige würden den vollen Preis zu entrichten haben für die
Leidenschaft der Großmannssucht beider Seiten. Der Ausbruch größerer ![]() Feindseligkeiten
musste auch im süd- und mittelamerikanischen Raum erwartet werden. Dies alles
wegen des allgemeinen Konfliktes zwischen Ost und West. Hatte Beier-Red oder einer
seiner Genossen es nicht per Zeichnung prophezeit?
Feindseligkeiten
musste auch im süd- und mittelamerikanischen Raum erwartet werden. Dies alles
wegen des allgemeinen Konfliktes zwischen Ost und West. Hatte Beier-Red oder einer
seiner Genossen es nicht per Zeichnung prophezeit?
Auf diesem Globus kann nur eins der beiden
Systeme überleben. Noch waren auch die Tage fern, in denen die DDR-Presse
ausführlich über die blutigen Grenzgefechte zwischen den sozialistischen
Bruderarmeen Nordvietnams und der Volksrepublik China berichten würde. Noch
ahnten wir nicht, dass die Pekinger Kommunisten beweisen würden, dass es ihnen
ernst war mit ihrer Betrachtungsweise, Atombomben wären ja bloß Papiertiger.
Wie wenig ihnen das Einzelwesen bedeutete, zeigten sie nicht nur während ihrer
Kulturrevolution, in der es sogar bei Strafe der Verbannung verboten war,
Schach zu spielen oder eine westliche Sprache zu erlernen, oder sogar gebildet
zu sein. Die Minenfelder ihres südlichen Feindes ließen sie auf ihre
höchsteigene Art und Weise räumen. Sie befahlen ihren Soldaten anzutreten.
Schulter an Schulter laufend opferten die Söhne chinesischer Mütter ihre
Gliedmaßen und ihr Leben. So schonte Mao die teure Technik. Die Stasioffiziere
Kindler, Zachow, Zander, Plauschinat und andere, die als Hobbyfischer in
unserer Baracke am Oberbach aus- und eingingen, waren verlegen, wenn ich sie
fragte, wer begreifen kann, was die chinesischen Marxisten trieben: „Niemand
kann verstehen, dass ein kommunistisches Land ein kleineres, ebenfalls
kommunistische Land weg ein paar Quadratkilometer Erde mit Krieg überzieht.“ Müde und in Gedanken versunken, die nur wenig
mit unserem Vorsatz der Einfuhr einer neuen Fischart in den Tollensesee zu tun
hatten, näherten wir uns der Grenze. Obwohl mir bewusst war, dass selbst
millionenfache Friedenswünsche gar nichts am großen Geschichtsverlauf ändern
können, stand mir deutlich vor Augen, dass wir andererseits jedoch selbst
entscheiden, ob wir innerlich frei und sicher mit mühsam gesuchten eigenen
Einsichten bleiben, oder ob wir uns verlocken lassen den Weg des geringsten
Widerstandes in die Verstrickung zu wählen.
Außer durch die Zollbeamten, die
möglicherweise doch einen Blick in unser Auto werfen würden und dann nach den
nicht vorhandenen Zertifikaten fragen könnten, stand für uns und das
Wohlergehen der Coregonen nicht viel zu befürchten. Natürlich war es verboten,
was wir taten. Falls sie unbequeme Fragen stellen sollten, wollten wir den
polnischen und den deutschen Zöllnern weismachen, es handele sich unserer
Auffassung nach nicht um Tiere sondern um Laichprodukte und das Wasser aus der
polnischen Brutanstalt mische sich in der Ostsee ja sowieso mit dem deutschen,
noch innerhalb der Grenzen. Ganz schön frech war unser Plan, der darauf baute,
dass die gerade von beiden Regierungen beschlossenen Freizügigkeiten im
Grenzverkehr auch funktionierten. Daheim würde dank Reiner Lüdtkes Hinweis
alles vorbereitet sein. Beide komplikationslos ans Stadtleitungsnetz
angeschlossenen Zugergläser konnten und sollten unsere ungefähr 300 000 Eier
aufnehmen. Zudem hatten wir unsere Gläser in zwei der knietiefen Plasterinnen
gestellt. Es war wohl um Mitternacht, als wir am Zollkontrollpunkt ankamen.
„Was wünschen Sie auszuführen?”, fragte der polnische Offizier in Deutsch.
Er leuchtete mit seiner Taschenlampe nach hinten und betrachtete die auf dem
Hintersitz meines Trabant-Kombi und auf der Hutablage liegenden und anscheinend
vom harten Stopp noch erheblich nachbebenden Fünfzigliterplastesäcke. Beide
waren bedeckt von zwei dünnen Wolldecken um die Temperatur konstant zu halten. „Jaikas!”,
sagte Kurt. „Jaikas!” wiederholte der Zöllner und in seiner Stimme
schwang das Schüttern mühsam zurückgehaltenen Gelächters. Er dachte wohl an
zerdepperte Eierschalen. „Eier! Na, denn winsche ich guutte Fahrt!” Im
Rückspiegel sah ich, wie er sich amüsierte. Die Vorstellung von Rühreiern muss
ihn schier überwältig haben. Jungs, so eine große Pfanne haben nicht mal die
Berliner!
Auch die deutschen Grenzer behandelten uns großzügig. Gegen zwei Uhr morgens,
wenige Minuten, nachdem wir sie in unsere Zugergläser gegeben hatten,
schlüpften die Großmaränen. Die zweifache Umstellung auf neuartige Verhältnisse
binnen weniger Stunden löste wahrscheinlich diese “Frühgeburtssituation” aus.
Über die an die Gläser geschlossenen Kopfringe und Abflussstutzen samt
Gummischläuchen strömten sie zu zehntausenden in die neue Welt. Der zweite Akt
ging somit erfolgreich zu Ende.
Wichtiger als alles andere war nun, die kostbare Brut mit Lebendfutter zu
versorgen. Mit Schleppnetzen aus Müllergaze und getrieben von Kutterkraft
siebten wir bereits acht Stunden später einige tausend Kubikmeter Tollense
Seewasser aus. Hüpferlinge mussten wir fangen, Kleinkrebse, Cyclops.
Am ersten Tag ihres Fischlebens visierten unsere “Nasus”- Maränen die vor ihren
Mäulern herumschwimmenden Krebschen nur an und probierten lediglich, wie sie
denn zuschnappen könnten. Aber schon vierundzwanzig Stunden später ging die
wilde Hatz los. Drei-, viermal nehmen sie Anlauf, beugen den Schwanz wie ein
Hecht und schießen dann, ihre Muskeln streckend, mit weit geöffnetem Rachen auf
ihr Opfer zu. Eine größere Nauplie - ein im vorletzten oder letzten
Häutungsstadium befindliches Kleinkrebschen oder auch schon ein ausgewachsener
Hüpferling verschwindet zwischen den Kiefern der kleinen Fresserin wie eine
handlange Plötze zwischen den Zähnen eines Hechtes. Drei lange Wochen ging
alles problemlos, verlustlos! vor sich. Nicht wie bei unseren vorherigen Versuchen
mit den Kleinmaränen, die während der ersten Vorstreckphase zu hunderttausenden
verreckten, obwohl sie inmitten von Wolken zuckenden, springenden Futters
standen. Ehe wir damals dank “Männe” Taeges Untersuchung erkannten, dass unsere
Kleinkrebse die maulgerechte Größe bereits weit überschritten hatten, war es
für die meisten unserer Kleinmaränenbrütlinge bereits zu spät. Großmaränen sind
da von Anfang an im Vorteil. Als Brütlinge sind sie nur etwa zwei Millimeter
größer, aber das reicht zum Überleben aus. Wie eine Armee hüben und eine andere
drüben standen sich in unseren beiden Futterrinnen die Fronten im klaren Wasser
gegenüber. Hier die geübten, verwöhnten, überlegenen mittlerweile bereits zwei
Zentimeter groß gewordenen “Nasus”, da die vor den unersättlichen Fressern
zurückweichenden Hüpferlinge, die instinktiv zusammenhalten wie Schafe, die von
Hunden umkreist werden. Da sie sich so im Schwarm bewegten, gab es keine
Schwierigkeiten, die Plasterinnen sauber zu halten. Ganz anders als bei den
einzelgängerischen Hechten erwischte der Abfallsauger fast nie eine der
geschickt ausweichenden Maränen. Blitzsauber konnten wir so die
Vorstreckaquarien halten. In der vierten Woche passierte es. Wir waren bereits
hochmütig geworden. Bis zum Nachmittag des 22. April kamen sie, die Berliner,
Prenzlauer, Warener Kollegen, auch die Nichtfachleute von der Bezirksleitung
SED Neubrandenburg. Alle klopften uns auf die Schultern und lachten, wenn wir
ihnen vom Husarenstreich erzählten, wie wir die langatmigen Prozeduren der
Beschaffung von Zertifikaten umgangen hatten. Wir prahlten schon, dass wir die
Fische fingerlang machen könnten, ausgedünnt natürlich unter Inanspruchnahme
mehrerer Rinnen. Denn über die verfügten wir ja. Es waren nämlich vier weitere
da, und das Futter fiel uns in jenem Jahr fast von selbst zu. Wir hätten mit
wenig Aufwand täglich hundert Kilogramm Nauplien und die ausgewachsenen
Hüpferlinge fangen können. Unsere Maränen fraßen wie die Scheunendrescher und
sie gediehen prächtig, bis zu jenem schwarzen Aprilmorgen des 23., an dem wir
achtzig Prozent tot vorfanden. Die Stadtwerke hatten das Leitungswasser mit
Chlor behandelt! Anruf! „Nein! Chloriert wurde nicht!” Was dann? Die
Taumelbewegungen der überlebenden zwanzig Prozent Nasus zeigten an, dass auch
sie nicht überleben würden. Wie ein Blitz schlug die schlechte Nachricht im
Institut für Binnenfischerei in Berlin- Friedrichshagen ein. „Los! Der
Fischseuchendienst des VEB Prenzlau muss sofort nach Neubrandenburg fahren.
Ursachenermittlung! Vorsorglicher Einsatz von Trypaflavin in für Aufzuchtbecken
üblichen Konzentrationen! Neue Weisungen für gezielten Medikamenteneinsatz
abwarten.” Wir hatten alle guten Voraussetzungen übermütig als gegeben
hingenommen. In je zehn Minuten Kutterschleppnetzeinsatz hatten wir Unmengen
Zooplanktonten gefangen. Wir konnten mit dem besten Futter der Welt aufwarten.
Unsere Rinnen waren perfekt sauber. Das Leitungswasser wies ideale Parameter
auf. Und nun ordnete das Institut eine Überprüfung an, ob Großalarm für die
Ostseeküste ausgelöst werden müsste. „Wahrscheinlich sind die in den
Großhälteranlagen stehenden Forellenbestände gefährdet, durch Einschleppen
einer noch unbekannten Krankheit. Jedenfalls ist ein Übergreifen auf sämtliche
Lachsartigen im Territorium nicht auszuschließen.” Deshalb müsse
festgestellt werden, was die Zertifikate besagen.
Achttausend setzten wir schließlich aus. Sie
müssen überlebt haben, denn ihre Nachkommen fingen wir überall im See. Bereits
sechs Jahre später gingen uns kiloschwere Exemplare ins Netz. Und alle
Altersgruppen. Eine Delikatesse wenn sie geräuchert wurden, sogar eine
Extraklasse, auf die wir ein wenig stolz sein durften.
Im Sommer 78
von meinem Zweigpräsidenten wurde ich gebeten
Gustav Briel zu besuchen. Er hatte sich als alter Mann der Kirche angeschlossen
und wohnte nun wieder, nach fünfzigjähriger Abwesenheit, in Penzlin. Er war aus
Westdeutschland in seine Heimatstadt zurückgekehrt, hatte hier noch einmal
geheiratet. Wir sahen sofort, dass Bruder Briel seiner siebzigjährigen Frau und
erst recht seiner steinalten Schwiegermutter nicht gewachsen war. Die Uralte
saß im Ohrensessel und jedes Mal, wenn ich den Mund aufmachte erwiderte sie: “Wissen
Sie nicht, dass es ungehörig ist, das Wort zu nehmen bevor die Dame des Hauses
es Ihnen erteilt?” Wir wurden extrem scharf abgewiesen.
Die wortgewandte Uralte starb.
Danach unternahm ich zwei oder drei weitere
Versuche um mit Briels ins Gespräch zu kommen. Doch wie zuvor, wies mich Frau
Briel stets brüsk zurück. “Da ist die Tür!” Die Mormonen seien eine
furchtbare Sekte. Sie wünsche keine Diskussion. Bruder Briel neigte sich
bekümmert, geleitete mich die Treppe hinunter und bat: “Bitte, kommen Sie
nie wieder! Ich weiß, dass die Kirche wahr ist, aber ich will in Frieden leben.
"
Aber selten zuvor hatte mich eine Aufgabe
mehr gereizt, als die diese Tür zu knacken.
Eines
Tages kam ich von einer Fischereitagung aus Waren, musste also auf dem Weg nach
Neubrandenburg durch Penzlin fahren. Ungefähr zehn Kilometer vor dem Ortsschild
habe ich - ich denke die Art war ziemlich ungebührlich - im Auto laut gerufen: “Lieber
Vater im Himmel. Ich bitte dich und bestehe darauf, mir zu helfen, eine Tür in
Penzlin zu öffnen.” Jedes Detail erwähnte ich, Namen und Vornamen meiner
Seelenfeindin, die Straße, die Hausnummer, die Umstände und konzentrierte meine
ganze Gedankenkraft auf dieses Ziel. Vor dem Wohnhaus, in der Bahnhofstraße 19,
angekommen, stieg ich aus meinem Trabant und nahm die Stufen, zwar
hoffnungsvoll, doch nicht ganz so schnell wie sonst. Ich klopfte. Sie öffnete.
Ihr Gesicht sprach absolute Ablehnung und Härte. Durch den kleinen Türspalt,
den sie noch zuließ, sah ich ein Bild in ihrem Zimmer. Sie folgte meiner
Blickrichtung. Sie schaute mich an. Sie hätte ja fragen können: “Warum
stecken Sie Ihre dämliche Nase immer in fremde Angelegenheiten?” Aber zu
meiner Verwunderung hörte ich: “Das ist mein erster Mann. Kommen Sie
herein!”
In den nächsten zwei Stunden erfuhr ich
alles, was in dieser Sache für mich zu wissen wichtig war. Der Mann mit der
Pickelhaube, den sie als junges Mädchen geliebt hatte, war eine Woche nach der
Eheschließung im letzten Jahr des Ersten Weltkrieges an der Westfront gefallen.
Auf den zweiten Jugendfreund, Gustav Briel, hatte sie fünfzig Jahre gewartet.
Kaum erneut verheiratet, bemerkte sie, dass sie ihn mit einer furchtbaren
Organisation teilen sollte, deren Anliegen war, ihn eines Tages ganz von ihrer
Seite zu reißen. Lehre und Struktur der Mormonensekte seien dementsprechend
beschaffen. Alle die sich dieser Geheimorganisation anvertrauten, würden total
vereinnahmt. Ihr Anti- Mormonismus oder das was sie dafür hielt, ließ sie nicht
im Zweifel.
Ich konnte nicht anders, als manchmal
verstehend und einmal sogar zustimmend zu nicken, was sie wiederum verwunderte.
Das sei zwar so. Dieses Ganz-oder-gar-nicht
Prinzip wirkte. Halb Mitglied dieser Kirche zu sein war praktisch unmöglich.
Nur, das bedeutete nicht, dass sie, als Ehefrau eines Mitgliedes, dadurch einen
geringeren Platz einnehmen würde. Denn die wichtigste Aufgabe jedes Mitglieds
meiner Kirche war und ist treu zu seinem Ehepartner zu stehen, gleichgültig ob
der die Glaubensansichten teilt oder nicht.
Das
formulierte ich so gut wie möglich und gewann wohl einen kleinen Punkt.
Im Wesentlichen irrte sie sich natürlich.
Aber wer weiß, wessen mehr oder weniger tendenziöse Bücher sie über Mormonen
gelesen hatte? Aus ihrer Perspektive gesehen, stellte sich die, meines Wissens,
beste Philosophie der Weltgeschichte als Ungeheuerlichkeit dar. Sie brachte es
schnell auf den Nenner: „Warum weigert mein Mann sich mir alles über die
Zeremonien im Mormonentempel zu erzählen? Warum trägt er Unterkleidung mit
Geheimzeichen? Was verschweigt er mir?
Um mich korrekt zu verhalten musste ich weit
ausholen…
Als ich heimfuhr, war mir klar, dass ich
nicht nur ihr Ohr, sondern ein bisschen die Zuneigung dieser nicht
unbedeutenden Frau gefunden hatte. Sie war zu Beginn der dreißiger Jahre
Lyzeums Direktorin gewesen und verfügte über eine wunderbare Beredsamkeit. Ich musste
ihr versprechen, wiederzukommen.
Von da an besuchte ich sie und ihren Mann
monatlich mindestens einmal. Immer wurden es Vier-, Fünfstundenrunden. (Meine
Söhne als meine Heimlehrerpartner erledigten in dieser Zeit jeweils ihre
Hausaufgaben oder Korrespondenz mit ihren Freundinnen und manchmal sind sie mir
immer noch ein wenig gram, weil ich sie in entsetzliche Langeweile getrieben
habe. Aber ich bin unschuldig! wann immer ich nach einer halben Besuchsstunde
aufbrechen wollte kommandierte sie, das sei pure Unhöflichkeit.)
Jahrelang ging es gut, immer besser.
Eines Tages erklärte sich mich für ihren
Freund: „Bitte bringen Sie ihre Frau mit!“
Das
geschah zur Zufriedenheit beider Damen. Ich war, ehrlich gesagt, stolz solche Freundin zu haben. Sie las
irgendein mehrstrophiges Gedicht zwei- oder dreimal und sagte es dann
fehlerfrei auf. Da war eine Szene, die mir so lebhaft schilderte, die mir bei
entsprechender Gelegenheit, so lebhaft vor Augen stand, wie sie im Sommer 1945,
damals noch als Hitlers Parteigenossin Pfaffenberg vor der Warener
Entnazifizierungs-kommission und als Nummer 146 auftrat. Ein dort amtierender
Erzkommunist fragte sie höhnisch: “Na, Frau
Pfaffenberg, Sie haben also auch der Nazipartei beitreten müssen!”
Sie hätte heftig zurückgeschnarrt: She snoreed back.
“Ich bitte mir aus, nicht in diesem Ton mit
mir zu reden. Ich war eine überzeugte Nationalsozialistin! Ich, Martha
Pfaffenberg habe gewusst, was ich tat. Der Führer war mein Ideal. War, meine
Herren, habe ich gesagt! Das merken sie sich bitte!” Das muss sie recht laut und mit dem ganzen
Nachdruck ihrer starken Persönlichkeit gesagt haben.
Alle schläfrig vor sich hindösenden
Mitglieder der Kommission seien plötzlich hochgeschreckt und hätten sie mit
geweiteten Augen angestarrt. Das war für sie ganz und gar ungewohnt, wie jemand
sich auf solche Art und Weise zum zu Recht verfemten Nationalsozialismus
Hitlers stellte.
“Jawohl, ich war Hitlers treue Parteigängerin
solange, bis er gegen die Juden vorging. Ich war sehr wohl für die Verweisung
bestimmter Juden in ihre Grenzen, aber niemals für ihre Verfolgung. Als ich das
sah, habe ich dem Führer mein Parteibuch vor die Füße geworfen.”
Die vor den untersuchenden Herren sich
aufreckende Frau muss ihnen Hochachtung abgenötigt haben, umso mehr, da sie so
häufig auf Waschlappen stießen, die jammervoll beklagten, sie hätten keine
andere Wahl gehabt und seien wider Willen der Hitlerpartei beigetreten.
Der Vorsitzende der
„Reinwaschungskommission“, allerdings ließ sich wenig beeindrucken. “Ja, und?
Man weiß, dass Sie bis zuletzt Mitglied der NSDAP waren.”
“Meine Herren, ich schulde ihnen gar nichts.
Aber wenn sie wie ich einen gefährdeten Vater gehabt hätten...” mit anderen Worten sie musste Rücksicht
auf Familienmitglieder üben.
Der Gauleiter Pommerns Swede-Coburg, hatte
ihren 1938 erfolgten Parteiaus-tritt nicht anerkannt und gedroht, man könne
sich dann an ihren Vater halten. Eine Lyzeums Direktorin durfte die Partei
nicht verlassen. Diese Androhung von Sippenhaftung brach ihren Mut. Aber sie
habe sich seit 1938 als Nichtmitglied betrachtet, daran lasse sie nicht
rütteln, gleichgültig ob die Fakten für oder gegen sie sprächen. Mir erzählte
sie, wie sie ihren Glauben an Gott in den Hitlerjahren verlor. Was sie bewegte,
war nicht so sehr das Unheil an sich, das Gott zuließ und das schließlich nur
feige Menschen einander zufügt hatten, sondern es war die Zänkerei unter den
beiden Ortsgeistlichen. Wann immer sie selbst als dritte Partei im selben
Wohnhaus Zeuge der gehässigen Auseinandersetzungen unter Theologen wurde,
verlor sie Glaubenssubstanz. Bis nur noch ein Rest von Religion in ihr übrig
geblieben sei. Wörtlich fügte sie hinzu: “Heute glaube ich nur noch zehn
Prozent von dem, was mit traditionellem christlichem Denken zu tun hat.”
Für mich schrieb und sang sie. Sie hatte an
den Mormonen fast nichts mehr auszusetzen. Bis ihr Ehemann, - nicht ich - einen
Schritt weiter ging, als sie nachzugeben bereit gewesen war. (Sie vergaß
niemals irgendetwas, das für sie von Belang war.)
In seiner Naivität hatte er seiner Frau
begeistert erzählt wie gut es ihm getan hatte wieder eine Versammlung unserer
Kirche besucht zu haben. Er beichtete ihr, dass er an jedem Tag in der
Vergangenheit innerlich auf der Seite seiner Kirche gestanden hätte, auch
damals als sie es ihm strikt untersagte. Das Ihr Mann sich plötzlich stark
machte, verkraftete sie nicht. Sie fühlte sich überfahren. Die Erregung über
die Entdeckung, von mir überlistet worden zu sein, raubte ihr den Schlaf. Sie
beorderte mich nach Penzlin.
Unser mühevoll gemeinsam errichtetes Haus der Übereinstimmung riss
sie mutwillig ein, indem sie ihrem Mann und mir verbot noch irgendeinen Satz zu
wechseln. Sie verbot mir endgültig ihr Haus zu betreten.
Zum ersten und letzten Mal seit Beginn der
Jahre unserer Freundschaft erwies sie sich wieder vom Scheitel bis zur Sohle
als die unflexible alte Oberlehrerin die sie stets gewesen war. Dabei hatte
meine Seelenfreundin Martha Briel immer gezählt wie viele Menschen zu ihrer
Beerdigung kommen würden. Sie war damit nie weit gekommen, wie sie mir schon
früher anvertraut hatte. Ihr harter, schnurgerader Charakter hatte sämtliche
Menschen mit ihren scheinbar windschiefen Ansichten längst für immer
beiseitegestoßen. Sogar ihr Bruder mied ihren Umgang. Zu erneutem Betteln
fehlte mir die Lust.
Leningrad
Es war den
Genossenschaften erlaubt 5 % des Umsatzes auf den Kulturfond zu überweisen. So
gelang es, bei steigender Produktion erhebliche Summen anzusparen um uns zu
ermöglichen, im drei-Jahres- Rhythmus, mit unseren Ehefrauen Wochenurlaube im
Ausland zu verbringen. So sahen wir den Smolny und den Winterpalast der Zaren.
Im Smolny befanden sich die Büros der regionalen Parteizentrale. Im Smolny
wurde einer der engsten Mitarbeiter Stalins erschossen, Kirow. Ich löste um
Haaresbreite einen Eklat aus, weil ich der dolmetschenden Stadtführerin die
Frage stellte, ob es tatsächlich andere führende Leningrader Kommunisten waren
die den Tod Kirows zu verantworten haben: „Wie kommen sie zu dieser Frage,
woher wissen sie davon?“ Der Ton war scharf und vorwurfsvoll. Ich konnte
mich nur beglückwünschen, dass ich nicht fragte, worum es mir eigentlich ging:
Nämlich: „Ist Stalin selbst schuld daran?“ Denn einige sonst vorsichtige
nicht staatskonforme Leute ließen mich wissen, sie hätten gewisse Literatur.
Ich erhielt für zwei oder Tage zur Ausleihe das Buch des Dissidenten Wolfgang
Leonhard: „Die Revolution entlässt ihre Kinder“. Spannend geschrieben
vermittelte es uns eine Fülle von Informationen aus erster Hand. Leonhard kam
mit seiner Mutter als 13-jähriger, 1934, in die Sowjetunion. Die Lyrikerin
Susanne Leonhard war auf die russische Propaganda hereingefallen. Wie viele andere
Idealisten, erkannte sie desillusioniert die Hintergründe des Systems und wurde
als "kommunistische Abweichlerin" in ein sowjetisches Straflager in
Sibirien verbannt. „Ihr Sohn Leonhard bekam eine strenge Ausbildung an der
Komintern-Schule und wurde dort für spätere Führungsaufgaben innerhalb der
Kommunistischen Partei vorbereitet. Zusammen mit der "Gruppe
Ulbricht" (Ulbricht: "Es muss alles demokratisch aussehen…")
schickte man ihn 1945 als Polit-Kommissar ins zerstörte Nachkriegs-Deutschland.
Die Zwangsvereinigung von KPD und SPD in der SBZ gab ihm den Anstoß, 1950
siedelt er dann in den Westen über.“ Heike Mund „Deutsche Welle“
Im erwähnte Werk Wolfgang
Leonhards stand der Satz geschrieben: „Seinen Rivalen, den Leningrader
Parteichef Kirow, ließ Stalin 1934 ermorden.“ nachdem Kirow auf dem XVII.
Parteitag der KPdSU desselben Jahres hinnehmen musste, dass 292
Delegierte gegen ihn stimmten und nur drei gegen Kirow. Dies betrachtete Stalin
als unverzeihliche Demütigung. Kirow sollte ihm überlegen sein? Wir
erfuhren durch verschiedene Kanäle, dass mit der Untersuchung dieses
Mordfalles, auf Weisung Stalins die berüchtigten Schauprozesse in der
Sowjetunion begannen, die tausende Unschuldige zum Tod durch Erschießen
verurteilten. Ich antwortete der jungen Dame, als wir auf
den Stufen dieses Gebäudes standen: „Die Parteipresse in der DDR hat viel
darüber berichtet!“ Sie schwieg, sie fühlte sich unsicher, und lenkte ab.
Beweise für Attentatspläne oder den Mordauftrag an Kirow gab es nicht - der
ganze Prozess basierte auf erzwungenen Geständnissen. "Ich fordere,
diese tollwütigen Hunde zu erschießen, jeden Einzelnen von ihnen",
forderte der oberste Richter Wyschinski dieses Prozesses als vorgebliche Rache
für Kirows Tod. Am 25. August 1936 wurden die obersten des bisherigen Regimes
Kamenew und Sinowjew im Keller des Moskauer Lubjanka-Gefängnisses erschossen.
All das war den Oppositionellen des Kremlsystems wichtig. Ich glaube, dass sich
neunzig Prozent der Bevölkerung der DDR eingeengt und eingesperrt fühlten.
Abends gab Erika mich
frei, während sie sich niederlegte und ich besuchte einen Gottesdienst der
orthodoxen Kirche. Da standen hunderte und schauten mit mir zu wie die
feierlichen Exerzitien vollzogen wurden. Einem „Mormonen“ war all das sehr
fremd. Ähnliches kennt er nicht. Ich sah nur wenige Männer in der
Besuchermenge. In meinem bräunlichen Mantel, und überhaupt nach meinem Aussehen
fiel ich auf. Mindestens zwei ältere Herren verdrückten sich, nachdem ich sie
musterte. Ich glaube sie hielten mich für einen Geheimpolizisten. Anschließend
küssten die Anwesenden eine größere Ikone die unter Glas ausgestellt worden
war. Alle Münder berührten wohl dieselbe Stelle. Am nächsten Morgen wollte ich
zur selben Kirche gehen, die nicht weit entfernt dastand. Da traf ich einen
alten Mann mit auffallend mildem Gesichtsausdruck. Wir verständigten uns
radebrechend. Ich konnte sehen, wie ernst es dem intelligent wirkenden Mann mit
seiner Religion war. Immerhin trägt die Russisch-orthodoxe Kirche zwei
Gesichter, das äußere mit ungeheurem Pomp und das Innseitige der echten
Frömmigkeit. Ich werde ihn nie vergessen, diesen etwa dreißigjährigen,
hünenhaften Goten im Gewand eines russisch-orthodoxen Priesters dort. Sein
junges, weißes Gesicht, der ganze wunderbare Ausdruck seiner Persönlichkeit.
Ein hakennasiger Sechziger, mit langem, schmalem Gesicht und gewisser Hoheit,
der ein Intellektueller sein musste, kam mit anderen Besuchern nach vorne. Der
junge Geistliche nahm ihn unter die Stola und gab ihm wie ich vermute einen
Segen. Beider Männer Mienenspiel bewies mir ihre ganze Ergebenheit gegenüber
Gott.
Utah
1982
erlaubte mir die DDR-Regierung, die Einladung meiner Kirche anzunehmen um an
der 152. Generalkonferenz in Utah teilzunehmen und drei Wochen dort bleiben zu
dürfen. Ich trug nun schon seit fast achtzehn Jahren für die wenigen hundert
Mormonen in Mecklenburg gewisse Verantwortung. Der wiederum für mich zuständige
Abschnittsbevollmächtigte der Volkspolizei kam in meinen Betrieb und stellte,
wie ich später erfuhr, noch Nachfragen an den Vorsitzenden der
Fischereigenossenschaft Reinhardt Lüdtke, dessen Stellvertreter ich seit langem
war. Das konnte ich selbst nicht glauben, dass sie mich und meine Frau nach
Amerika reisen lassen würden. Es stellte sich denn auch zum Schluss heraus,
dass Erika leider nicht mitfliegen durfte. Ihr Flugticket war bereits bezahlt,
die Hotelplätze für die Konferenztage bestellt. Nichts da. Die Ehefrau blieb
zurück, als Faustpfand. Dabei wären wir zur Not zu Fuß über die Beringstraße zu
unseren Kindern zurückgekommen. Noch als ich bereits in der auf dem
Schönefelder Flugplatz stehenden KML - Maschine
saß, dachte ich, es könnte immer noch ein Aufruf kommen: 'Herr Skibbe, bitte
nochmals zur Passkontrolle. Bedauerlicherweise ist uns ein Versehen
unterlaufen. Sie müssen noch etwas klären.' Aber dieser Aufruf kam nicht,
unglaublicher Weise rollte das Flugzeug mit mir zum Startplatz. Wir flogen fast
über Neubrandenburg hinweg. Da, damals, bei KML-Maschinen die Tür zum Cockpit
noch offenstand, versuchte ich einen Blick auf die Armaturen zu werfen. Der
Kopilot lud mich ein, näher zu kommen und erklärte mir geduldig, was ich zu
wissen wünschte.
In Amsterdam hatten wir Zwischenaufenthalt.
Schon das war überwältigend für mich. (Ebenso die Summe von zweihundert Mark
für ein Bett im Hilton Hotel des Amsterdamer Flughafens.)
Zum Glück musste ich die nicht zahlen. Ich
bekam allerdings vor der Weiterreise von meinem Missionspräsidenten Henry
Burkhardt einhundert Dollar ausgehändigt. Mein Taschengeld! Von wegen. Ich
schwor mir, es unangetastet in die DDR zurück zu bringen. Mineralwasser für
vier Westmark? Lieber trank ich klares Leitungswasser. Nachdem ich meine Füße
bewusst auf amerikanischen Boden setzte, lief ich zwei Stunden lang neugierig
auf die Gerüche der neuen Welt im Flughafenbereich Chicagos umher. Schrieb dann
- als echt naiver DDR-Bürger - in mein Reisetagebuch: “Amerika ist
faszinierend! Vielleicht aber nur, weil alles neu ist. Doch schon allein dieser
Umgang miteinander! Das Verhältnis des Verkäufers zum Kunden. Er wird
angelächelt, der kleine Mann, obwohl er nur kritisch prüft, statt zu kaufen. Da
wird in den noch nicht gekauften Magazinen ganz ungeniert geblättert, alles
wird angefasst, Bonbons werden auf Eignung und Konsistenz hin befummelt und zum
Schluss bleibt der ganze Kram liegen, aber die Damen und Herren Ladenbetreiber
verlieren weder Hoffnung noch die Geduld...”
Ein Mann um die 40 hatte ein Pornoheft in der
Hand. Mir schien, er hielt es mir absichtlich unter die Nase. Es stellte sich mir die Frage, warum duldet
eine Frau solche Aufnahme? Als wir am späten Nachmittag der Sonne hinterher
fliegen, etwas langsamer als die Erde sich dreht und es ganz allmählich zu
dunkeln anfängt, sehe ich aus elf Kilometern Höhe die unendlichen Weiten
Nebraskas unter mir dahingleiten. Ob das da unten der Platte-River ist, an dem
die Mormonenpioniere vor fast anderthalb Jahrhunderten mit ihren Planwagen
ihrem unbekannten Ziel, das irgendwo in den Felsengebirgen liegen sollte,
entgegen gezogen sind? Über sechzigtausend Mormonen haben bis zur
Fertigstellung der Eisenbahn die Prärien zu Fuß überquert. Die ersten 1846,
nachdem rabiate Andersdenkende die ersten vierzehntausend zwangen, ihre
eigenhändig errichtete Stadt Nauvoo in Illinois zu verlassen. Mitten im Winter.
Was für ein Stoff für kommende Generationen
von Dokumentaristen und Filmemachern.
Zumeist zogen sie in Gruppen bis zu
zweihundert oder dreihundert nach Westen. Ich denke an die Martin- und die
Williegruppe, die 1856 mit selbstgebauten Handkarren die Strecke von Iowa nach Salt
Lake City zu überwinden hatten. Mein Flugzeug wird dafür zweieinhalb Stunden
benötigen, und während ich eine Mahlzeit zu mir nehme, überqueren wir ebenso
leicht wie ahnungslos ein Gebiet, in dem sich, vor 126 Jahren die
erschütterndsten Tragödien abgespielt haben. Denn zweihundertzweiundzwanzig
Mitglieder der Kirche, die in jenem Jahr auf dem letzten Teil der Strecke von
Schneestürmen und Wagenzusammenbrüchen heimgesucht wurden, sollten nie
ankommen.
Einige meiner Freunde, die im Verlaufe der
Zeit ausgewandert waren, holten mich vom Flugplatz in Salt Lake City ab,
darunter waren Edith und Walter Rohloff sowie Siegfried, ebenfalls ein
Exneubrandenburger, der nun hier erfolgreich ein Delikatesswarengeschäft
betrieb. Er stellte mir, ganz und gar ein erfolgreicher Geschäftsmann die für
mich kaum glaubhafte Frage: “Von den
drei Wochen hast Du fast vierzehn Tage für Dich. Was wünschst Du zu sehen?
Wollen wir nach Kalifornien fliegen zum Meeresangeln?” Ich wünschte natürlich vor allem zur
kircheneigenen Brigham -Young - Universität nach Provo zu gehen, um mit
Professor Hugh Nibley zu reden, einem deutschsprechenden Altsprachler, von dem
ich eine Anzahl, allerdings nur kurze Aufsätze, gelesen hatte. Mich interessierten
seine Ansichten zu einer Reihe spezieller Fragen. Über den Norddeutschen
Rundfunk war wieder einmal eine negative Information über uns verbreitet
worden. Drei Mormonenstudenten hätten in ihren Studien herausgefunden, dass die
in "Köstliche Perle" veröffentlichten Faksimiles aus dem ägyptischen
Totenbuch von Joseph Smith aus dessen genereller Unfähigkeit heraus falsch
interpretiert worden seien. Der siebzigjährige Nibley, ein nicht sehr großer,
fast dürrer Mann, sprang behände auf, als ich ihm die Angelegenheit vorstellte.
In einem dreihundertseitigen Buch hätte er zu dieser Thematik grundsätzlich
Stellung genommen. Sämtliche verfügbaren Belege hätte er darin der
Öffentlichkeit unterbreitet. Es sei nicht wahr. Nicht irgendwelche drei
Studenten hätten die offizielle Version attackiert, sondern ein Hochschullehrer
für Anglistik, der wegen Ehebruch in einem Ausschlussverfahren der Kirche
steckte und sich so abzureagieren versuchte. Nibley erläuterte mir, dass die
Ägyptologen ohnehin herausgefunden hätten, dass es zum Faksimile Nummer eins in
"Köstliche Perle", eine Unzahl unterschiedlicher Interpretationen
gäbe. Das sei die Art der alten Ägypter gewesen, gewisse Dinge im religiösen
Bereich mehrdeutig darzustellen. “Sehen Sie mal,” sagte er “für uns
ist doch wichtig zu wissen, dass Gott ein Gott der Offenbarung ist. Immer
wieder hat er zu bestimmten Menschen gesprochen, Konfuzius, Buddha, Lehi. Und
genau das behaupten die alten Ägypter und die Hebräer, auch Joseph Smith und
wir mit ihm. Deshalb besteht zwischen den ältesten Überlieferungen ein
Grundkonsens.”
Nibley, der den mit mir vereinbarten Termin
zunächst buchstäblich verschlafen hatte, wurde immer munterer. Sein schmaler,
langer Kopf ruckte hin und her. Er wies mich auf den ältesten, enträtselten,
den Shabakostein hin, der bereits von der Notwendigkeit des Erlösungsplanes
Gottes spricht. “Sehen sie mal”, erklärte er, ging an die Tafel und nahm
Kreide in die Hand. “Die Kernlehren verschiedener Religionen Asiens, Afrikas
und Amerikas bestätigen einander tatsächlich. Ganz besonders weist die Religion
der alten Ägypter auf den gemeinsamen Ursprung aller Religionen hin. Sie reden
alle vom Schöpfergott und alle verlangen, dass wir Gott verehren sollen, indem
wir seine Gebote halten. Den Weihrauch braucht er nicht, nicht die Liturgien,
sondern unser Herz und Verstand soll sich ihm zuwenden. Das vierte Gebot von
den berühmten zehn wird bereits im ägyptischen Papyrus Eber erwähnt, einem der
ältesten Schriftdokumente überhaupt: 'Schön ist es, wenn ein Sohn seines Vaters
Rede wohlaufnimmt, Gott wird ihm dafür ein langes Leben gewähren.' Das sei ein
deutlicher Beweis, dass das Evangelium viel älter ist, als bisher angenommen
wird.
Im Buch Abraham, das Joseph Smith nicht
unumstritten übersetzte, heißt es in 1, 26” Dr.
Nibley zitierte aus dem Gedächtnis: “(der erste) Pharao, der ein
rechtschaffener Mann war, begründete sein Königreich und richtete sein Volk
weise und gerecht, alle seine Tage, und er trachtete ernsthaft danach, die
Ordnung nachzuahmen, die von den Vätern in den ersten Generationen aufgestellt
worden war, in den Tagen der ersten patriarchalischen Regierung...”
Nibley fuhr fort: “Diese Aussage, von
Joseph Smith formuliert, kann in ihrer Bedeutung nicht überschätzt werden!
Dieser Text hat nicht nur für den Insider große praktische Bedeutung, weil er
zeigt, dass viele Religionen und ihre Tempelkulte, sowie das Freimaurertum (wie
schon Schikaneder und Mozart in der “Zauberflöte” zeigten) im Altägyptischen
wurzeln. Damit sei zugleich klar, dass es falsch ist zu behaupten, die
mormonischen Tempelrituale seien dem Freimaurertum entlehnt. Denn die
erheblichen Unterschiede legten den Schluss nahe, dass das verloren gegangene
Original einen vorägyptischen Ursprung hat. Das sei von größter Bedeutung,
etwas, das leider mitunter sogar vorsätzlich übersehen werde.”
Nibley sagte mir, die Allgemeinattacken auf
den Mormonentempel werden von der Mehrzahl der großkirchlichen und der
jüdischen Tempelforscher nicht geteilt.
Zwei volle Stunden hatte sich der
Vielbeschäftigte für mich Zeit genommen.
Mit dankbarem Gefühl verließ ich sein Büro. Ich
sah mich in Salt Lake City gründlich um. Wir fuhren auch zum
Immigrationscanyon. In der Nähe stand ein Denkmal, mit dem die hiesigen
Mormonen aller Siedler und Pioniere gedachten, die auf dem Oregon - Trail
zunächst bis hierherkamen oder wie ihre Glaubensgenossen, die tapfer im
unwirtlichen Land blieben, um es urbar zu machen.
Mein Blick glitt über viele tausend
Einfamilienhäuser der Millionenstadt und es fiel mir schwer, mir vorzustellen,
wie es damals war, bevor die ersten Siedler das Wasser aus den Bergen
herableiteten, um den harten, dürren Boden aufzuweichen, damit sie ihn
bestellen konnten.
Am meisten zog mich der Tempelplatz in Salt
Lake City an. Mir sagte die Atmosphäre dort sehr zu. Ich dachte nur,
hoffentlich gibt es das und diese freundlichen Menschen noch in tausend Jahren!
In der Vorfreude auf die Teilnahme am Organ
Recitals, das um die Mittagsstunde herum täglich im Tabernakel stattfindet,
hegte ich meine Gedanken. Ja, ich rief meine Moskauer Eindrücke wieder herauf.
Während des Konzertes verglich ich wieder einmal alles. Keine Frage wer das
Original hatte.
Wenn es doch möglich wäre, gute Musik in
überzeugende Worte zu übersetzen.
“Schade, Erika,” schrieb ich in mein Tagebuch: “dass Du es
nicht miterleben durftest.“ Plötzlich umströmte uns Zuhörer eine wunderbare
Tonflut. Schöne Akkorde rauschten auf uns zu. Es folgte ihnen ein behutsames
Streicheln und Zufriedenstellen der Seele nur durch Töne. Präludium und Fuge in
G-Dur von Johann Sebastian Bach. Ihr folgte Henri Mulets Toccata in F-Moll,
dann noch einmal Bach: “Christus lag in den Banden des Todes”. „Dreißig
Minuten lang hörst Du inmitten der Felsengebirge des wilden amerikanischen
Westens himmlische Musik. Du fragst Dich, wie es möglich ist, dass Du Mensch,
der du unausgesetzt und oft mit gewaltigem Aufwand nach mehr Glück trachtet,
das Schöne und Gute so billig bekommen kannst.
Wir strömten ins Grüne, der Himmel strahlte
im tiefen Blau, die Sonne schien. Es ist nur schwer vorstellbar, dass es
Menschen gibt, die andere Menschen hassen.”
Am nächsten Morgen stand mein
Exneubrandenburger Siegfried mit seinem Land Rover vor Walters Tür im Schnee,
der in der Nacht auf die gelbleuchtenden Forsythien Sträucher gefallen ist. Er
will mit mir nach Brighton gehen, auf die Skifahrerpiste für Anfänger. Als Kind
hatte ich schon einmal, in Wolgast, auf primitiven Brettern gestanden und
natürlich war ich Wintertags noch nie im Gebirge gewesen. “Das macht
nichts”, ermutigte Siegfried mich. “Wir borgen uns die richtige
Ausrüstung und Du wirst schon sehen, wenn uns der Lift hinaufgefahren hat, dann
rutscht Du wie von selbst ins Tal runter." Recht hatte er. Meine
glatten Untersätze fuhren, als es soweit war, von allein los und nahmen mich
mit. Ich brauchte bloß aufpassen, nicht umzukippen. Vorher allerdings hätte er
mir erklären müssen, wie man, wenn das Tempo zunimmt, wieder anhält. Plötzlich
sah ich nämlich eine Gruppe Kinder und Jugendlicher vor mir. Als ich dann
wieder auf meinen Beinen stand, übte ich für den Ernstfall. Denn beim nächsten
Mal bot sich wahrscheinlich nicht wieder eine Schneewehe als Gelegenheit an, da
kopfüber reinzusegeln.
Ich sah mich auch in den Gemeinden um. Mich
störten die auffallend vielen kleineren Kinder und die von ihnen verbreitete
Unruhe nicht. Das wird zu Christi Zeiten kaum anders gewesen sein. Wenn er
sprach, wird er die Mütter nicht angefahren haben, dass sie ihre Kleinen
gefälligst stumm zu stellen hätten. Im Gegenteil! Wie Matthäus so anschaulich
mitteilt, winkte er die Kinder zu sich heran. Drei Tage vor Beginn der
Konferenz zog ich ins Hotel Utah um, das lag näher an den Tagungsstätten. In
einer vom Präsidenten des Rates der Zwölf, Ezra Taft Benson, geleiteten
Schulung für Regionalrepräsentanten der Kirche, an der Henry Burkhardt, mein
Missionspräsident und ich als Gäste teilnahmen, erfuhren wir, dass Erhebungen
ergeben hätten, dass die Belastungen für aktive Mormonenfamilien bis fünfzig
Prozent ihres Budgets betragen würden. Das sei nicht in Ordnung. Das Gesetz der
Kirche laute: zehn Prozent, nicht mehr. Einmal im Monat sollten die Mitglieder
der Kirche fasten und den Gegenwert des Ersparten zum Zweck der Linderung von
Not über den Zehnten hinaus opfern. Außerdem würden sie ihre Kinder weiterhin
auf eigene Kosten “auf Mission” schicken. Das sei mehr als genug, sie dürften
fortan nicht mehr aufgefordert werden, sich an der Bildung anderer Fonds zu
beteiligen. Ab sofort übernehme die Kirche die volle Finanzierung für den
Neubau von Kapellen und der Sporteinrichtungen, sowie deren Unterhaltung. Links
neben mir saß Dieter Berndt, er ist an der TU in Berlin Lehrer, ein Fachmann
für Verpackungstechnik, rechts der Bürgermeister von Las Vegas.
Wir gingen vom Kirchenverwaltungsgebäude zu
Tisch ins Löwenhaus, in dem einst Brigham Young mit seiner Großfamilie gewohnt
hatte. Deshalb die ungewöhnliche Anzahl Fenster und die vielen Zimmer. Mit
einem Philippini, der in Köln Wirtschaft studiert hatte, kam ich ins Gespräch.
Es sei weltweit dasselbe, wer zu dieser Kirche gehöre, der engagiere sich voll
und ganz - oder gar nicht. Es gäbe etwa fünfzig Prozent heiße und fünfzig
Prozent kalte Mormonen. Halbherzigkeit sei fast nie anzutreffen. Wer komme
mache richtig mit. Die andere Hälfte Mormonen stehe leider nur in den Büchern.
Anderntags befanden wir uns im bescheidenen
Büro Präsident Monsons. Als er uns hereinkommen sah, erhob er sich zur fast
Zweimeterturmhöhe, kam hinter seinem Schreibtisch hervor, reichte uns, Henry
Burkhardt und mir die Hand. Schon nach wenigen Worten fragte er, welchen Wunsch
ich hätte. Ich war überrascht. Ich war doch nicht als Bittsteller hergekommen,
sondern freute mich, dass er sich für uns eine halbe Stunde Zeit genommen
hatte.
Mein Blick fiel auf die Totenmaske des
Propheten Joseph Smith, die im Fensterrahmen stand. Wie elektrisiert sah ich
das erstarrte, junge und bartlos glatte Gesicht eines der bedeutendsten Männer
der letzten zweihundert Jahre zu meiner Rechten. Unwillkürlich fragte ich mich,
warum halten dich so viele für einen Lügner?
Es gibt keine dritte Möglichkeit! Entweder
hatte er und weitere elf die golden aussehenden Platten in Händen gehalten oder
nicht. Entweder logen die zwölf Männer oder sie hatten die Wahrheit in
wichtigster Hinsicht gesagt. Dann ist dieses Leben nicht alles.
Mir fiel ein, ich könnte Thomas S. Monson
bitten, der Einladung nachzukommen, die Hermann Kant, der Präsident des
Schriftstellerverbandes der DDR, erst vor kurzem an ihn ausgesprochen hatte,
nachdem er in Salt Lake City als willkommener Gast an einer Tagung der
Generalkonferenz teilgenommen hatte. Unser Gastgeber, dessen Herz für die in
Altenheimen lebenden Witwen schlägt, nickte zustimmend. Er rief seine
Sekretärin herein. Einen Augenblick lang erschien mir alles unwirklich zu sein.
Henry Burkhardt und ich gehörten hier nicht her. Wir sind ein Stück
Nicht-normalität. Immerhin erhebt der östliche Moloch auf uns
Besitzeransprüche. Wir gehören denen, die immer sagten “Unsere Menschen”.
Sie haben uns erlaubt, hierher zu reisen. Sie hätten die Macht gehabt, es uns
zu untersagen. Irgendwie äußerte ich das, denn ich dachte an Erika. Thomas S.
Monson schüttelte abwehrend den Kopf. So verbissen sollte ich es nicht sehen.
Die Kirche arbeite daran, dass unsere Bedingungen sich bessern sollen. Ich
konnte es nicht glauben, und ahnte nicht im Mindesten, wie weit diese Arbeit
bereits gediehen war.
Während des Rückfluges erfuhr ich von Henry
Burkhardt, dass in Freiberg in der DDR ein Tempel gebaut werden soll. Das sagte
er mir, mitten über dem Atlantik. Es sei eine noch vertrauliche Information. Er
hatte mich geweckt, um mir den unglaublich gefärbten Himmel zu zeigen. Es war
ein paar Minuten vor Sonnenaufgang. Aus einem tiefviolett schimmernden Himmel
kam makellos von links vorn die schnell wachsende Helligkeit wie ein
Bühnenlicht hervor, denn wir flogen der Sonne mit zehnfacher Autogeschwindigkeit
entgegen. Seine Mitteilung war in der Tat eine große, wunderbare Überraschung.
Das widersprach all meinen Erfahrungen. Danach war an Schlaf nicht mehr zu
denken. Das hieß, die Vorgespräche zwischen amerikanischen Kirchenautoritäten
und der kommunistischen Honneckerregierung konnten nur positiv verlaufen sein.
Mein erster Gedanke war: Honecker und Günter Mittag brauchen Geld. Mein
zweiter: wegen fünf oder acht Millionen Dollar setzen die sich doch keine Laus
in den Pelz! Meine Logik geriet ins Wanken.
Bald darauf, während einer Konferenz in
Leipzig, vernahmen wir es als offizielle Ankündigung. Meine Verwunderung blieb
groß. Ich hätte eher gewettet, dass die Kommunisten versuchen würden, den
Einfluss meiner “amerikanischen” Kirche zurückzudrängen.
Warum sie es zuließen, sollte ich noch
erfahren.
In Utah hatte ich ein Stück vom neuen,
besseren Land gesehen, das noch längst nicht perfekt war, jedoch die Potenzen
zur besten Entwicklung in sich trug. Allerdings, und das hörte ich
verschiedentlich, Utah ist nicht Amerika. Die Slums der Industriestädte, das
dazu gehörige Elend gibt es hier nicht - hoffentlich wird es sie wenigstens im
Einflussbereich meiner Kirche nie geben! Anderes wäre mir undenkbar. Natürlich
müssen wir aufpassen. Wo immer ein hohes Niveau durch Fleiß und Wertschätzung
erreicht wurde, muss es durch dieselben Tugenden pausenlos verteidigt werden.
Es ist keine Zeit sich auf alte Verdienste zurückzuziehen. Nichts bleibt, wie
es ist, selbst die Liebe nicht, es sei denn wir erneuern und erhalten sie immer
wieder. (Nicht einmal bergab läuft jede Karre von allein.)
Einmal hatte ich mich mit dem Auto verfahren
und war ins Mormonenstädtchen Orem abgebogen. Da wusste ich noch nicht, dass
dieser Ort ein oder zweimal offiziell als liebenswerteste Stadt Amerikas
ausgezeichnet wurde.
Allerdings, wer in dieses
Blumenstraßenparadies hineingeboren wird und niemals etwas wie das Leipzig der
achtziger Jahre hautnah erlebt hatte, oder Bautzen, der konnte es
wahrscheinlich nicht sonderlich schätzen. Das wird wohl das ewige Problem
bleiben, dass niemand von uns wirklich weiß, was er besaß, bevor er es verlor. Das
meinte wahrscheinlich Hartmut, unser ältester Sohn, als er mir eines Tages
sagte: nach seinem Abitur hätte er sich sieben lange Jahre, außerhalb der
elterlichen Obhut, fremde Ideen um die Ohren pfeifen lassen. Jetzt erst wüsste
er, wie wertvoll sein Zuhause gewesen war und wie viel es ihm bedeutete zu
wissen, dass sein Hinterland - seine Familie – fest zu ihm hielt. Erst diente
er drei Jahre um seinen Studienplatz in der Armee, dann studierte er im
damaligen Karl-Marx-Stadt Maschinenbau und Schweißtechnik. Fast gegen Ende der
“elternlosen” Zeit (ich werde es nie vergessen, es war auf dem Weg zwischen
Freienhufen und Dresden) fragte ich ihn: “Na Hartmut, was hältst du nun von
unserer gemeinsamen Kirche?”
“Es ist das Beste, das wir haben können.” sagte er. Eine Antwort, die mich tief
bewegte und befriedigte. Sofort nach Abschluss der Fachprüfungen hätte er den
Ordner mit der Überschrift “Wissenschaftlicher Kommunismus”, weil absolut
unbrauchbar, in den Müllcontainer geworfen. Ich hatte bis dahin meine Sorgen
und Bedenken gehabt, da ich davon überzeugt war, dass er den Druck der
verschiedenen Versuchungen ähnlich wie ich gespürt haben musste. Auch er hatte,
wie ich, sein eigenes Zeugnis von der Echtheit und Lebendigkeit des Mormonismus
empfangen und, wie ich, hatte er den Wunsch, einer so wunderbaren Sache zu
dienen, die alle Voraussetzungen dazu mitbringt, die unterschiedlichsten
Menschen zu einer großen harmonischen Familie zusammenzubringen. Eine Aufgabe,
die zu lösen sich die Kommunisten vorgenommen, aber nie würden zu Ende
ausführen können, weil ihre Losung “Proletarier aller Länder vereinigt euch”
zumindest einen bedeutenden Teil Mitmenschen zu Todfeinden erklärte. Wir aber
hörten in unseren Zusammenkünften immer wieder, dass alle Menschen Kinder
Gottes sind. Deshalb war und ist jedes Engagement, auch das politische, heilig
oder unheilig, je nachdem ob wir in erster Linie nur uns selbst dienen.
Im Herbst 1983, ein Jahr nach meiner
Entlassung als Distriktpräsident wurden Klaus Nikol und ich als Pfahlmissionare
berufen. Nachdem ich ihn angesprochen hatte, lud Pastor Fritz Rabe uns ein, vor
seiner Jugendgruppe der Gemeinde St. Michael, in Neubrandenburg einen
Lichtbildervortrag über meine Amerikareise nach Utah zu halten.
Der Abend begann damit, dass Herr Rabe - wie
ich später erfuhr - ein Zirkular seiner Synode zur Hand nahm, das er
anscheinend soeben erhalten hatte, wodurch sich die offizielle Eröffnung um
einige Minuten verschob. In dem Schreiben wurde ihm mitgeteilt, dass Kontakte
zu Mormonen nicht gepflegt werden sollten. Ich saß nahe bei ihm und fand eine
gewisse Bewegung in seinen Zügen, konnte aber nicht ahnen, dass es Klaus Nikol
und mich betraf.
Eigentlich hätte er uns, gemäß der
empfangenen Weisung, sofort des Saales verweisen müssen. Aber wir durften
reden. Das war sein Wagnis. Immerhin standen wir namentlich für eine
gefährliche Sekte. Er nahm es mutig auf sich. Er ließ sich mehr von seinem eigenen
Gefühl leiten, als von einer Direktive. Wir zeigten als erstes Bild den
Mormonentabernakelchor. Er sang für uns Luthers berühmtes Lied “Ein feste Burg
ist unser Gott”.
Herr Pastor Rabe sah bald ein, dass wir keine
Sektierer waren.
Auf die Frage, wodurch wir uns von anderen
Christen unterscheiden, zitierte Klaus Nikol Joseph Smith, und ich setzte im
Wortlaut hinzu: “In den religiösen Ansichten sind wir von anderen Kirchen
nicht so sehr verschieden, dass wir nicht ein und dieselbe Liebe in uns
aufsaugen könnten. Einer der großen Leitsätze des Mormonismus ist der, dass wir
die Wahrheit annehmen, mag sie kommen, woher sie will. Die Christen sollen
aufhören, miteinander zu zanken und zu streiten, sie sollten vielmehr
untereinander Einigkeit und Freundschaft pflegen.”
“Ist das tatsächlich Originalton Joseph
Smith?” wollte Pastor
Rabe wissen. “Ja! Wort für Wort.” Das konnte ich bestätigen.
Anschließend kam es zu einer heftigen Diskussion. Zwei angehende Diakone
schimpften lautstark das Buch Mormon sei ein Lügenbuch. “Es ist Unrecht
irgendein Buch neben die Bibel zu stellen.” Als angeblich letzter Autor des
Buches der Bücher hätte Johannes der Offenbarer verboten, diesem gewaltigen
Werk noch ein Wort hinzuzufügen.
Welch ein Missverständnis! Ich nahm meine Bibel und zeigte sie den jungen Leuten. “Wie
viel davon akzeptieren gläubige Juden?” Sie schauten verdutzt herüber. Einer der beiden Diakone antwortete richtig: “Sie anerkennen
nur das Alte Testament als Heilige Schrift.”
“Also ist das Neue Testament in jüdischen
Augen eine unzulässige Erweiterung der Sammlung! Bedeutet dieser jüdisch
bestimmte Standpunkt, dass er haltbar ist?”
Pastor Rabe ließ uns gewähren, obwohl er sich
nicht sehr wohl fühlte, denn er ahnte, dass wir noch mehr strittige Tatsachen
in den Raum stellen würden. Auch ihm war klar, dass das Neue Testament nicht
chronologisch angeordnet ist. Deshalb nickte er nachdenklich, als wir die
entsprechende Frage stellten. Den beiden Diakonen war es unbequem, zu denken
wie wir. Mit heftigen Äußerungen zeigten sie, dass sie davon ausgingen, dass
Joseph Smith ein Betrüger war.
Wir entgegneten: „Selbstverständlich muss
die Frage nach der Wahrhaftigkeit irgendeiner Behauptung immer zugelassen
werden. Und insofern muss man herausfinden ob das Buch Mormon ein
Fantasieprodukt Joseph Smiths ist oder nicht.” Aber, wenn man sich schon
vor der Prüfung eines vergleichbaren Problems negativ entscheidet, dann zieht
die Vernunft den Kürzeren. Kaum hatten wir diese Erwiderung formuliert, tosten
sie wieder los.
Erst als sich der Pastor erneut einschaltete,
dämpften die beiden angriffslustigen jungen Männer ihren Ton. Er verabschiedete
uns freundlich. Es war ihm peinlich, dass die beiden Hitzköpfe so grob
argumentiert hatten.
Überraschend besuchten die beiden Angreifer
mich noch am selben Abend. Sie entschuldigten sich. Im folgenden Gespräch
bekannten sie von sich aus, dass es ihnen zu anstrengend wäre, wie die Mormonen
zu leben. Deshalb hätten sie dagegengesprochen. Ihre Befürchtung war die, dass
wir ihnen ihre Lebensfreude stehlen wollten, nämlich das Vergnügen mit leichtfertigen
Mädchen…
Diese Offenheit verblüffte mich. Ich
erwiderte, niemand will oder darf sie nötigen, jemals etwas zu akzeptieren, was
sie nicht mögen. Bedauerlicherweise kannte ich damals noch nicht den Wortlaut
der Aussagen des berühmten amerikanischen Baptistenpredigers Martin Luther
King, die unbeabsichtigt mit dem Tenor des Buches Mormon übereinstimmten.
Wahrscheinlich hätte es ihnen geholfen zu begreifen, dass es nicht um
irgendeinen Grad von Religionseifer geht, sondern um Grundwahrheiten. Martin
Luther King hatte es auf seine Weise gesagt: „Gott hat absolute moralische
Gesetze in sein Weltall eingebaut. Wir können sie nicht ändern. Wenn wir sie
übertreten, werden sie uns zerbrechen.” Diese auf drei Sätze komprimierte
Philosophie entsprach der kompletten Morallehre des Mormonismus.
Wenig später traf ich Pastor Rabe auf der
Straße wieder. Wir gingen ein paar Schritte gemeinsam. Er sagte ungefähr:
„Wenn ich Sie beide nicht persönlich näher kennen gelernt hätte und ebenso Ihre
Glaubenssätze, wäre ich wie alle anderen (Pastoren) derselben Überzeugung
geblieben, dass Mormonen nicht ungefährliche Fanatiker sind.”
Da ahnten wir beide noch nicht, dass ihm sein
Wohlverhalten mir gegenüber noch viel Ärger einbringen sollte…
Im Sommer 1985 war es soweit
Der erste Mormonentempel auf deutschem Boden
wurde der Öffentlichkeit präsentiert. Die DDR-Politiker hatten die Resultate
gesehen. Das jedenfalls führte der stellvertretende Staatssekretär für
Kirchenfragen Herr Kalb anlässlich der Einweihungsfeierlichkeiten des
Freibergtempels deutlich aus: “Wir haben gesehen, dass Mormonen nicht in
Eigentumsdelikte verwickelt waren, es gab fast nie Ehescheidungen bei Ihnen.
Ihre jungen Männer tranken während ihrer Armeezeit nie Alkohol, das allein war
für uns sehr erstaunlich. Das sind Menschen, die wir hervorzubringen wünschten.
Die Früchte waren gut.”
Vierzehn Tage offenes Haus. Viele Mitglieder
stellten sich zu Verfügung, um die Tausende, die kommen würden, in Empfang zu nehmen
und ihre Fragen zu beantworten. Auch ich hatte für diesen Zweck eine Woche
Urlaub eingeplant.
Eine Stunde vor Öffnung des Geländes sagte
Holger Bellmann, der für diesen Teil der Startphase verantwortliche Kirchenmann
(ein Uhrmacher), zu mir: “Gerd, sei so gut, schließe das große Tor auf.”
Ich nahm den Schlüssel, ging aus dem Gemeindehaus am weißleuchtenden Tempel
vorbei und sah erstaunt, dass sich im Verlaufe der zwei Stunden unserer
internen Vorbereitung die Menschenmenge von zwanzig bis auf mehrere Hundert
vergrößert hatte. Zwei junge Frauen, beide mit dunklen Augen, die vornan
standen, schauten mich offen ausforschend an. Ich verstand ihre Blicke als
berechtigte Neugierde: Wer seid ihr? Was ist das hier? Was werdet ihr uns
zeigen und sagen? Glaubt ihr wirklich daran? Seid ihr echt? Was ist das für ein
Ding, das mit Erlaubnis der Partei hier hingestellt wurde? Seid ihr
sozialistische Christen? Will die SED etwa umschwenken? Will Honecker damit die
anderen Christen ärgern? Wie viel hat es euch gekostet? Dass dieses schöne Haus
hier, wie ein Blickfang, auf einem Hügel steht, ist total unverständlich.
Vierzehn Tage lang ging das so, täglich
länger als zehn Stunden. Immer wieder stellten die Besucher diese Fragen,
zuckten mit den Achseln, bewunderten das ebenso schlichte wie schöne
Gesamtbild. Fast einhunderttausend Menschen sollten zu uns kommen, jeder noch
mit seinen persönlichen Anmerkungen, auf die wir eingingen soweit uns das
möglich war. Wir versuchten uns im Geist führen zu lassen. Es ging uns
selbstverständlich darum, jedem präzise und kurz zu antworten. Wir fassten sie
in Gruppen zu fünfzig zusammen. Manchmal befand ich mich aber auch mit
einhundert oder mehr Gästen in der Kapelle. Jeder unserer Sprecher spürte, wie
die Blicke der Besucher in sie drangen. Es war diese eine Grundanfrage an uns:
Könnte es sein, dass ihr nicht lügt? Es hatte schon viele bunt schillernde
Seifenblasen gegeben. Ausgerechnet eine amerikanische Kirche baut hier eine
Festung? Das verstehe wer will. Die meisten Menschen, die sich positiv
äußerten, befanden, dass sie modernere, religiös motivierte Ansichten als
unsere noch nie gehört hatten. Allerdings war, was sie vorfanden, eigentlich
nicht modern. Alles, was wir lehrten, war uralt. Schon vor mehr als zweitausend
Jahren hatte Benjamin im Buch Mormon gesagt: dass kein Mensch denken soll,
er sei mehr als ein anderer, Mosia 23,7 - dass niemand bleiben kann, wie er
ist, sondern sich zum Guten entwickeln muss, - oder es war die alte Weisheit,
dass niemand in Unwissenheit selig werden kann.
Oft ließ ich sie aus bereitliegenden Bücher
Mormon vorlesen.
Uns
war klar, wer hier her kam hatte schon von der Existenz der Mormonen gehört,
nichts Gutes allerdings, sondern überwiegend Abstoßendes. Evangelische
Geistliche sprachen fast ausschließlich Schlechtes von Dingen die sie nicht
kannten. Viele Würdenträger empfanden
uns nur als negative Konkurrenz, als tendiere bereits zu jener Zeit das
Interesse für den Glauben den ihre Eltern noch hoch hielten gegen null.
Tatsächlich
konnten sich Gottesdienstbesucher evangelischer Richtung nur noch der immer
schönen Orgelmusik erfreuen. Die Wort-Botschaften selbst wurden immer magerer.
Es reicht eben nicht aus den Menschen zu sagen: Du kannst zu deiner Erlösung
nicht beitragen. Sola gratia! Nur Gottes Gnade darfst du erhoffen.
„Mormonismus“ hingegen stellt klar heraus, dass wir selbst durch unser Tun und
Lassen entscheiden ob wir dies- und jenseits mehr Freude erfahren werden.
Ein
Geistlicher, am Bäffchen erkennbar sagte mir ins Gesicht: „Hätte ich eine
kleine Bombe, ich würde sie hier am Tempel hinlegen.“
Kurz darauf kam ein rötlichblonder Student,
der ebenfalls Gäste mit sich gebracht hatte. Heftig mit den Armen rudernd und
laut redete auf seine Gruppe ein: “Mormonen sind die Pest! Sie haben den
Uteindianern das Land Utah geraubt. In Kriegen haben sie gemordet und alles
verbrämt mit ihrer Heuchelei.”
Ich sah das zornige Funkeln in den grünen
Augen dieses weit über die geschichtlichen Tatsachen hinausschießenden
Gerechtigkeitsfanatikers und sprach den Mann an. Er fuhr mir über den Mund. Ob
das etwa nicht stimme. Ich erwiderte: “Es hat vielleicht brunnenvergiftende
Juden gegeben, aber man kann doch nicht sagen, die Juden waren
Brunnenvergifter. So nicht. Es hat Mormonen gegeben, die zur Flinte gegriffen
und aus welchen Gründen auch immer, Indianer erschossen und sogar schweres Unrecht
begangen haben. Sie sind von der Kirche ausgeschlossen worden. Ich weiß nicht
wie ich gehandelt hätte, wäre meine sonst unbeschützte Familie angegriffen
worden. ”
Er starrte mich hassvoll an und wies mich
zurecht. Er wüsste davon mehr als ich und zog seine Leute mit sich. Sie
beachteten mich nicht. Sie verschwanden in der Menge Menschen, die uns umgaben
und von denen wir uns lediglich durch das Namensschild am Revers unterschieden.
Wir erlebten es immer wieder, dass sich uns
unbekannte Besucher in größerem Rahmen als Erklärer versuchten. Ein Busfahrer,
der zum dritten oder vierten Mal da war, “erklärte” seinen Fahrgästen Haarsträubendes
über uns.
Am Tag
darauf, spät am Abend, als der Besucherstrom erheblich nachgelassen hatte, kam
Dietmar Hirsch, ein etwa dreißigjähriger Zwickauer, auf mich zu und erzählte
mir, dass er Zeuge einer Diskussion zwischen einem Geistlichen und einem uns
freundlich gesonnenen SED-Mann geworden war. Vor dem Taufbecken habe sich ein
Streitgespräch entwickelt. Der Theologe meinte, das sei antiquiert, so hätten
die Christen in den ersten Jahrhunderten getauft. Nur die ältesten italienischen
Basiliken und Baptisterien wie San Giovanni in Fonte in Neapel oder das
Baptisterium in Ravenna wiesen noch solche Becken auf. Dort seien tatsächlich
die Taufen durch Untertauchen des Täuflings vorgenommen worden, aber mit dem
Aufhören der Erwachsenentaufe hätte man später auf den Bau von Baptisterien
verzichtet. Dietmar Hirsch konnte und wollte nicht verstehen, wie eine durch
Christus bestätigte oder von ihm eingesetzte Verordnung je unmodern werden
könnte. Der Theologe entrüstete sich. Da schaltete sich unerwartet ein Mann mit
dem SED-Abzeichen ein: “Herr Pastor, ich bin kein Mormone und will auch
keiner werden, und sie mögen glauben und denken, was sie wollen, aber wenn
etwas überaltert ist, dann ist es ihre evangelische Kirche. Sie hatten mehr als
vierhundert Jahre lang die Gelegenheit, die Welt zu verändern. Die katholische
Kirche hatte dazu fast zweitausend Jahre Zeit gehabt. Was haben sie nach vorne
bewegt? Sehen sie sich dagegen Geschichte und Organisation der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage an. Sachlich gesehen, ist den Großkirchen
allein aufgrund der vergleichsweisen schwach ausgebildeten und zudem erstarrten
Strukturen nicht zuzutrauen, dass sie den kommenden Herausforderungen, die der
Fortschritt eben mit sich bringt, gewachsen sein werden. Sie werden es erleben.
Was zu Martin Luthers Zeiten angemessen und ausreichend war, ist heute
unpassend. Die Mormonenkirche dagegen ist perfekt gegliedert und auf Mitarbeit
sozusagen sämtlicher ihr angehörenden Menschen zugeschnitten, und was noch
wichtiger ist, sie hat die dazu passende Lehre, - eine Soziallehre von Rang.”
Ihm sei klar, vorausgesetzt es gibt einen Gott, dass Mormonismus die Religion
der Zukunft sein wird.
Daraufhin habe sein nun völlig verärgerter
Gesprächspartner spitz zurückgefragt, woher er das wisse. “Das will ich
Ihnen gern sagen, mein Herr. Als die Entscheidung darüber anstand, ob das
Zentralkomitee der SED der Errichtung eines solchen Gemeindezentrums zustimmen
sollte oder nicht, habe ich im Auftrage der Regierung der DDR meine
Diplomarbeit über Lehre und Organisation dieser Kirche geschrieben.”
Damit endete das Gespräch. Der Unterschied
zwischen beiden Männern bestand darin, dass nur einer urteilsfähig war.
Nach sechs Stunden pausenlosen Sprechens
fühlte ich mich regelmäßig ausgelaugt. Mein Freund Wolfgang Zwirner aus
Dresden, ein Unibliothekar, war in der Lage, zehn Stunden zu reden. Die
häufigst gestellte Frage lautete: Was unterscheidet Ihre Kirche von den
anderen? Wie kann man darauf in drei Sätzen antworten? Ich sagte es immer
wieder: “Wir sind einhundertprozentig eine Laienkirche! Und: Wenn wir denn
überhaupt ein Symbol haben, ist es nicht das Kreuz, sondern der Bienenkorb!”
An einem Sonnentag, wenige Monate nach der
Zeit des “Offenen Hauses”, sah ich einen gut angezogenen, nachdenklich vor sich
hin sinnenden Mann auf dem Freiberger Tempelplatz. Er saß auf einer der
verstreut aufgestellten Bänke im Grünen. Ich ging auf ihn zu, grüßte ihn.
![]() Er mochte um die Fünfzig gewesen sein. Er
schaute mich sonderbar an und blickte auf meine Trippel-kombination: Buch
Mormon, Lehre und Bündnisse, Köstliche Perle, unsere Zusatzschriften
kanonischen Charakters. Ich spürte die
Ablehnung, hatte aber das Gefühl, dass ich ihn ansprechen sollte, ob er eine
Frage hätte. Kühl und entschieden erwiderte er: “Nein!” Er schaute mich
nochmals an: “Alles, was ich zu Ihrem Thema zu fragen hatte, ist bereits
beantwortet worden.” Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Was sollte
ich machen? Er wünschte, nicht behelligt zu werden. Es störte mich nur, dass da
ein Mensch war, der unbefriedigt und mit den von mir vermuteten Vorurteilen
weggehen würde. Doch ich hatte kein Mittel. Nach einer knappen halben Stunde, als ich
zurückkam, saß der Mann immer noch da. Ich nahm allen Mut zusammen, entschuldigte
mich und bat ihn, mir nicht übel zu nehmen, dass ich ihn nochmals anzusprechen
wage. „Ich habe ihnen doch gesagt, dass ich bestens informiert bin.” Mir
war klar, dass er nicht aus der Quelle getrunken haben konnte. Ich wandte mich
ab und ging davon. Nach einigen Minuten wagte ich einen dritten Versuch
und bat ihn, mir zu erlauben, ihm drei Sätze aus den Offenbarungsbüchern des
Propheten Joseph Smith vorzulesen. Etwas gequält erwiderte der
Nachdenkliche: „Aber bitte nur drei Sätze.” Ich schlug Lehre und
Bündnisse auf, Abschnitt 88, Vers 67: “Wenn euer Auge nur auf die
Herrlichkeit Gottesausgerichtet ist, so wird euer ganzer Körper mit Licht
erfüllt werden und es wird in euch keine Finsternis sein; und wer ganz
mit Licht erfüllt ist, begreift alle Dinge. Darum heiligt euch, damit euer Sinn
nur auf Gott gerichtet ist, dann werden die Tage kommen da ihr ihn sehen werdet
...” … „Noch einmal bitte!” Verdutzt schaute er weit an mir vorbei.
Ich las es noch einmal. Er verbarg seine Überraschung nicht. Nun
wirklich interessiert forderte er: “Den anderen Vers, bitte.” … „Lasst
niemanden euer Lehrer oder geistlicher Diener sein, außer es sei ein Mann
Gottes, der auf seinen Pfaden wandelt und seine Gebote hält.”… „Aus welchem
Buch haben Sie nun vorgelesen?”… „Aus dem Buch Mormon Mosia 23 Vers 14.”
Er erhob sich, schaute mir eine Weile ins Gesicht. Wenn ich darin richtig
las, dann teilte er mir wortlos mit: Das ist ja unglaublich. In der Tat,
das damit vorgetragene Prinzip war revolutionär. Alle Kirchen sähen besser aus,
sie würden sich zu Vergleichbarem bekennen. Er forschte mich nun ungeniert aus,
aber es war mir nicht unangenehm. Wahrscheinlich fragte er sich, wer ich sein
mochte. Ich bemerkte, dass sein Blick
sich wieder meinem schwarzen Ledereinband zuwandte, während ich Teil drei
zitierte „Die Rechte des Priestertums sind untrennbar mit den Himmelskräften
verbunden und können nur nach den Grundsätzen der Rechtschaffenheit beherrscht
und gebraucht werden….doch wenn wir versuchen unsere Sünden zu verdecken oder
unseren Stolz und eitlen Ehrgeiz zu befriedigen, oder wenn wir auch nur im
geringsten Maß von Unrecht irgendwelche Gewalt, Herrschaft oder Nötigung auf
die Seele der Menschenkinder ausüben – siehe dann ziehen sich die Himmel
zurück, der Geist des Herrn ist betrübt, und wenn er weggenommen wird, dann ist
es mit dem Priestertum oder der Vollmacht des Betreffenden zu Ende.” Er
nahm mir meine Kombination mit einem Ruck weg, und las es selbst. Sein
Kopf kam wieder hoch. Er dachte eine Weile nach. Tief durchatmend
schloss der aufmerksame Besucher mit der Bemerkung: „Ich werde mich von
meiner Informationsquelle abwenden!” Das klang wie das Zerreißen von festem
Papier. „Tun Sie das, mein Herr. Ich danke ihnen, dass Sie mir zugehört
haben.” … „Ich danke Ihnen!” Leider habe ich nie wieder von ihm gehört.
Aber dieser Tag kommt noch…und sei es in der Ewigkeit. Das Letzte was er sagte:
Er sei Hochschullehrer in Kölln.
Er mochte um die Fünfzig gewesen sein. Er
schaute mich sonderbar an und blickte auf meine Trippel-kombination: Buch
Mormon, Lehre und Bündnisse, Köstliche Perle, unsere Zusatzschriften
kanonischen Charakters. Ich spürte die
Ablehnung, hatte aber das Gefühl, dass ich ihn ansprechen sollte, ob er eine
Frage hätte. Kühl und entschieden erwiderte er: “Nein!” Er schaute mich
nochmals an: “Alles, was ich zu Ihrem Thema zu fragen hatte, ist bereits
beantwortet worden.” Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Was sollte
ich machen? Er wünschte, nicht behelligt zu werden. Es störte mich nur, dass da
ein Mensch war, der unbefriedigt und mit den von mir vermuteten Vorurteilen
weggehen würde. Doch ich hatte kein Mittel. Nach einer knappen halben Stunde, als ich
zurückkam, saß der Mann immer noch da. Ich nahm allen Mut zusammen, entschuldigte
mich und bat ihn, mir nicht übel zu nehmen, dass ich ihn nochmals anzusprechen
wage. „Ich habe ihnen doch gesagt, dass ich bestens informiert bin.” Mir
war klar, dass er nicht aus der Quelle getrunken haben konnte. Ich wandte mich
ab und ging davon. Nach einigen Minuten wagte ich einen dritten Versuch
und bat ihn, mir zu erlauben, ihm drei Sätze aus den Offenbarungsbüchern des
Propheten Joseph Smith vorzulesen. Etwas gequält erwiderte der
Nachdenkliche: „Aber bitte nur drei Sätze.” Ich schlug Lehre und
Bündnisse auf, Abschnitt 88, Vers 67: “Wenn euer Auge nur auf die
Herrlichkeit Gottesausgerichtet ist, so wird euer ganzer Körper mit Licht
erfüllt werden und es wird in euch keine Finsternis sein; und wer ganz
mit Licht erfüllt ist, begreift alle Dinge. Darum heiligt euch, damit euer Sinn
nur auf Gott gerichtet ist, dann werden die Tage kommen da ihr ihn sehen werdet
...” … „Noch einmal bitte!” Verdutzt schaute er weit an mir vorbei.
Ich las es noch einmal. Er verbarg seine Überraschung nicht. Nun
wirklich interessiert forderte er: “Den anderen Vers, bitte.” … „Lasst
niemanden euer Lehrer oder geistlicher Diener sein, außer es sei ein Mann
Gottes, der auf seinen Pfaden wandelt und seine Gebote hält.”… „Aus welchem
Buch haben Sie nun vorgelesen?”… „Aus dem Buch Mormon Mosia 23 Vers 14.”
Er erhob sich, schaute mir eine Weile ins Gesicht. Wenn ich darin richtig
las, dann teilte er mir wortlos mit: Das ist ja unglaublich. In der Tat,
das damit vorgetragene Prinzip war revolutionär. Alle Kirchen sähen besser aus,
sie würden sich zu Vergleichbarem bekennen. Er forschte mich nun ungeniert aus,
aber es war mir nicht unangenehm. Wahrscheinlich fragte er sich, wer ich sein
mochte. Ich bemerkte, dass sein Blick
sich wieder meinem schwarzen Ledereinband zuwandte, während ich Teil drei
zitierte „Die Rechte des Priestertums sind untrennbar mit den Himmelskräften
verbunden und können nur nach den Grundsätzen der Rechtschaffenheit beherrscht
und gebraucht werden….doch wenn wir versuchen unsere Sünden zu verdecken oder
unseren Stolz und eitlen Ehrgeiz zu befriedigen, oder wenn wir auch nur im
geringsten Maß von Unrecht irgendwelche Gewalt, Herrschaft oder Nötigung auf
die Seele der Menschenkinder ausüben – siehe dann ziehen sich die Himmel
zurück, der Geist des Herrn ist betrübt, und wenn er weggenommen wird, dann ist
es mit dem Priestertum oder der Vollmacht des Betreffenden zu Ende.” Er
nahm mir meine Kombination mit einem Ruck weg, und las es selbst. Sein
Kopf kam wieder hoch. Er dachte eine Weile nach. Tief durchatmend
schloss der aufmerksame Besucher mit der Bemerkung: „Ich werde mich von
meiner Informationsquelle abwenden!” Das klang wie das Zerreißen von festem
Papier. „Tun Sie das, mein Herr. Ich danke ihnen, dass Sie mir zugehört
haben.” … „Ich danke Ihnen!” Leider habe ich nie wieder von ihm gehört.
Aber dieser Tag kommt noch…und sei es in der Ewigkeit. Das Letzte was er sagte:
Er sei Hochschullehrer in Kölln.
Erfahrungen von Wert
Im darauffolgenden Sommer zelteten die
Kampfschwimmer auf einer Halbinsel des Sees. Sie übten das spurlose Tauchen mit
speziellen Atemgeräten, denn ihr eventueller Kampfauftrag könnte eines Tages
lauten: In Kiel sind zwei Kreuzer der Bundeswehr zu versenken! So bemerkten wir
sie mitunter auch an windstillen Tagen nicht, bis sie unmittelbar neben uns
auftauchten. Einmal kamen vier, fünf Männer in ihren schwarzen Neoprenanzügen
hoch und umringten mich plötzlich, weil sie sich fast lautlos auf den Kutter,
der neben mir verankert worden war, hinaufgehievt hatten, um das Garneinholen
in der letzten, der interessantesten Phase der Zugnetzfischerei mitzuerleben.
Meine Partner im gegenüberliegenden Boot hatten sie eher als ich bemerkt. Einer
von ihnen, Hermann Witte, das Woldegker Original, sah sofort seine Gelegenheit
gekommen, einen seiner unangebrachten Witze zu reißen. Durch nichts anderes als
durch ihre Gegenwart dazu motiviert, forderte er mich auf, das Beten zum lieben
Gott nicht zu vergessen, wenn ich am nächsten Tag auf die nächste große Reise
ginge. Augenblicklich stand ich dadurch im Brennpunkt der Aufmerksamkeit. Der
Chef der Tauchertruppe, fiel aus allen Wolken und bis sofort an. „Sag bloß,
dass du glaubst und betest?” Ich wandte mich um und fragte ihn
augenzwinkernd, ob er etwa nicht glaube. Natürlich nicht.
„Natürlich doch! Du glaubst an Karl Marx, an
Wladimir Iljitsch Lenin.” Seine
Genossen lachten. Er stimmte mit einem konzilianten Lächeln und einem durch die
Zähne gezischten „teils, teils” zu. Aber er würde seine “Götter”
wenigstens nicht anbeten. „Weißt,
Du,” erwiderte ich, „ich
habe Männer erlebt, die auf Knien vor einer Schönheit lagen und unentwegt
bettelten erhört zu werden.”
Wieder lachten sie.
Das übliche Hin und Her kam auf. Da hoben sie
aber alle die Köpfe, als sie hörten ich sei Mormone. Nach der Errichtung des
Freiberger Tempels gab es in der DDR kaum noch Menschen, die mit diesem
exotisch anmutenden Begriff gar nichts anzufangen wussten. Zwar war keiner von
ihnen auf dem Gelände des der Öffentlichkeit zugänglichen Gebäudekomplexes
gewesen, doch sie waren einigermaßen im Bilde. Nun sollte ich nur noch schnell
antworten, was die Basis und was der Kern meines Glaubens ist. Die Begegnung
mit mir wäre, wenn ich schnell geantwortet hätte, für sie nur eine kleine
Episode unter vielen gewesen. Sie hätten es abgehakt wie einen Rechenvorgang.
Ich wollte nicht zulassen, abgehakt zu werden. Ich dachte, wenn ihr wüsstet,
wie ungeheuer breit der Strom Mormonismus ist, wie tief er geht. Ihr ahnt es
nicht. Aber ihr sollt ihn noch zu spüren bekommen, angenehm wie Wärme und
kraftvoll wie Wasser, das in einen trockenen Holzkeil eindringt, dessen
osmotische Kräfte imstande sind, Felsen zu zerreißen. Mit ihm ist es wie mit
dem Golfstrom, der weltverändernd durch den Atlantik fließt. Ich fragte den
Chef der Truppe, ob er der Meinung sei, ich könne ihm in fünf Minuten eine
ganze Weltanschauung unterbreiten. „Gut, morgen nehme ich mir zehn Minuten
Zeit, mehr brauchen wir wirklich nicht.”
Der nächste Morgen kam. Ich sah sie schon von
weitem, mit ihren schwarzen Schutzanzügen, auf dem “Rhäser Eck” stehen. Wir
halfen ihnen, die Geräte auf den Kutter zu laden und binnen Sekunden fand ich
mich wieder von lauter fröhlichen Gesichtern umringt, acht an der Zahl. Wir
standen auf den federnden Schweffbrettern, die als Abdeckung über den großen
Wasserkammern lagen. Wir sollten sie bis zur gut zwei Kilometer entfernten
Fischerinsel mitnehmen. Sie würden zurückschwimmen. Das waren knapp fünfzehn
Minuten, die sie mir gaben. Sie waren gespannt, wie ich auf die Argumente
eingehen würde, die mir ihr Chef blitzschnell um die Ohren schlagen würde. „Otschen
karascho!” hob Manfred an. „Wir haben schon die ersten Schritte erlernt,
den Menschen in vitro hervorzubringen, bald können wir noch mehr. Wo ist da
noch Platz für Gott?”
Mir fiel ein, ihn zu fragen, was der Mensch
denn dann sei, falls er noch ein paar Schritte weiter kommt und in der Retorte
aus anorganischer Materie Leben zu schaffen vermag. Er schaute mich verdutzt
an. Seine Freunde lachten schon, bloß er begriff es nicht. Ein kleinerer,
untersetzter Mann dolmetschte: „Manfred! die Frage des Fischers lautet: Gibt
es keinen Schöpfergott, weil es Schöpfergötter gibt?”
Manfred blieb an Bord, bei mir, während seine
Männer ins Wasser sprangen und unter der Wasseroberfläche, von ihrem kleinen
Kompass geleitet, in Richtung Zeltlager zurückschwammen.
Meine Kollegen hoben und entleerten in der
Zwischenzeit die Reusen auf der Lieps, während wir uns unterhielten. Ich
steuerte dabei zeitweise das Motorboot und machte mich nützlich. Manfred hatte
sich längst des schwarzen Taucheranzuges entledigt und saß in seiner Badehose,
mit einem Hemd bekleidet in der Sonne. „Nun erzähl mir mal, wie’s kam, dass
Du so quer zu uns stehst.” Für ihn sei interessant zu hören, wann und warum
ausgerechnet ich unter so vielen Normalen ausgeschert bin.
Als ich ihm Teile der Joseph-
Smith-Geschichte erzählte, wog er den Kopf. Er lachte aber nicht. Da war auch
nichts zu lachen. Auch wenn er nicht alles verstünde, was ich als glaubwürdig
angenommen hätte, er sagte, es sei ihm sonderbarerweise nicht unangenehm. Nur,
ich käme ihm vor wie ein Lindenbaum der mitten in einer Pappelallee dasteht.
Dann erzählte er von sich selber. Es gab in
seinem Leben nie einen Anlass außer der Reihe zu tanzen. Sein Kurs sei klar,
sein Lebensweg war bisher geradlinig verlaufen. Abitur, Studium der Medizin,
Mitglied der SED. Militärakademie. Ein Arbeiterkind. Natürlich, es hat alles
mit unserer Herkunft zu tun, gab ich zu: „Aber mir war es nicht
vorausbestimmt, den Ansichten meines Vaters folgen zu müssen. Wer hätte mich
hindern wollen, für immer den Kurs zu wechseln?”
Es sei eine lebenslängliche
Auseinandersetzung, ein nicht einfacher Prozess der Wahrheitsaneignung gewesen,
versuchte ich zu erklären. „Nachdem ich mich in meinem fünfzehnten
Lebensjahr mit zwei Fragen konfrontiert sah, bahnten mir die möglichen
Antworten ihren Weg wie von allein. Die erste Anfrage war an meine
nationalsozialistischen Vorgesetzten gerichtet und spätere an einige SED-Genossen.
Sie lautete: ‘warum habt Ihr versucht, zuerst Euch selbst und dann mich zu täuschen?’
Meine zweite Frage stellte sich mir aus der ersten: warum gerade die Menschen,
die mir bewiesen hatten, wie leicht sie sich täuschen ließen, so energisch
vertraten, dass Joseph Smith ein Lügner war.”
Seine mausgrauen Augen musterten mich,
während ich bemüht war herauszustellen, dass ich nie ein Sonderling sein
wollte: „Ich habe nichts anderes gesehen und gewünscht als Du, Manfred. Mit
der Einschränkung, dass ich Ursache hatte, anders als du nach Gott zu suchen
und ich habe nicht nur gesucht, sondern gefunden.”
Er brachte, wie das bei solchen Gesprächen
fast immer üblich war die Evolutionslehre ins Spiel. Ich hatte gerade “Das
Ur-Gen” von Nobelpreisträger M. Eigen gelesen: „Eigen spricht von der gezielten, der
‘gerichteten’ Evolution. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass
gerichtete Evolution etwas anderes ist als die Evolution schlechthin. Wer hat
sie denn ausgerichtet? Das ist doch die große Frage!”
„Glaubst du denn an die Evolutionslehre und an
Gott?”
„Ja, jedenfalls selbst Darin sagte: „Ich
habe niemals die Existenz Gottes verneint. Ich glaube, dass die
Entwicklungstheorie absolut versöhnlich ist mit dem Glauben an Gott.“ Hirtenbriefe
Bistum Bamberg
Wir sind Kinder Gottes und Kinder der Erde.
Nur wenn wir diese beiden einfachen Tatsachen zugleich im Auge haben, dann
minimieren sich die Widersprüche, die zwischen den unterschiedlichen
Grundaussagen bestehen. Die materiellen Körper von Pflanzen, Tieren und
Menschen entstanden schrittweise, im Rahmen der gottgewollten Evolution. (Und
vielleicht, vielleicht entstanden sie sogar mit unserer persönlichen Mithilfe,
unter der Anleitung des ewigen Gottes.) Sobald die menschlichen Körper dem
Vorbild entsprachen, begann die Kette der Inkarnation unserer Seele, - unseres
Geistes, - dieser Geist ist aber auf keinen Fall das Ergebnis von Evolution!”
„Aber wer kann das wirklich glauben?” rief er aus.
Ich räumte ein, trotz bester Anleitung und
Belehrung auch erst verhältnismäßig spät erkannt zu haben, dass Gott
ausschließlich per Gesetz arbeitet und dass sein Gesetz mit dem Naturgesetz
identisch ist.
„Dann wäre Deiner Meinung nach Evolution lediglich eine
Arbeitsmethode Gottes!” folgerte
er.
„Ja! - Aber vergiss bitte nicht, dass für
einen Mormonen gilt, dass der Mensch Geist ist! Und in der Präexistenz gab es
keinen Kampf ums Dasein. Es gibt unterschiedliche Definitionen für den Begriff
Mensch. Das hat schon eine Menge Verwirrung gestiftet. Für Dich, Manfred, gilt,
dass der Körper der Mensch ist, für uns Mormonen ist dieser Körper nur das
Haus, ein Zelt, eine Hütte, höchstens noch ein Tempel. Für uns ist 'der Mensch'
das Unsterbliche in ihm. Wir haben also eine Bezeichnung für den Inhalt, die ihr
Materialisten nur dem Gefäß gebt.”
Er war tolerant genug, mich gewähren zu
lassen und so fuhr ich fort. Ihn und mich fragte ich, ob wir denn alle
miteinander blind sind, solche technische Genauigkeit und Muster an Schönheit
und perfekten Handlungsweisen in jedem einzelnen der vielen hunderttausenden
Geschöpfe unterschiedlichster Art eher dem Zufall und nur den Prinzipien der
Auslese zuzuschreiben, als sie voller Ehrfurcht und Dankbarkeit einer planenden
Gottheit anzurechnen. „So viele Zufälle zusammengenommen gibt es nicht!”
Mit absoluter Präzision errichtet die Biene
aus dem Wachs, das ihr Körper nur bei fünfunddreißig Grad Celsius ausschwitzen
kann, ganze Zimmerfluchten. Jeder Bau- und Maschineningenieur würde erblassen,
wenn er ohne Hilfsmittel, dazu noch in der Nacht, vor einem ähnlichen
Unterfangen stünde. Mit der Mikrometerschraube kann man die Räume, die eine
x-beliebige Arbeiterin baut, prüfen und wird feststellen, dass nicht nur die
Sechsecke haargenau stimmen, sondern dass die Dicke jeder Zellwand der
Normalbiene dreiundsiebzig Tausendstelmillimeter beträgt, während die Wand
einer Drohnenzelle vierundneunzig Tausendstelmillimeter zu messen hat. Beide
mit einer Abweichung von maximal zwei Tausendstelmillimeter. „Das wurde
so festgelegt. Aber was für eine Glanzleistung ist es, solche Instinkthandlung
als höchst komplizierte Software im Hirn einer Biene zu installieren,
geschweige denn sie erst niederzuschreiben.”
Die großartige Häuserbauerin wird, nach dem
zwanzigsten Lebenstag Sammlerin. Vorher aber musste das Programm 'Bauen' ebenso
wie zuvor das Programm 'Pflegen' definitiv gelöscht und das neue aufgerufen
werden. Keine andere Biene hätte sie lehren können, was sie tun muss, wenn sie
eine reiche Nektarquelle findet, dass sie nach der Heimkehr im Stock genau so,
und nicht anders zu tanzen hat und wie sie den Rund- und Schwänzeltanz einer
anderen lesen und verstehen kann, um die Information: Ein Rapsfeld in
fünfhundert Meter Entfernung in fünfundvierzig Grad Abweichung von der
Sonnenrichtung horizontal rechts umzusetzen.
„Natürlich kann man den 'Programmierer' Gott hinwegdeuten und auf
millionenlange Entwicklungsjahre verweisen. Nur, meinen Kopf hat das ganze
schlaue Gerede nie überzeugen können. Selbstverständlich gab es vor
Jahrmillionen schon Foraminiferen und andere Wurzelfüßer als Vorstufen für
höhere Lebewesen, aber es gibt sie auch heute noch, auf den Punkt dieselben
Foraminiferen. Gott baut eben jedes Neue auf der Basis des Alten. So ist es
auch in seiner Philosophie.“
Alles Neue, wenn es siegreich sein will, kann
nur auf dem Grund der bewährten alten Wahrheit stehen. So hängt die ganze Welt
zusammen. Alles Leben ist untereinander verwandt. Es hat einen gemeinsamen
Vater.
„Meiner Meinung nach wäre es dennoch eine
Katastrophe, wenn wir auf wissenschaftlichem Weg Beweise für die Existenz eines
allmächtigen Schöpfers fänden!”
Er schüttelte sich plötzlich. Das Letzte
hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt bräche ich die Logik übers Knie. „Keineswegs!
Du kennst sie doch auch, unsere persönlichen Schwächen und Vorlieben, mit dem
Strom zu schwimmen und fein säuberlich aufzupassen, ob sie alle mit uns sind.
Es gibt genügend Leute, die Tag und Nacht nicht zur Ruhe kommen können, bevor
der letzte Widerständler nicht zu Kreuz gekrochen ist. Fanatiker werden uns
anklagen, falls wir einen offensichtlichen Fehler begehen. Ihr habt auf der
Linie zu gehen!” Dafür standen mir deutlich ein paar passende Beispiele vor
Augen.
Einmal, an einem Elternabend, hatte ich
während Hartmuts Schulzeit fast mit Schulterschluss neben einem Offizier der
NVA gesessen. Es ging um Fragen der Berufsausbildung, darum, dass Erich Honecker
und die SED darauf bestanden, dass wir mehr Klempner und Heizungsmonteure
benötigten. Zufällig wollte niemand aus der "9 R" eine der erwähnten
Ausbildungslaufbahnen einschlagen. Ich sah wie der linientreue Mann zu zittern
anfing. Er bebte vor Empörung.
Das war es, was
ich meinte.
Gnade dem, der es wagen würde, sich dem Gebot
des Höchsten zu widersetzen, wenn unverrückbar feststünde, dass es sein Gebot
ist. Wir hätten in den meisten unserer Nachbarn scharfäugige Inquisitoren, die
jeden kleinen Irrtum, in den wir fallen könnten, verfolgen würden. Wir wären,
wenn wir endgültig von Gott wüssten, außer unserem dadurch um ein vielfaches
verschärftes, eigenes Gewissen der erbarmungslosen Kritik derer ausgesetzt, die
sich gar nicht tief genug unter den Pantoffel eines Diktators bücken können.
Dann aber lohnte es sich nicht mehr zu leben.
Zum Glück sei Gott kein diktatorischer
Regent. „Er lässt uns Spielraum.”
Woher ich das wüsste.
„Wäre Gott ein Diktator, hätte er uns längst
unterworfen.”
Alle Akteure, ob sie sichtbar oder noch
unsichtbar sind, ziehen ihre Spuren hinter sich her. Ich habe immer nur
gefunden, dass wir völlig frei entscheiden können und genau das ist, für mich,
seine Absicht. Er will uns auf ein höheres Niveau heben, aber nicht dahin
prügeln.
Wir legten eine längere Pause ein. Ich dachte
schon, Manfred wünsche das Thema nicht noch einmal aufzugreifen. Wir glitten
über das sich leicht aufrauende Wasser der Lieps. Von Süden wehte ein
angenehmer Wind.
„So weit so gut.” befand Manfred unvermutet, nur passe meine
Theorie überhaupt nicht zur christlichen Praxis.
Die Spuren im Sand der Geschichte die er
gesehen hätte, zeigten ihm nur das Elend und die Millionen Leichen der im Namen
des Kreuzes Christi ermordeten Menschen:
„Wo hat das Christentum jemals Gutes
ausgerichtet?”
Damit kam er genau auf mein Hauptthema zu
sprechen…
Der Rest des Tages verging uns im Nu.
Ich hielt nach meinen rudernden Kollegen
Ausschau. Sie hoben die letzte Reuse. Ich sah die Menge zappelnder Fische, die
sie ins Schweff schütteten, und meine Gedanken schweiften zurück. Wir fuhren
gemächlich zurück, redeten noch, drehten mit unserem wellenaufwerfenden
Stahlkutter noch eine zusätzliche Runde auf dem Tollensesee. Die Sonne stand
bereits im Westsüdwesten. Meine beiden Kollegen schliefen, erschöpft nach der
anstrengenden Tagesarbeit. Sie lagen lang ausgestreckt auf den Brettern der
großen Schweffdeckel. Manfred machte sich fertig für den Landgang, schüttelte
zum Abschied meine Hand. Er schaute mich sehr freundlich an: „Ich hätte
nicht geglaubt, dass es solche Sichtweise gibt! Aber es hat mir großen Spaß
gemacht. Es war schön gewesen mit Dir.” Er schüttelte den Kopf und lachte: „So
positiv!”
So gingen wir als Freunde auseinander.
Im darauffolgenden Sommer 1988 war er zu
meinem Bedauern nicht mehr dabei. Die Kampfschwimmer als sie uns sahen, kamen mit
ihrem Hochgeschwindigkeitsboot zu uns heran. Ich fragte mich was dieses Tempo
bedeuten soll. Ist es ein böses Omen?
Sie stoppten abrupt. Drei Mann sprangen sofort herüber und … wie
aus der Pistole geschossen kam die Frage: „Was hat du mit Manfred gemacht?“
Sie lachten danach, zu meiner Erleichterung.
![]() In Berlin sei er von einer Bibliothek in die andere gerannt und
hätte, wie ein Besessener, Artikel und Bücher zum Thema „Mormonen“ gelesen. „Armer
Manfred!“ dachte ich. Er hat in einem übelriechenden Abfallhaufen nach Verwertbarem
gesucht. Er
wäre vom Ausflug mit mir mit den Worten zurückgekommen: „Seine Philosophie
ist runder als meine. Wer hätte das gedacht?“ Mit einem Stock hätte er
immer wieder ins Biwakfeuer gestoßen: „Ds hätte ich nie für möglich
gehalten!“
In Berlin sei er von einer Bibliothek in die andere gerannt und
hätte, wie ein Besessener, Artikel und Bücher zum Thema „Mormonen“ gelesen. „Armer
Manfred!“ dachte ich. Er hat in einem übelriechenden Abfallhaufen nach Verwertbarem
gesucht. Er
wäre vom Ausflug mit mir mit den Worten zurückgekommen: „Seine Philosophie
ist runder als meine. Wer hätte das gedacht?“ Mit einem Stock hätte er
immer wieder ins Biwakfeuer gestoßen: „Ds hätte ich nie für möglich
gehalten!“
Schade, dass ich nie wieder von ihm, dem
Opfer frommer Verleumder, hörte. Unwillkürlich musste ich an den Köllner Hochschullehrer
denken, der nur wenige Monate zuvor schwor: „Ich werde mich von meiner
Quelle abwenden.“
Baptistenschule
Wenig später wurden Bruder Bernd Schröder,
Berlin, Gemeinde Friedrichshain und ich eingeladen in Märkisch Buchholz vor
angehenden Baptistenpredigern einen Vortrag zum Thema “Mormonen” zu halten. Der
Griechischprofessor gewährte uns viel Zeit und stellte die üblichen Fragen. Zum
freundlichen Abschied übergab er uns die Theologische Literaturzeitung Nr. 2,
Februar 1984.
Darin stand vornan der Aufsatz “Joseph Smith und die Bibel”.
Ein evangelischer
Bibelexeget von Rang und Namen ahmte Professor Räisänen, Helsinki, Finnland nicht
seine Kollegen nach, die voneinander abschrieben, er hatte sich an der Quelle bedient
und unverdorbenes Wasser gefunden.
Autor Räisänen führt aus, dass Joseph Smith
den Wortlaut der Bibel zwar partiell verändert habe, aber nicht aus dem Grund,
die Texte für seine Zwecke zurechtbiegen zu wollen, was ihm häufig von
selbsternannten Experten unterstellt wurde.
Räisänen lobt Joseph Smith, den jungen
Propheten der nur wenige Tage seiner Zeit zur Schule ging. „... Bei der
Umgestaltung des Passus Römer 7,25 bringt Joseph Smith ein erstaunliches Maß an
Scharfsinn auf; mehrfach entsprechen seine Beobachtungen im Großen denen
moderner Exegeten ... der Versschluss, der vom Dienst am Gesetz der Sünde mit
dem Fleisch redet - ein Stein des Anstoßes auch für die moderne Exegese - fällt
bei J. Smith aus! ... als ein weiteres kleines Beispiel dafür, wie Joseph Smith
nicht ohne einen gewissen Erfolg versucht hat, einen dunklen Gedankengang
zurechtzurücken, sei seine Behandlung von Römer 3,1-8 erwähnt. C. H. DODD
bezeichnet die Paulusargumentation als “dunkel und schwach”. Die logische
Antwort - vor der Paulus zurückschrickt - auf die Frage nach dem Vorzug der
Juden (Römer 3,1) wäre gewesen: 'Gar nichts!' Dass Paulus hier seine eigene
Logik durchkreuzt, scheint J. Smith ebenfalls empfunden zu haben. Er bringt
die Antwort zur Übereinstimmung mit 2: 29: 'But he who is a Jew from the heart,
I say hath much every way ...'”
Seitenlang nimmt Räisänen Aussagen Joseph
Smiths unter die Lupe: „Zusammenfassend lässt sich feststellen”, so der anerkannte Exeget: „dass Joseph
Smith durchgehend echte Probleme erkannt und sich darüber Gedanken gemacht hat
... wie durch ein Vergrößerungsglas lassen sich hier auch die Mechanismen
studieren, die in aller apologetischen Schriftauslegung am Werke sind; die
zahlreiche Parallelen zum heutigen Fundamentalismus aber auch zur raffinierten
Apologetik etwa der Kirchenväter sind hochinteressant ...” Räisänen sagt,
dass moderne großkirchliche Exegese durchaus die Frage zulässt ob der Urtext
richtig überliefert worden sei. Er schließt nach weiteren Darlegungen mit
folgenden, beachtenswerten Worten: „Mit diesen Beispielen aus den Werken
Joseph Smiths, sowie aus der neueren Literatur über den Mormonismus hoffe ich
hinreichend angedeutet zu haben, dass eine ernsthafte Beschäftigung mit diesen
Werken eine lohnende Aufgabe, nicht nur für den Symboliker und den
Religionswissenschaftler, sondern auch für den Exegeten und den Systematiker
darstellt ...” Dass Außenseiter so positiv über Joseph Smith redeten war enorm
selten. Es bewegte uns sehr.
Bernd Schröder und ich wurden in der
Wendezeit abermals eingeladen zu den Studenten zu sprechen.
Wir wurden nicht mehr beaufsichtigt, sondern
durften frei sprechen was immer wir wollten. So wählten wir das uns besonders
am Herzen liegende Thema “Abfall und Wiederherstellung.”
„Da sind unübersehbare Identitäten in Lehre
und der Praxis zwischen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
und der Urkirche“, sagte
ich, mit Rückblick auf Origenes, den Haupttheologen der Kirche um das Jahr 220,
der damals als Schiedsrichter angerufen wurde, wenn in den Gemeinden Lehrdifferenzen
auftraten. Selbst diejenigen die Origenes Autorität in Frage stellen, geben zu,
dass Origenes fast ausnahmslos erfolgreich, weil überzeugend schlichten konnte.
Was er darlegte das galt als Apostellehre. Später fasste ich den Inhalt
zusammen:
Mit wenigen Sätzen international anerkannter Theologen lässt sich
jeweils beweisen, dass die Urkirche der ersten 250 Jahre völlig anders war, als
alle anderen im Jahr 1830. Sie steht da, als Gegenstück zu christlichen Realitäten
etwa der nachnicänischen Zeit. Zwei antike Kaiser – Konstantin und Justinian,
sowie ein Kaiserberater – Ambrosius von Mailand -, sind die
Hauptverantwortlichen für die Änderungen und die Radikalisierung der Kirche samt
dem negativen Paradigmenwechsel.
Joseph Smith hat nicht „irgendetwas“ restauriert und rekonstruiert,
sondern das Bild, sowie die Basislehren der Urkirche: Das lässt sich leicht
belegen. Aber ohne göttliche Führung wäre das ebenso unmöglich gewesen, wie
eine Rekonstruktion des ersten Autos der Welt ohne Vorbild, durch einen Laien.
„Als geradezu blasphemisch
gilt in der „nichtmormonischen“ Theologenwelt, Joseph Smith hätte sich
verstiegen in der Aussage „Gott
war einst ein Mensch und der Mensch kann werden wie Gott!“ Das Lexikon der Evangelischen Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen schreibt: „Die Vorstellung, der zufolge (a) der
Mensch Gott werden kann bzw. (b) der biblische Gott sich aus einem Menschen
entwickelte, steht im diametralen Gegensatz zur biblischen Unterscheidung von
Schöpfer und Geschöpf.“ Andere großkirchliche Experten sagen es ähnlich,
aber wesentlich unfreundlicher. Joseph Smith hat jedoch nie gelehrt, dass
Elohim „der biblische Gott sich aus einem Menschen entwickelte.“ Denn ER
ist der Architekt des Weltalls. Vor ihm gab kein Universum wie wir es heute
verstehen. ER kann also nicht sterblicher Mensch gewesen sein, ehe er Gott
wurde. Dr. Lothar Gassmann von der Bibelgemeinde
Pforzheim urteilte noch schärfer ablehnend: „Dabei geht aus den Schriften
der Mormonen ganz eindeutig hervor, dass sie keine Christen, sondern
Polytheisten sind (sie glauben an viele Götter; Mormonen werden sich zur
Götterstufe höherentwickeln; die Götter seien höherentwickelte Menschen). Dies
ist reiner Spiritismus und Gotteslästerung!“ Aber!, kennt er dieses uralte
urchristliche Zitat?: „… in Jesus
Christus ist der Weltgott ein Mensch geworden, um die Menschen zu
vergöttlichen.“ Anton Grabner-Haider-Maier „Kulturgeschichte des frühen
Christentums“ Vandenhoek Ruprecht mit Bezug auf: „Irenäus Werke gegen die
„falsche Gnosis“
Später sollte
ein Papst formulieren: „...Neben verschiedenen Briefen und einer Biographie
über den Mönchsvater Antonius... kennen wir vor allem das Werk „Über die
Menschwerdung des Wortes“, das den Kern seiner Inkarnationslehre beschreibt:
Christus, das Göttliche Wort, „wurde Mensch, damit wir vergöttlicht würden...“ Benedikt XVI.
Generalaudienz vom 20. Juni 2007
Nikolai Krokoch zitiert Tuomo Mannermaa der darauf verweist, dass
das Wort der Theosis (deificatio) öfters bei Luther vorkommt als der
Hauptbegriff seiner während der berühmten Heidelberger Disputation (1518)
formulierten Heilslehre nämlich die theologia crucis. „Wenn in Luthers
Epistelkommentaren und Weihnachtspredigten die inkarnatorische Wahrheit auf
besondere Weise zum Ausdruck kommt, dann meint er ähnlich wie die orthodoxe
Heilslehre die reale Teilhabe an der Gottheit Jesu. Wie das Wort Gottes Fleisch
geworden ist, so ist es gewiss notwendig, dass auch das Fleisch Wort werde. Dann eben darum wird das Wort Fleisch, damit das Fleisch
Wort werde. Mit anderen Worten: Gott wird darum Mensch, damit der Mensch Gott
werde …” Tuomo Mannermaa “Luther und Theosis”, Band
16 Veröffentlichungen der Luther-Akademie Ratzeburg, Helsinki/Erlangen 1990, S.
11: “Theosis als Thema der finnischen Lutherforschung…
„... Der Gedanke der Vergottung ist der letzte und oberste
gewesen; nach Theophilius, Irenaeus, Hippolit und Origenes findet er sich bei
allen Vätern der alten Kirche, bei Athanasius, bei den Kappadoziern,
Appolinares, Ephraim Syrus, Epiphanius u.a.“ A. vom Harnack „Lehrbuch der
Dogmengeschichte“ Mohr-Siebeck, 1990
„Erst in der Erwerbung der Tugend durch eigenen Eifer erwirbt der
Mensch die Ähnlichkeit Gottes. Unentbehrlich für das Erreichen der
Gottähnlichkeit ist also die Entscheidungsfreiheit.“ H. Benjamins
„Eingeordnete Freiheit; Freiheit und Vorsehung bei Origenes
Hier kommt die nächste Sonderlehre herauf: Keine andere Kirche
lehrte zur Zeit Joseph Smiths, dass es im vorirdischen Dasein einen Kampf im
Himmel gab, der sich um die Frage drehte, wie wir, wenn wir in die
Sterblichkeit fallen aus der diesem Tief heraus befreit werden können. Luzifer -
der Lichtträger- entwickelte die Idee, man könne die Menschen zwingen nicht zu
sündigen. Er wollte uns jenes Individualrecht - die Entscheidungsfreiheit - nehmen,
das Elohim allen gewährte, (Köstliche Perle Moses 4) welches jedoch „unentbehrlich für das Erreichen der
Gottähnlichkeit ist.“ Da
schließt sich der Kreis: Unübertroffen formulierte Joseph, ausgerechnet als er
in Ketten gebunden im Libertygefängnis saß: „ „Die Rechte des
Priestertums sind mit den Himmelskräften verbunden und können nur
nach den Grundsätzen der Rechtschaffenheit beherrscht und gebraucht werden…
wenn wir versuchen unsere Sünden zu verdecken oder unseren Stolz und eitlen
Ehrgeiz zu befriedigen, oder wenn wir auch nur im geringsten Maß von Unrecht
irgendwelche Gewalt, Herrschaft oder Nötigung auf die Seele
der Menschenkinder ausüben – siehe dann ziehen sich die Himmel zurück, der
Geist des Herrn ist betrübt, und wenn er weggenommen wird, dann ist es mit dem
Priestertum oder der Vollmacht des Betreffenden zu Ende.” Lehre und Bündnisse 121:
36-37
Zwangstaufen, Glaubenskriege, jede Art Diktat durch Kirchenobere,
jede Nötigung einer Menschenseele raubt dem Übertreter die Legitimation.
Ambrosius von Mailand stürzte die Freiheitsrechte als er das Gesetz zum Glaubenszwang,
„Cunctos populos“ zum Staatsgesetz erklären ließ.
Manchmal zweifeln selbst langjährige Mitglieder ob der 6.
Glaubensartikel den Joseph Smith verfasste korrekt sei: „Wir glauben an die
gleiche Organisation, wie sie in der Urkirche bestanden hat…“ Ein katholischer Forscher stellte ungewollt die
Korrektheit dieser Behauptung fest: „Allgemein wurde bis vor Kurzem
angenommen, dass die Ämter in der Kirche erst mit Beginn des 3.
Jahrhunderts entstanden.“ Aber moderne Forschungsergebnisse widersprechen
nun massiv. Wörtlich: „Die Kirche der Ignatiusbriefe ist (um das Jahr 100 n.Chr. G.Sk.) erstaunlich gut organisiert. Und hier liegt auch eine der
wichtigsten Ursachen, weshalb man die Echtheit der Ignatiusbriefen bezweifelte.
Man wollte einfach nicht glauben, dass die Kirche schon am Anfang des 2
Jahrhunderts so gut ausgebildete, organisatorische Strukturen gehabt hatte. Es
gibt in der ignatianischen Kirche eine Hierarchie von drei Graden, die vom Volk
der einfachen Gläubigen klar unterschieden wird: Bischöfe, Presbyter (Älteste und Priester G. Sk.) sowie Diakone. Sie sind der Kern der Kirche, ohne sie kann von der
Kirche keine Rede sein: Alle sollen die Diakone achten wie Jesus Christus,
ebenso den Bischof als Abbild des Vaters... Aus dem angeführten Zitat geht klar
hervor, dass die sichtbaren Strukturen der Kirche ein Abbild der unsichtbaren
Verhältnisse im Himmel sind. Gott, dem Vater entspricht in der Ortskirche der
Bischof. Er besitzt die ganze Autorität und die mit ihr verbundenen
Vollmachten...“ Stanisław Łucarz, „Die Kirche als
Gemeinschaft bei Ignatius von Antiochien” 1993
Andere
Forschungsresultate bestätigen das „Mormonische“ in der Urkirche: „... der Bischof leitet die Gemeinde. An
seiner Seite stehen zwei Ratgeber sowie das Ältestenkollegium...
Wenn es sich um eine auszuübende Kirchendisziplin handelte... so bildete der
Bischof mit dem Presbyterkollegium (Ältesten-kollegium) das Richterkollegium...
Der Bischof ist bei jeder Taufe, bei jedem Abendmahl und bei
Ordinationen anwesend... die Diakone besuchen jene Kranken und Alten die
der Bischof nicht erreichen kann, aber sie erstatten ihm einen Bericht.“ Jungklaus, Full Text of: „Die
Gemeinde Hippolyts dargestellt nach seiner Kirchenordnung“...
Bis 1830, als die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage, mit dem Anspruch auftrat die „wiederhergestellte Urkirche“ zu sein,
existierten ausschließlich in ihren Reihen Bischofsgemeinden derselben Struktur
mit vergleichbarer Aufgabenverteilung. Es gab verschiedene Grade des
Priestertums
„Der Bischof bestimmte den in der Gemeinde zum Presbyter, der sich
nach seiner Ansicht für dies Amt eignete, und der ihm gefiel.... Bei der
Ordination von Diakonen durch den Bischof verspricht dieser, wenn der Diakon
tadellos gedient hat, kann er später „das erhöhte Priestertum“ empfangen...“ Jungklaus, Full Text of: „Die Gemeinde Hippolyts dargestellt nach
seiner Kirchenordnung“
Nur damals und dann wieder ab 1830 in der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage gab es ein niederes Levitisches bzw. Aaronisches
Priestertum, sowie das „Höhere“ das Melchizedekische Priestertum wie es auch im
Hebräerbrief Kapitel 7: 11-17 beschrieben wird, das jeder würdige, rechtmäßig
getaufte Mann, mittels Ordination durch einen von Petrus Bevollmächtigten
erlangen konnte. Extrem entgegengesetzt wurde und wird, seitens der lutherisch
orientierten Kirchen behauptet: „Alle Christinnen und Christen sind Priester
durch ihre Taufe.“ Die EKD
Davon allerdings wissen die angeblichen „Priester durch ihre
Taufe“ nichts. Allerdings kennt die römisch-katholische Kirche noch Abstufungen
im Priestertum. Das wird deutlich, wenn es um die Firmung geht: „Üblicherweise
wird die Firmung von einem Bischof – als Nachfolger der Apostel – gespendet. Wo
dies nicht möglich ist, kann die Firmung auch von einem Priester gespendet
werden, allerdings bedarf es hierzu einer gesonderten Beauftragung durch den Diözesanbischof.“
Der Medienreferat der Österreichischen Bischofskonferenz
Alle Gemeindeämter waren ehrenamtlicher Art:
Niemand erhielt, in der Urkirche, jemals für seinen Dienst an der
Gemeinde eine Entschädigung. Folglich blieben selbst die Bischöfe nach ihren
Berufungen Berufstätige. Bekanntlich war Spiridon, noch 325, zugleich Bischof
von Zypern, und Schafhirte. Um 220 beklagte Bischof Hippolyt von Rom, dass die „schismatische“
Gemeinde der Theodotianer in Rom, ihrem Bischof ein monatliches Gehalt zahlte.
dies sei „eine gräuliche Neuerung“ Jungklaus, Full Text of: „Die Gemeinde Hippolyts dargestellt nach
seiner Kirchenordnung“
Liturgische Gewandung gab es erst gegen Ende des 6. Jahrhunderts: Sie
gingen alle, wie die „Mormonen“, stets zivil gekleidet: „Noch im Jahr 403
wurde es dem Patriarchen von Konstantinopel als Eitelkeit ausgelegt, dass er
sich beim Gottesdienst ein eigenes Festgewand anlegen ließ... erst ab 589 gibt
es liturgische Kleidungsstücke...“ Hertling, „Geschichte
der katholischen Kirche bis 1740“ S. 46
Taufen...wurden nur an denen vollzogen, die zuvor belehrt wurden. „Nach
Tertullian „(vgl. de bapt. 18) ist (die Taufe) bis dahin (um 200) keine
Taufe von Säuglingen, sondern von reiferen Kindern oder Erwachsenen durch
Untertauchung. In der Frühzeit wurden nur Erwachsene getauft“ Anton Grabner-Haider-Maier „Kulturgeschichte des frühen
Christentums“
Kaiser Justinian erpresste zwischen 540 und 550 eine Reihe
Änderungen, sowohl in der Kirchenpraxis, wie in den Bereichen Theologie und
Rechtsprechung. Er führte die Kindstaufe ein: „Justinian ordnete 545 die
Verfolgung nichtchristlicher Grammatiker, Rhetoren, Ärzte und Juristen an... er
ließ heidnische Bücher verbrennen. Die Kindstaufe wurde zwangseingeführt, die
Nichtbeachtung mit dem Verlust an Eigentum und Bürgerrecht bestraft.“ Philipp Charwath „Kirchengeschichte“
Abendmahl:
In den Versammlungsräumen befand sich, wie in denen der Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, kein Altar. „Es geht um das
Sitzen um den Tisch. Wobei wieder deutlich wird, dass es in einer christlichen
Kirche eigentlich keinen Altar geben kann, sondern nur einen Abendmahlstisch.“
K-P. Hertzsch, Evangelisches „Theologisches Lexikon", Union
–Verlag, Berlin, 1977
Die Abendmahlsgeräte waren schlicht. Zeremonien gab es da wie hier
nicht.
Kaiser Konstantin, „hat ... den Platz (seiner letzten
Ruhestätte in Konstantinopel) ausersehen...Konstantin hatte vorgesehen, stellte
einen Altar mitten hinein… Konstantin ordnete an, dass der Wert der Gebete, die
hier zu Ehren der Apostel gesprochen würden, auch ihm zugutekommen.“ Hermann Dörries „Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantins"
Das Kreuz als christliches Symbol kam in den ersten 400 Jahren der
Kirchengeschichte nicht vor. „Mormonen“ lehnen das Kreuz als Zeichen des
Christentums ab. Den Katharern Bogumilen, und den Arianern galt das
Kreuzzeichen, nach Döllinger, als das Zeichen des Demiurgen! „... im Jahr
431 (wurde) das Kreuz als zentrales christliches Symbol beim Konzil von Ephesus
eingeführt.“ Der "Evangelische
Kirchenbote..."
„Als allgemein verbreitetes und verwendetes Symbol der Christen
lässt sich das Kreuzzeichen erst in der Zeit der Völkerwanderung nach 375 n.
Chr. nachweisen.“ Bischöfliches Ordinariat Regensburg, 2010
Christ Felix Minucius schrieb etwa im Jahr 200, was er davon
hielt, das Kreuz, an dem Jesus starb, und das Kreuz der Kaiser und ihrer
Legionen miteinander in Verbindung zu bringen: „Kreuze beten wir nicht an
und wünschen sie nicht. Ihr allerdings, die ihr hölzerne Götter weiht, betet
vielleicht hölzerne Kreuze an als Bestandteil eurer Götter. Was sind sie denn
anderes, die militärischen Feldzeichen und Fahnen, als vergoldete und gezierte
Kreuze? Eure (!) Sieges- zeichen haben nicht bloß die Gestalt eines einfachen
Kreuzes, sondern sie erinnern auch an einen Gekreuzigten... bei euren
religiösen Gebräuchen kommt (das Kreuz) zur Verwendung.“ Stemberger „2000 Jahre Christentum“ "Dialog Octavius"
„Dieses Zeichen wurde seit Generationen von Kaisern im Feldlager
beim Altar aufbewahrt. Frühestens 324, im Feldzug gegen Licinius, könnte es
vielleicht, verändert durch Hinzufügung des griechischen P (Rho) als „Christus-
monogramm” gedeutet worden sein. Ob es damals überhaupt irgendeinen Bezug zum
Christentum hatte, ist unsicher, denn zahlreiche Untersuchungen belegen, dass
das Chi Rho schon in jüdischen Schriften auftaucht und die Bedeutung von
‚fertig’ oder ‚brauchbar’ hatte.“ Seeliger „Die Verwendung des Christogramms
durch Konstantin im Jahr 312“ - Untersuchungen kath. theol. Universität
Tübingen
Damit steht fest, dass Konstantin als er am Vortag der „Schlacht
an der milvischen Brücke“ im Oktober 312 in den Wolken, wenn überhaupt, ein
Kreuz sah, war es ein unchristliches Zeichen … das in etwa trugen wir in der
Runde der Theologiestudenten vor.
Bernd sagte hinterher, nachdem wir jedem
angehenden Baptistenprediger, männlich und weiblich, ein Buch Mormon geschenkt
hatten: „So viel Neues und so viel Lebendigkeit haben die hier lange nicht
gehört und erlebt.”
Amerikanische Missionare in der DDR
Die SED-Führung erlaubte ab März 1989, dass
die zwanzigjährigen DDR- Mormonen von der Kirche als Missionare berufen und
sogar ins “kapitalistische” Ausland auf Mission geschickt werden durften.
Einige der Berufenen kannte ich. Sie erhielten einen grünen Pass, wie ihn die
DDR-Diplomaten bekamen.
Kurz zuvor gestatteten sie die Arbeit
US-amerikanischer Mormonen-missionare in der DDR. Der Preis dafür war, zu
bekennen, dass wir Mormonen mit dem Sozialismus leben konnten.
Uns blieb ja ohnehin nichts weiter übrig, wir
mussten mit dem Sozialismus leben.
Natürlich mischten wir uns zu keiner Zeit aggressiv
in die DDR-Politik ein, weil der Bereich, in dem wir uns bemühten, Menschen
zusammenzubringen, „nicht von dieser Welt” war und ist. - wie Jesus
schon in einer Grundsatzbemerkung gegenüber Pilatus äußerte - Joh. 18: 36
Der Verdacht unserer Kritiker, es sei ein
Staatsvertrag geschlossen worden, griff viel zu hoch. Praktisch konnte die
Kirche unter allen Bedingungen existieren, vielleicht sogar in der Illegalität.
Diese im Herbst 1988 gefassten
Politbürobeschlüsse passten nicht in mein Bilderbuch. Fühlten sich die
Sozialisten so stark oder schon zu schwach, um dem Begehren unserer
Führungsspitze noch länger zu widerstehen? War es die Altersschwäche der Greise
im Hause des Zentralkomitees der Partei, die sie so milde und unerwartet
nachsichtig machte? Oder wünschte Erich Honecker, über den Umweg der
Mormonenkirche eine Einladung in die USA zu erhalten?
Richtig ist, dass ihnen von uns keine kriminell-politische Gefahr
drohte.
War dies für sie eine Möglichkeit, einer
stets wachen Weltöffentlichkeit zu beweisen: Seht, wir sind nicht die
Buhmänner, für die ihr uns haltet? Niemals, auch das stand fest, würde sich das
Mormonentum zu einer Massenbewegung auswachsen. Dafür verlangt diese Kirche von
ihren Mitgliedern einfach zu viel Selbstverleugnung, zumindest aber einen hohen
Grad an Selbstdiziplinierung.
Die DDR-Politiker hatten die Resultate
gesehen. Das jedenfalls führte der stellvertretende Staatssekretär für
Kirchenfragen Herr Kalb anlässlich der Einweihungsfeierlichkeiten des
Freibergtempels deutlich aus.
Waren es diese Ergebnisse, die uns in den
letzten DDR-Jahren und Monaten praktisch einen Sonderstatus einbrachten?
Viele Details trugen dazu bei, bestehende Spannungen abzubauen. Dazu
gehörten die Konferenzen über Sicherheit und Zusammenarbeit in Helsinki 1973
und 1975, der SALT II-Vertrag von Reykjavik von 1986 zu dessen Gelingen
Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow mit Hilfe ihrer Unterhändler
beitrugen. Am 29. 06. 1988 las ich mit höchstem Erstaunen Michael Gorbatschows
Bekenntnis, das er als Generalsekretär der Kommunistischen Partei
Sowjetrusslands, auf der XIX. Unionsparteikonferenz der KPdSU, am Vortag, in
seinem umfangreichen Rechenschaftsbericht ablegte: „Eine Schlüsselposition
innerhalb des neuen Denkens nimmt die Konzeption der Entscheidungsfreiheit
ein... “ Neues Deutschland. 29. Juni 1988, S.
Das geistige Leben in der DDR war seit Bekanntwerden der
Gorbatschowideen anders. Die DDR-Führungsriege durfte nicht dem derzeitigen
Kopf der Kremlführung widersprechen, der mutig betonte, dass dem Menschenrecht
auf Entscheidungsfreiheit eine Schlüsselrolle im künftigen Leben aller Völker
zukommt.
Konsequenterweise schrieben im Oktober 1988 drei Repräsentanten meiner
Kirche einen Brief an die DDR-Regierung unterzeichnet von Henry Burkhardt
(Präsident), Frank Apel (Pfahlpräsident), Manfred Schütze (Pfahlpräsident). Darin
heißt es u.a.: „Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage insgesamt
nutzt ihre ausgedehnten internationalen Verbindungen, um konstruktiv auf der
Grundlage der christlichen Weltanschauung zur Verbesserung der Beziehungen der
Völker untereinander beizutragen. Sie unterstützt damit auch unsere Regierung
bei ihrem Bemühen um Koexistenz, Frieden und gute Nachbarschaft. Dieser Weg,
von dem wir glauben, dass er der Schlüssel zu einer glücklichen und friedlichen
Zukunft der Menschheit ist, verlangt aber auch immer wieder ein neues Bedenken
der eigenen Situation und der des Partners und daraus resultierend die
Bereitschaft zum gegenseitigen Gespräch, zum Gedankenaustausch und zur
Zusammenarbeit.“
Der Personenkreis - der staatlicherseits beauftragt wurde das „Mormonentum
allgemein und speziell in der DDR“ zu bewerten – konnte nicht umhin, anerkennen,
dass in dieser Kirche Entscheidungsfreiheit großgeschrieben wurde. Selbst die Stasioffiziere,
die mit diesem Thema befasst waren, vermuteten richtig. Unsere Aufgabe bestand
in der Hauptsache darin, an uns selbst zu unserer persönlichen
Selbstvervollkommnung zu arbeiten, gleichgültig wie weit wir damit kamen. Das
ist ja das Geheimnis des Buches Mormon, wenn Du es gründlich liest ermutigt es
Dich ununterbrochen das Richtige zu wählen und zu allen Menschen gut und
ehrlich zu sein. Was uns trennte, musste nicht wieder und wieder betont werden,
das Gemeinsame sehr wohl, der Wunsch nach Frieden und der Wohlfahrt aller.
Unmittelbar vor den Maiwahlen 89
Nicht wenige DDR-Bürger fühlten es, einige sagten
es mir, dass die Mächtigen in der Honneckerregierung sich zum letzten Mal eines
glatten “Sieges” erfreuen würden. Das war die Kehrseite der sanfter gewordenen
Überwachungspolitik Wir lasen zwischen den Pressezeilen täglich die Wahrheit:
Das Ulbricht-Erbe im kommunistischen System krankte sehr.
Andererseits war allein der vage Gedanke,
dass Moskau und die Altpolitikerriege in Wandlitz jemals ihre militärisch
bestens fundierte Macht freiwillig aufgeben würden für uns unvorstellbar.
Dennoch lag das Neue in der Frühlingsluft.
Viel mehr Menschen als je zuvor hatten Westverwandte besuchen dürfen und alle
kamen mit den Eindrücken zurück, die ein bunt schillerndes Schlaraffenland
einem Bewohner eines Grau-in-grau-Staates vermitteln musste. So geht es nicht
weiter, sagten die erschütterten Heimkehrer mehrheitlich. Es gab kaum noch
Schokoladen, kaum gute Bonbons, es mangelte mehr denn je an Effizienz der
Wirtschaft. Das Lebensmittelnormalangebot fanden wir im Wesentlichen nur noch
in den so genannten Delikatläden, während sich die Lücken in den HO-Kaufhallen,
auf jedem Regal breiter machten, - mit Ausnahme der Alkoholpalette. Peinlich
wirkte die westliche Perfektion, die allabendlich, ebenso wie Chinas
Studentenrevolte in die kleinste Stube hineinflimmerten. Egon Krenz hätte
damals nie nach Peking reisen dürfen, und wenn schon, dann hätte er danach
etwas Kluges sagen und tun müssen - oder schweigen. Aber er war auch nur einer
jener Leute, die meinten, ihr bloßes Wort könnte die Gesetze der Welt außer
Kraft setzen.
Ich irrte in Manchem.
Fast bis zum Ende dieser Entwicklung dachte ich,
nur eine die ganze Menschheit vernichtende Feuersbrunst könnte diesem Eispalast
etwas anhaben. Während sein atemberaubend schnelles und lautloses Zerbröseln
bewies, wie schnell die Masse unter der Einwirkung des Gorbatschowschen Tauwetters
morsch geworden war. Wobei der Dauerfrost der Stalindiktatur erst die
Erschaffung dieses sehr künstlichen Apparates und Staatsgebildes ermöglicht
hatte.
Die Sonne der Vernunft wollte sich
durchsetzen, ausgelöst durch ein paar Männer um Gorbatschow.
Mögen ihn andere deshalb verdammen, ich bin
überzeugt, er hoffte, was er tat würde nicht aus dem Ruder laufen. Immerhin
hatte er auf seine Weise Hand ans
Allerheiligste der Diktatur legte, indem er Unwahrheit und Willkür entmachtete.
Alle Oststaatsmänner wussten es, insbesondere
die russischen. Fast überall logen die Statistiken und die Menschen, die sie
machten. Sie hatten weder die Kornmengen geerntet, noch die zig Millionen
Tonnen Baumwolle auf den Feldern der südlichen Unionsrepubliken, wie gemeldet
wurde – amerikanische Satelliten mit ihren Fehlfarbenkameras bewiesen das -. Es
muss sie erschüttert haben die Wirklichkeit sehen zu müssen.
Der Rest, ihr Untergang, war nur die Folge
davon.
In diesen Tagen
An jenem 30. Oktober 1989, als die Ost-CDU in
Presseerklärungen bekannt gab, dass sie sich aus der SED-Vormundschaft lösen
wolle, bin ich ihr demonstrativ beigetreten. Nicht weil ich es den “Genossen
Kommunisten” nun aber „zeigen“ wollte, sondern mein Wunsch war beizutragen,
dass wir durch beste Mittel und Schritt für Schritt behutsam, zu einer
freiheitlich demokratischen Grundordnung gelangen. Mir war das C wichtig. Die christlichen
Grundwerte sollten zu Grundwerten auch der Parteipolitik werden: Lauterkeit und
Wohlwollen gegenüber allen. Das Ludwigshafener Grundsatzprogramm, dass die West-
CDU sich 1978 gab sprachen für sich: „Der Mensch ist auf Zusammenleben mit
anderen - vornehmlich in festen sozialen Lebensformen - angelegt. Sein Leben
verkümmert, wenn er sich isoliert oder im Kollektiv untergeht. Sein Wesen
erfüllt sich in der Zuwendung zum Mitmenschen, wie es dem christlichen
Verständnis der Nächstenliebe entspricht. Mann und Frau sind gleichberechtigt
und auf Partnerschaft angewiesen. Unterschiede der Meinungen und Interessen
können zu Konflikten führen. Sie sollen offen und in gegenseitiger Achtung
ausgetragen und dadurch fruchtbar gemacht werden. Im Streit um den besten Weg
muss jeder seinen Standpunkt selbst verantworten. Kein Mensch verfügt über die
absolute Wahrheit. Widerstand gilt daher denen, die ihre begrenzten
Überzeugungen anderen aufzwingen wollen. Jeder Mensch ist Irrtum und Schuld
ausgesetzt. Diese Einsicht bewahrt uns vor der Gefahr, Politik zu
ideologisieren. Sie lässt uns den Menschen nüchtern sehen und gibt unserer
Leidenschaft in der Politik das menschliche Maß…. Der Mensch ist frei. Als
sittliches Wesen soll er ver nünftig und verantwortlich entscheiden und handeln
können. Wer Freiheit für sich fordert, muss die Freiheit seines Mitmenschen
anerkennen. Die Freiheit des anderen bedingt und begrenzt die eigene Freiheit.
Freiheit umfasst Recht und Pflicht. Es ist Aufgabe der Politik, dem Menschen
den notwendigen Frei heitsraum zu sichern. Um sich frei entfalten zu können, muss
der Mensch lernen, in Gemeinschaft mit anderen zu leben Wer sich von jeder
mitmenschlichen Verpflichtung lösen und von jedem Verzicht befreit sein möchte,
macht sein Leben nicht frei, sondern arm und einsam.“ (Ende der Zitate)
Das waren Worte die aus dem Mund Josephs
Smiths stammen könnten. Das war es was ich in vielen folgenden Reden beteuerte
und was insbesondere den katholischen Anwesenden zusagte.
Man and
woman are equal and rely on partnership. Differences of opinion and interests
can lead to con flicts. They should be argued out openly and in an atmosphere
of mutual respect so that they bearfruit. In the controversy about the best
path, each is himself
responsibie
for his point of view. No-one has the gift of absulute truth. Therefore, those
who seek to impose their limited con victions on others should be resisted. Everyone is exposed to errorand guilt.
Recognising this protects us form the danger of ideologising policy. It allows
us to see man unemotionallyand imparts a human dimension to ourpassion in
politics .
Ich bekenne freimütig, dass ich die lauten
Aufmärsche in Leipzig und andernorts, die sich gegen die SED richteten, von
Leuten getragen wurden, als verfrüht betrachtete. Noch herrschte DDR-Recht und
ließ Gewaltanwendung durch Staatsorgane zu. Das überschützte ich. Meiner Meinung nach wurde allzu viel zu
schnell eingefordert: Reisefreiheit, Redefreiheit. Ich gehörte zu den
Pessimisten. Ich gebe zu, mir schien, dass wir bereits viel erreicht hatten.
Wir älteren Mormonen genossen die neue Religionsfreiheit seit 1985 zunehmend.
Auch deshalb marschierte ich zunächst nicht
mit. Ich dachte ohnehin das Schlimmste. Die Hauptbuchhalterin unserer
Fischereigenossenschaft Inge Schoemann, die zu den ersten Umstürzlern in
Neubrandenburg gehörte sagte ich: “Ihr reißt den ganzen Bau ein, hoffentlich
stürzen Euch die Balken nicht auf den Kopf.” Ich wurde jedoch eines
Besseren belehrt. Die Führer der Kommunisten ließen die Kanonen in den
Arsenalen.
Das hätte auch anders kommen können, wäre
Gorbatschow nicht gewesen.
Wie nahe wir an einer Katastrophe
vorbeigeschrammt sind, werden wir wohl erst später wissen.
Dennoch muss ich sie loben: Die
bewundernswerten, evangelischen Frauen der Leipziger Nikolai-Kirche hatten
diesen Aufruhr in Gang gesetzt. Das müssen wir alle, die Demokratie lieben,
dankbar anerkennen. Ihr verwegener Mut, als erste offen demonstrierend auf die
Straße zu gehen, war der Beginn. Steinharte Männer die mir gegenüber wiederholt
wörtlich beteuert hatten linientreue Kommunisten zu sein und die noch vor Tagen
gewillt waren für die rote Fahne zu sterben, erwachten am 31. Oktober als
Demokraten. Wunder über Wunder passierten.
Aber reichte das schon aus, um von einer
Wende zum Guten reden zu können?
Ich sah diese Scharen von
Parteigruppenorganisatoren und Parteisekretäre der Betriebe durch den Neubrandenburger
Kulturpark zur Stadthalle eilen. Alle waren an jenem 30. Oktober auf höchste
erregt. Die Parole der kommenden zehn Tage bis zum neunten November hieß für
sie: Schadensbegrenzung. Doch da war nun umgehend nichts mehr, zum Vorteil des
kommunistischen Systems, zu retten. Die echten Kommunisten hatten von Oktober
1949 bis Oktober 1989 hinreichend Zeit gehabt, der Welt zu beweisen, dass ihr Staat
der bessere deutsche sei.
Von der evangelischen Neubrandenburger St.
Johanniskirche aus zogen tausende Oppositionelle, nach Feierabend, durch die
Straßen der Innenstadt zum Karl-Marx-Platz. Sie gingen mutig unter rotbunten
Plakaten mit regimefeindlichen Sprüchen
Mitten durch das Gewühl dieser rebellierenden
Menschenmassen sah ich zwei unserer zwanzigjährigen Missionare schreiten, Elder
Craig und Elder Scofield. Beide gingen in hellen Mänteln, beide wie es mir
vorkam ziemlich unbeeindruckt von dem für uns gewaltigen Umschwung. Sie gaben
ihr Bestes und gewannen tatsächlich viele Herzen. Menschen die sich unserer
Kirche durch die Taufe durch untertauchen anschlossen. Aber, in turbulenten
Zeiten ist es selbst für die Keime der Eichenbäume schwierig schnell genug die
Wurzeln in die Tiefe zu schicken. Viele kamen sehr wenige blieben.
In meine Untersucherklasse in Neubrandenburg
kam irgendwann später auch ein ehemaliger Offizier der Nationalen Volksarmee Bernd.
Seine Frau Martina hatte sich zuvor der Kirche angeschlossen, worüber er wenig
erfreut war. Aber als er hörte die Gemeinde faste für die Gesundheit seiner
Tochter Helen, fasste er den Entschluss mitzukommen zur Kirche.
Ich lehrte Nephis Zeugnisse. Da kam mir der
Gedanke: Lade ihn ein am kommenden Sonntag das Thema zu 1. Nephi 13 zu übernehmen.
Er schaute mich verschmitzt an, überlegte und fragte nach um was es geht: „Bernd,
das Grau und Dunkel des Mittalters kam herauf, weil machtgierige Leute die
Reinheit des ursprünglichen Evangeliums missbrauchten…“ Wir redeten noch
eine Weile, und er sagte zu. Bernd schloss sich nur wenige Wochen später der Kirche
dauerhaft an…
Sotschi
Noch Anfang Oktober hatte mir der
Abteilungsleiter für Land- und Forstwirtschaft vom Rat des Bezirkes eine
Auszeichnungsreise zugesprochen - für Aktivitäten zur Planerfüllung im
Fischfang - einen Flug nach Sotschi am Schwarzen Meer mit einwöchigem
Hotelaufenthalt. Ich nahm dankbar an.
Erikas Anteil allerdings mussten wir selbst
bezahlen. Wir flogen am 5. Dezember von Dresden ab. In unserem sehr modernen,
wunderschön am Fuße der kaukasischen Berge gelegenen Hotel in Dagomir, in dem
riesige, auf Westbesucher eingestellte, Restaurantanteile völlig leer standen,
waren wir von den sich überstürzenden Ereignissen in der Heimat abgeschnitten.
Die Informationen flossen spärlich. Auf einer großen Wandtafel vor dem
Speisesaal fanden wir mitunter die Kernsätze der letzten Nachrichten aus der DDR
(noch lange nicht aus Deutschland). Wie wichtig mir das war. Erka winkte ab,
ihr Herz bangte eher mit ihren Söhnen und Enkeln.
Wir waren eine Gruppe von fünfzig Leuten,
allesamt lange Jahre in der Landwirtschaft tätig gewesene Leiter von
Kollektiven. Ich wunderte mich über die einhelligen und stürmischen
Freudensäußerungen, wenn sie es einander vorlasen: „Der erst am 18. Oktober
als Generalsekretär der SED bestätigte Egon Krenz von Hans Modrow gestürzt!”
Sie jubelten, die SED-Mitglieder, als hätten wir miteinander einen Lottofünfer
gewonnen. Mich freute es auch, weil aus kleinen Reformen nun größere würden. Nur ich fragte mich besorgt, wer und was am
Ende der Überraschungskette stehen wird.
Im blitzsauberen Botanischen Garten des sich riesig ausdehnenden
Kurortes, hatte ich tags zuvor eine der beiden Dolmetscherinnen angesprochen.
Sie ging bereitwillig auf meine teilweise indiskret gestellten Fragen ein: „Ja.
Gorbatschow hat den Offizieren erlaubt, ihren Dienst zu quittieren. Aber, es
nahmen nicht, wie die Parteiführung erhoffte, die älteren Herrschaften ihren
Hut, sondern die jungen, eher pazifistisch eingestellten Männer verließen die
Rote Armee.” Ihr Bruder war ebenfalls davon gegangen. Von ihm wusste sie,
dass es sich so verhielt. Die jungen Tauben flogen weg, die alten Falken
blieben. Diese wichtige, einleuchtende Aussage einer klugen und ehrlichen
Russin sollte mich noch bestimmen, wenig später eine wichtige Entscheidung von
gewisser politischer Tragweite zu fällen…
Nachdem wir wohlbehalten heimgekehrt waren,
fand eine Mitglieder-versammlung der CDU Neubrandenburg statt. In dieser
Zusammenkunft traf ich zum ersten Mal die jungen Katholiken Rainer Prachtl,
Paul Krüger, Ralf Kohl, Günter Jeschke und andere, die wichtige Aufgabenträger
in der neuen Demokratie werden sollten. Ich begann meine durch die Vorjahre
geprägten Ansichten in Zeitungsartikeln und in Ansprachen auszudrücken, sagte
es immer wieder, dass Glaube ohne Vernunft Fanatiker und Vernunft ohne Glaube
Automaten hervorbringen wird. Meine Hoffnung dagegen lautete immer noch, dass
Glaube und Vernunft Künstler macht, nicht nur Lebenskünstler, wenn sie ihren
Idealen und ihrer Liebe treu bleiben.
Als ich mir 1954 eine neue Bibel gekauft
hatte, suchte ich mir aus den Texten ein Motto aus und schrieb es, weil ich es
als schöne Aufforderung verstand, in die Einbandseite: „Tue deinen Mund auf
für die Stummen und führe die Sache derer, die verlassen sind.” Sprüche 31,8 Erst
später lernte ich, dass diese Zeilen ebenfalls von einem großen Christen,
Dietrich Bonhoeffer, zum Lebensmotto gewählt wurden.
So versuchte ich, meinen Glauben auch in die
Politik einzubringen. Für mich waren Politik und Religion seit eh und je eine
Einheit. Für mich war Wahrheit das, was sich wie Gold nie änderte. Sätze wie
Shakespeare Polonius im Hamlet sagen lässt: „Sei ehrlich zu dir selbst und
daraus folgt wie Tag der Nacht, du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen.”
Eines Tages, Ende Januar 1990, traf ich auf
der Straße, vor dem Krankenhaus in der Pfaffenstraße, zufällig Pastor F. Rabe
von St. Michael wieder und teilte ihm mit, dass ich mich entschlossen hätte,
soviel ich kann, beizutragen die Demokratie fest zu machen. Er kannte meine
Ansichten, die ich in der Zeitung "Demokrat" in einem Artikel über
Glauben und Vernunft beschrieben hatte. Er teilte sie und lud mich deshalb ein,
anlässlich des Friedensgebetes am 12 Februar 1990, in der Neubrandenburger
Johanniskirche zu sprechen. Er stellte mir ein Thema aus dem 97. Psalm. Ich
schaute ihn natürlich fragend an. „Was werden deine Amtsbrüder dazu sagen?
Ein Mormone spricht in einer evangelischen Kirche?” Er zuckte mit den
Achseln: „Das haben wir doch gerade abgeschafft, dass Menschen ausgegrenzt
werden.”
Chefpastor von St. Johannis war Herr Martins.
Er soll sehr geschluckt haben, als er hörte: ein Mormone wird in seiner Kirche
reden.
Auch er kannte mich seit vielen Jahren. Wir fanden
uns einmal in den frühen achtziger
Jahren, in seinem Amtszimmer, in der Großen Wollweberstraße zusammen. Es wurde
eine längere Unterhaltung zum Thema evangelische Rechfertigungslehre. Wie
nahezu alle anderen Gespräche, die ich mit Geistlichen der Großkirchen gesucht
hatte, war auch dieses freundschaftlich verlaufen. Deshalb war ich so
überrascht gewesen, als Herr Pastor mir damals abschließend mitteilte, er
stünde mir für ein weiteres Gespräch nicht wieder zur Verfügung. Wovor fürchtet
er sich, fragte ich mich.
Meine Absicht war, in der Johanneskirche vom
Mut und der Glaubenstreue eines polnischen Katholiken zu reden. Solange ich
seine Geschichte kannte, bewunderte ich den Franziskanerpater Maximilian Kolbe.
Bevor ich ans Mikrofon in der Johanniskirche trat, sagte F. Rabe zu mir: “Achte
auf den Nachhall!”
Ich sprach denn auch in Intervallen, was mir
ganz ungewohnt war: “Einer der Männer, die uns auf wunderbare Weise
vorgelebt haben, wie stark Glaube sein kann, ist der Franziskanerabt Maximilian
Kolbe. Am Abend des 12. Mai 1941 schlossen sich die eisernen Tore des
Konzentrationslagers Auschwitz hinter ihm. Er nahm nichts als seine große, von
seiner Religion bestimmte Menschlichkeit mit sich. Er sollte dieses Tor nie
wieder als freier Mann verlassen. Wenige Woche nach seiner Inhaftierung gelang
einem Polen die Flucht. Die Führer der SS-Verwaltung schäumten vor Wut. Sie erklärten,
sie würden jeden zehnten Polen des Blocks, in dem Pater Kolbe lag, erschießen.
Als der Lagerkommandant mit dem tödlichen Auszählen bis Frantisek Wlodarski
kam, einem Familienvater, der entsetzt aufschrie, trat Maximilian Kolbe vor,
nahm die Häftlingsmütze vom Kopf und sagte: Ich werde für ihn sterben. Der
schockierte SS-Offizier akzeptierte. Er nahm sich vor, diesen Mann auf
ausgesucht grausame Weise sterben zu lassen. Sie quälten ihn mehrere Tage lang
allmählich zu Tode. Wo Maximilian Kolbe hätte verzweifelt und zerschmettert am
Boden liegen müssen, da richtete er sich auf. Aus seinem Mund kam keine der
Klagen, die wir sooft hören und die ausdrücken: Wenn es einen gerechten Gott
gäbe, dann würde er das Elend nicht zulassen. Er wusste mehr. Er hatte
erfahren, dass Gott sichtbares Leid mit unsichtbarer Freude zudecken will. Die
rohen SS-Männer konnten das nicht fassen. Und manchmal können auch wir es nicht
verstehen, denn wir sind Menschen, die fast immer nur bis auf die Oberfläche
blicken können, tiefer nur selten. Wir dürfen leben! Machen wir das Beste für
uns und unsere Nächsten daraus.”
Pastor R. nickte mir zu, als ich mich, nach
diesen Worten, wieder hinsetzte. Damit war unsere Freundschaft beschlossen. Ich
gab ihm später ein Buch Mormon und er erwiderte, als wir irgendwann danach
darauf zu sprechen kamen: “Mir sind die Texte des Buches Mormon nicht
unsympathisch.”
Vier Wochen danach sollte ich, an derselben Stelle, die nächste
Ansprache halten. Das tat ich gerne und es brachte mir die Herzen einiger
Neubrandenburger näher. Einladungen aus katholischen Kreisen nahm ich ebenfalls
gerne an. Im Gemeindesaal der Kirche sah ich die vielen Bibeln stehen, alles „Einheitsübersetzungen“
Ich verteilte sie an die etwa 30 Anwesenden um mit ihnen so zu diskutieren wie
ich es in vielen folgenden Zusammenkünften tat. Mir lag daran zu belegen, dass
Gott durch Propheten zu aktuellen Anlässen sprach und spricht. Mein Erstaunen
kam, als ich bemerkte, dass sie nicht gewohnt waren selbst die Bibel zur Hand
zu nehmen, jedenfalls nicht öffentlich.
Zwei Damen, die etwa um die 50 Jahre alt sein
mochten kamen nacheinander zu mir. Sie sagten dasselbe: „Ich erwäge, mich ihrer
Kirche anzuschließen!“
Warum es nicht zustande kam? Ich weiß es
nicht.
Deutsche sind anders als etwa Anglikaner.
Deutsche schauen sich misstrauisch um: „Was wird meine Nachbarin dazu sagen?“
Meine teilweise selbstgewählten Pflichten
nahmen, zumal ich noch jeden Tag zum Fischen hinausfuhr, meine ganze Kraft in
Anspruch.
Kurz nachdem mich die Parteitagsteilnehmer
zum stellvertretenden CDU Kreissekretär gewählt hatten, musste ich eine
wichtige Entscheidung treffen. Da meine Vorgesetzte, Frau Benz, in Friedland
wohnte, fiel mir nämlich zeitweise die Aufgabe zu, unsere politische Arbeit in
Neubrandenburg zu leiten.
Noch im April 1990 hielt ich eine offene Konfrontation für
denkbar.
Westdeutsche Ratgeber, die uns besuchten um
uns Neupolitiker zu beruhigen und sicherlich wohlmeinend zu beeinflussen,
überzeugten mich nicht. Es gibt keine Sicherheit, je mehr wir sie uns wünschen,
umso weniger. Fanatiker konnten den Großbrand immer noch legen.
Dr. Alfred Dregger
Der auch in der DDR wohl bekannte Vorsitzende der CDU/CSU
Bundestagsfraktion, Dr. Dregger, kündigte kurz vor Ostern seinen Besuch an.
Sein Wunsch war, am 20. April auf dem Marktplatz in Neubrandenburg aufzutreten.
Kurz zuvor war ich zum stellvertretenden
CDU-Kreisvorsitzenden gewählt worden und es gab unterschiedlichste Leute, die
mich mit mancherlei Informationen versahen. Da meine Vorgesetzte, Frau Benz,
fernab in Friedland wohnte, fiel mir die Aufgabe zu, unsere politische
Arbeit in Neubrandenburg zu organisieren.
Ich erwog den ernsten Hinweis, den ich am
Karfreitag aus Kreisen erbitterter Westfeinde erhielt, dass es zu einem
Massenaufmarsch fanatischer Linker kommen wird, falls der als ‚Rechtsaußen’ Politiker seine Rede öffentlich halten würde. Im
Geiste sah ich einen Tumult voraus.
Was dann? Diese Vision von
flatternden roten Fahnen beschäftigte mich erheblich. Im Gegensatz zu meinen
Gesprächspartnern aus dem Konrad-Adenauer-Haus war ich nicht der Meinung, dass
ein letztes Aufbäumen der immer noch im Lande unter Waffen stehenden NVA
auszuschließen sei. Meiner Überzeugung nach gab es immer noch genügend Oberste,
die ihre Machtinsignien, selbst gegen alle Vernunft, gemäß ihrem noch in Kraft
stehenden Fahneneid verteidigen könnten, wenn sie ein rotes Signal dazu
auffordern würde. Noch galt das
DDR-Recht!
Ich schloss eben von mir auf andere, ein Trugschluss, wie ich nun
weiß. Wir müssen uns selbstverständlich korrigieren dürfen, in jeder
Hinsicht übrigens, bis das Fundament unseres Wesens Wahrhaftigkeit ist. Aber
dieses Ziel darf niemand dadurch in Frage stellen, dass er sich selber untreu
wird. Gewiss ist keiner gut beraten, wenn er aufgefordert wird seine
Überzeugungen einfach über Bord zu werfen. Deshalb schien mir, es sei
leichtsinnig, solche Erhebung der Linken auszuschließen, zumal der 20. April
Hitlers Geburtstag war. Ein Umstand, den niemand im Büro des Herrn Dr. Dregger,
auch nur im Traum bedacht hatte, den jedoch ein gewiefter Propagandist durchaus
in seine Argumentation, gegen unseren Gast, und damit gegen uns, hätte zur
Geltung bringen können. Mag sein, dass ich verrückte Vorstellungen und Befürchtungen betrachtete. Indessen
stimmten die Mitglieder des Kreisvorstandes der CDU Neubrandenburg nach
Erörterung der Problemlage meinem Antrag mehrheitlich zu, Herrn Dr. Alfred
Dregger nur in der Stadthalle Neubrandenburg auftreten zu lassen. Vor
allem der spätere Oberbürgermeister Neubrandenburgs, Peter Bolick, sah die
Dinge ähnlich wie ich.
Im Büro
Dr. Dreggers war man entsetzt. Denn ich bestand auch auf Änderung einiger
Details auf den Ankündigungsplakaten.
Morgens am 20. April bat mich Dr. Dregger zu
einem Vieraugengespräch. Ich verteidigte den Beschluss und meine eigenen
Ansichten, sagte, was ich dachte und zu befürchten glaubte. Im Beisein seiner
charmanten Sekretärin umrundeten wir vielredend die Tribünen des Sportplatzes
am Badeweg. Er war sehr beherrscht und zugleich sehr wütend auf mich. Ich ließ
mich auf nichts ein, obwohl mir das schwer fiel, denn wer war ich gegen ihn?
Wahrscheinlich hielt er mich für einen verkappten Roten.
Vielleicht liefen ihm bei dieser Vermutung
kalte Schauer über den Rücken.
Doch obwohl ich mit einigen seiner
politischen Auffassungen nicht übereinging, stand ich nicht gegen ihn. Mir war
nur klar, dass ein Mann des Westens bei bestem Willen nicht nachempfinden kann,
wie jemand fühlt, der sein Leben unter dem Diktat der Partei der Arbeiterklasse
zugebracht hatte. Leider oblag es mir, Herrn Dr. Dregger eine zweite Absage zu
erteilen. Es war meine Pflicht, ihm den Beschluss des Rates der
Neubrandenburger Geistlichkeit mitzuteilen.
Dieser Rat hatte mich eigens eingeladen und
mir dringend nahegelegt, Herrn Dr. Dregger zu übermitteln, dass er an der ‘Gedenkstätte
für die Opfer der Nazibarbarei und der kommunistischen Gewaltherrschaft’ in
Fünfeichen, kein Kreuz hinstellen möge, und sei es noch so klein. Das
wäre ihre Sache. Sie hätten bereits den Termin für die Ausrichtung eines
Gebetsgottesdienstes festgelegt. An diesem Tag wollten sie den Platz für ein
künstlerisch gestaltetes Kreuz bestimmen.
Es gibt irgendwo ein Foto, das uns gemeinsam
im Bereich des Vorgartens des damaligen Neubrandenburger CDU-Hauses zeigt. Dr.
Dregger lächelte in die Kamera hinein. Doch ich wusste, wie bitter seine
Gefühle waren. Denn seine bereits vorbereitete Presseerklärung musste wesentlich
geändert werden, das von ihm bestellte Holzkreuz war umsonst hergestellt
worden...
Er lud die Neubrandenburger CDU-Spitze zum
gemeinsamen Abendbrot ins Hotel ein. Wieder musste ich ihm missfallen. Er
suchte eine Antwort in seinem Sinne was die Oder - Neiße - Grenze betraf. Ich
fasste zusammen: „Es ist tief traurig aber der Verlust ungeheurer deutscher
Stammgebiete im Osten… ist der Preis für den von uns angezettelten 2. Weltkrieg,
den Deutschland zu zahlen hat.“ Er schluckte schwer. Jetzt war ich Feind
für ihn, aber ich verstand ihn besser als er ahnen konnte.
Niemand aus der zwölfköpfigen Gruppe widersprach.
Nur wenige Stunden zuvor wurde ich im Auftrag Dr. Dreggers um eine
Einschätzung gebeten: „Wie sollte ihrer Meinung nach der tatsächliche
Wechselkurs ausfallen?“ Ich sagte prompt: „10 zu 1.“ Mir war sehr
wohl bewusst, dass alle Kleinsparer mich gesteinigt hätten, wäre ihnen das
nicht nur zu Ohren gekommen, sondern auf meinen Rat hin realisiert worden.
Aber, wer wusste es, dass die in 14 Großkooperativen zusammengefassten
landwirtschaftlichen Genossenschaften allesamt hoch verschuldet waren. Auf
ihnen lasteten Millionen Kreditsummen. Sie wären um 90 Prozent reduziert worden!
Alle Wohnblöcke irgendeiner Stadt verursachten den Baugesellschaften ungeheure
Bürden. Tatsächlich entsprach der Wert einer DDR-Mark 10 bundesdeutschen
Pfennigen. Dregger und Freunde werden gelacht haben: Uns fallen doch
sämtliche DDR- Industrien als Segen in den Schoß. Wirklich? Achtzig Prozent
dieser Betriebe befanden sich in ungutem Zustand, waren verrottet und veraltet…
Jetzt aber lachte ich, mit dem auch von Dr. Dregger gefassten Beschluss 1 zu 1
zu tauschen gewannen wir unverdiente 400 000 Westmark, denn die standen uns zuvor
nie zur Verfügung, das waren Fantasiezahlen. Ein Finanztrick sollte das
DDR-Wirtschaftsgefüge nach außen ansehnlich machen.
Ein Zauberspruch
machte aus Null horrende Summen. Danke Herr Dr. Dregger, ich mochte immer ihre
Geradlinigkeit.
Anfang Juli ’90 wählten meine Fischerkollegen mich zu ihrem Geschäftsführer
Unmittelbar nachdem unsere Gelder im Zuge des In-Kraft-Tretens der
vereinbarten Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion beider deutscher Staaten
aufgewertet wurden übernahm ich mehr Verantwortung. Die Jongleure des DDR-Finanzministeriums verursachten
vor Monaten, dass ein Kunde für den Betrag von 4.40 Mark ein Kilogramm Karpfen
kaufen konnte, während wir für dieselbe Menge 14 DDR-Mark abrechnen sollten.
Die 10 Mark plus wanderten auf besagtes Konto, dass irgendwann gelöscht werden
sollte. Doch dazu kam es nicht. Die Wahl zum Geschäftsführer nahm ich unter der Bedingung an, nur für eine zweijährige Wahlperiode zur
Verfügung zu stehen.
Ich sagte sogleich: „Meiner Überzeugung nach setzen wir
gemeinsam fort, was wir gemeinsam begonnen haben. Wir bleiben als
gleichberechtigte Mitglieder in einer zu bildenden e.G. zusammen. Ich will
nicht mehr als ihr verdienen. Ein Drittel des Bargeldes setzen wir sofort für
einen Komplexneubau ein, Verarbeitung, Räucherei und Verkauf. Das zweite Drittel zur Absicherung, und das
dritte teilen wir anteilmäßig, als
Entschädigung für entgangenen Lohn auf.“ Das wurde einhellig
akzeptiert. Auch mein Gegenspieler Jürgen Haase widersprach nicht. Mit den
anderen ‚Damen und Herren’, wie meine Kolleginnen und Fischerkollegen
seit März ’90 offiziell hießen, bestätigte auch er in namentlicher Abstimmung,
dass wir zusammenhalten wollten.
„Dann
dürfen wir auch daran denken, uns durch Baukreditaufnahme zu verschulden!” Reiner Lüdtke nickte, Jürgen nickte. Sicherheitshalber
wiederholte ich mich: „Wir werden etwa 300 000 Mark gemeinsam abzutragen
haben.”
Geplant war der Neubau längst. Architekt
Robert Brenndörfer hatte ganze Arbeit geleistet und alles adaptiert. Erste
Bankgespräche verliefen verheißungsvoll. Wir bestellten die Dampframme.
Spannbetonpfähle lagen noch herum. Wir hatten ja bereits zu DDR-Zeiten begonnen
und lediglich neue Vorstellungen einbezogen. Ein Zurück war nun unmöglich. Aber
es waren ja die Zuverlässigen an meiner Seite, der treue Wolfgang Homeyer,
Werner Hansen, Wolfgang Sittig, Frank Busse, Detlef Inhof, Reiner Rottmann,
Dieter Giesa und natürlich Lüdtke.
Auch der viel zu früh verstorbene Ulrich
Johanns hätte mir beigestanden. Er war gut 35-jährig im Bad tot
zusammengebrochen.
Da klopfte es eines späten Nachmittags ein hoch gewachsener
Polizeioffizier. Er reckte sich, als ich die Tür öffnete, legte die Hand
militärisch an die Schirmmütze: „Herr Skibbe, ich komme im Auftrag meiner
Familie, ihnen die traurige Nachricht zu überbringen Ulli verstarb letzte
Nacht. Wir bitten Sie die Beerdigungsansprache zu halten!“
Was sollte ich sagen? Ich hatte ihn erst eine Woche zuvor zusammengestaucht:
„Du drückst dich vor schwerer Arbeit.“ Er überließ die Schwierigkeit der
von Hand-Verladung von Fischmengen den schwächeren Kollegen. Er mit seinen hünenhaften
Kräften verdrückte sich regelmäßig. Ich übernahm auch diese Pflicht und siehe
da, mir wurde erlaubt ein wenig religiöse Gedanken einzuflechten. Prominenz war
dabei, wie die Stadtarchitektin Iris Grund. Anschließend kamen sie zu mir und
lobten: „Du hast es wunderbar getroffen. Ulli kam bildhaft vor uns. Wir
konnten ihn sehen wie er auf den geliebten Tollensesee hinausfährt und seine
Netze auslegt.“
Da aber flatterte uns bereits am 04. Juli 1990 die erste
Gewässerkündigung auf den Tisch. Der Rat der Gemeinde Knorrendorf teilte uns
kurz und bündig mit, was sie für richtig hielten: „Hiermit kündigen wir
Ihnen sämtliche Gewässer unseres Territoriums...” Welch ein Schock.
Wenige Tage später sollten die nächsten Hiebe kommen. Wer
erlaubte es sich, uns die Gewässer zu entwenden, die wir mit teuren Satzfischen
versehen hatten? Der Vorgang war illegal. Sofort
legte ich schriftlichen Protest ein, verwies auf Artikel 9 des
Einheitsvertrages. Da hieß es: Bis auf weiteres gelten die DDR-Bedingungen und
die DDR-Verträge.
Davon ging ich aus, dass es im Wesentlichen wirtschaftlich bleibt,
wie es ist, und nahm zunächst nicht ernst, was sich da anbahnte. Wir
waren immer noch die rechtmäßigen Bewirtschafter der Wasserflächen zwischen
Neustrelitz, Stavenhagen, Penzlin und Neubrandenburg, ausgestattet mit
Bewirtschaftungsverträgen. Mein Finger lag immer wieder auf dem Gesetzesband
Einheitsvertrag. Noch dachte ich nicht an Jürgen. Ich wollte davon ausgehen,
dass mein Dauerkontrahent ebenso gut wie ich wusste, was seine Zustimmung zur
Verschuldung bedeutete. Zumindest durfte er keine Schritte gegen uns einleiten.
Inzwischen wurde ich als Hoher Rat für Missionsarbeit im Pfahl
Leipzig vom Pfahl Berlin übernommen mit Zuständigkeit der Gemeinde Tiergarten
und verantwortlich für die Alleinstehenden Erwachsenen.
Meine erste Ansprache dort wurde akzeptiert, wie die Brüder mir
sagten. Dann sollte ich in Zusammenarbeit mit Schwester S. ein Treffen
verantworten. Das Lustige war: Ich hatte versprochen, nach dem Ausflug auf die Potsdamer
Pfaueninsel das Mittagsmahl zu organisieren. Schwester S. schaute ein wenig
ängstlich, weil ich zugesagt hatte mein Freund Hilmar Girra käme mit seinem LKW
und würde die etwa 60 Teilnehmer beköstigen. Wie sollte das geschehen. Als wir
mit der Fähre heimkamen und den Vorplatz zur nächsten S-Bahn überquerten fragte
die Dame S. : „Wo ist denn nun ihr Hilmar Girra?“ Denn weit und breit
sahen wir keine Möglichkeit die Hungrigen zu trösten. Und plötzlich fuhr er
pünktlich vor. Wieder schauten mich nicht wenige fragend an. Hilmar öffnete die
Heckklappe und sofort verbreitete sich der angenehme Geruch von frisch
geräucherten Aalen erster Klasse. Lady S. atmete auf als die ersten lobten: „Das
ist ja eine große Delikatesse.“ Selbst die gegenüber Fischmahlzeiten
kritischen fragten nach einem zweiten.
Ein paar Tage danach ließ ich weiter die genossenschaftlichen Dinge
und Probleme auf sich beruhen.
Eine attraktive, junge Dame aus dem
Konrad-Adenauer-Haus kreuzte in meinem Büro auf. Sie stellte mir ein paar
Fragen, die Kommunalpolitik betreffend. Da gab es keine Schwierigkeiten die
mich betrafen, jedenfalls keine großen. Aber als sie hörte, dass ich den
übernommenen Betrieb nicht nur personell, sondern auch strukturell erhalten
wolle, erschrak sie. Ihr Mund spitzte sich. Sie sagte: „Oh, o, da sehe ich
Sie aber schon oft vor dem Kadi sitzen!” Ich lachte noch und verabschiedete
sie mit einem Scherz.
Wir fischten selbstverständlich in den uns
von den Bürgermeistereien gekündigten Gewässern.
Es gab jedoch erste Hinweise auf Befischung unserer Seen durch
andere. Zunächst beunruhigte mich das nur wenig. In Waren und Prenzlau gab es
analoge Problemfälle. Sicherheitshalber fuhr ich auf den Lindenberg, wo die
Stasi in riesigen, mehrstöckigen Gebäudekomplexen gehaust hatte, da befand sich
nun der Torso des ehemaligen Rates des Bezirkes Neubrandenburg. Mein Wunsch
war, mit Rainer Prachtl zu reden. Er saß dort und verkörperte in seiner
Stellung und in dieser Phase die höchste Autorität im Bezirk. Noch befanden wir
uns rechtlich in der DDR.
Wir trugen zwar bereits das ersehnte Westgeld
in den Taschen und im Kopf, doch noch hieß unser Land offiziell DDR.
„Du bist im Recht. Ich gebe es dir schriftlich!”, sagte Rainer Prachtl und ließ Jürgen Meyer kommen, den im Bezirk
für Binnenfischerei zuständigen Fachmann.
„Jawohl,
die alten Rechtsträgerschaften bleiben vorläufig in Kraft...” Das
gab mir Zuversicht. Deshalb blieb ich ruhig, zu ruhig wahrscheinlich, zu lange
auch. So vollzog sich das Folgende zunächst, ohne mich sonderlich zu erregen.
Auszüge aus dem Betriebsprotokoll: „Am 19. Juli 1990 wird uns per Schreiben des Bürgermeisters Herrn
Schwarz, Rehberg mitgeteilt, dass die im Grundbuch in der Flur 3, Flurstück 6
eingetragene Seenfläche an eine Privatperson verpachtet sei.“
Es handelt sich um den Balliner See, auch
bekannt unter der Bezeichnung Rehberger See. Neue Kündigungsschreiben
trudeln ein. Wir wehren uns. Doch zwischenzeitlich, am 28. Juli, erhalten wir
Antwort aus Knorrendorf auf unseren Protest. „Wir haben Ihr Schreiben vom 13. Juli erhalten. Nach Auskunft durch
einen Rechtsanwalt, haben wir bestätigt bekommen, dass unsere Kündigung vom 27.
Juni 1990 rechtskräftig ist und somit bestehen bleibt.”
Protokollauszug vom 28. Juli: „Ein persönlicher Besuch des Geschäftsführers Herrn Skibbe in
Knorrendorf. Das Gespräch mit der Bürgermeisterin Frau Hartwig ergibt keine
Übereinstimmung.“
Ein uns gut gesonnener Anglerfreund gab mir den entscheidenden
Hinweis: „Das Haupt ist Herr K., suche ihn auf.” Der mir
das riet, hatte Ahnung. Ich fuhr umgehend hin, wünschte mit Herrn K., dem Leiter des
Gemeindeverbandes Rosenow, zu reden.
Man ließ mich ein. Ich nannte meinen Namen.
Er nickte nur. Er wusste Bescheid.
Da saß
er, ein energischer, bärtiger Fünfziger. Hinter seinem Schreibtisch hockte er
sicher. Seine Brillengläser funkelten: Ich bin ein Demokrat! Ich
konterte auf ähnliche Weise: Ich auch! Er schaute mich durchdringend an.
Ich stellte ihm mein Anliegen vor: „Wir bauen eine neue Betriebsstätte, wir
haben beschlossen zusammen zu bleiben und gemeinschaftlich zu wirtschaften,
nicht gegeneinander.”
Seine lapidare Antwort lautete: „Stalinistische
Genossenschaften brauchen wir nicht mehr!” „Sagten sie stalinistische?” „Ich sagte und meinte stalinistische!”
Wie ein Fisch im schlechten Wasser schnappte
ich nach Luft. Demokraten?
Weiß der Mann, was das ist? Liberaler
sei er. „Ich bin
CDU-Mann!“
„Blockflöten!” erwiderte er höhnisch, das war die Bezeichnung für Opportunisten
zugunsten der SED.
Gut, dass ich keine Pistole besaß, ich hätte ihm ein Loch in sein
„rechtes“ Ohr geschossen. Sollte ich dem da erklären, dass ich am 30. Oktober
1989 in die CDU eintrat, weil sie an eben diesem Tage erklärte, sie kündige die
Bündnispolitik mit der SED auf? Er beharrte, ich beharrte: „Wir werden
morgen im Kastorfer See fischen”
„Ich
schicke ihnen die Polizei auf den Hals. Herr Jürgen Haase. ist der neue
Bewirtschafter!” Hatte ich es nicht geahnt? Meine ohnmächtige Wut ließ ich mir
nicht anmerken: Mein Mitglied und Mitträger aller Beschlüsse brach seine
Versprechen. „Tun sie, was sie nicht lassen können!”
Schnell fand ich mich vor der Tür wieder.
Unser Genosse Jürgen besaß also einen
„gültigen“ Pachtvertrag, wir dagegen galten nun als Fischdiebe. Mit
meinem gelben, alten Trabant bin ich mit überhöhtem Tempo nach Hause in die
Fischerei gefahren. Im Flur des alten Wirtschaftsgebäudes traf ich Detlef
Inhof. Der strohblonde Exhochseefischer wies mit dem Kopf zur Tür des
Netzlagers: „Da drinnen”, wisperte er. Mit einem Ruck stieß ich
die Tür auf. Jürgen saß da und Reiner. Zwei Umrisse wie aus Bronze gegossen,
Nachdenklichkeit und Besorgnis. Reiner, zumeist gutmütig und hilfsbereit war
gerade im Begriff zu erklären, dass er wenig Hoffnung habe, dass ich ihm einen
Vorschuss für die fälligen Pachten geben würde... „Seid ihr von allen guten
Geistern verlassen? Du würdest ihm helfen uns zu ruinieren? In einer Stunde ist
Mitgliedervollversammlung!” Jetzt gab es kein Halten mehr. Entweder Jürgen oder
wir. Jürgen setzte ein Signal, wenn wir dem nichts entgegensetzen, dann bricht
es. Mensch Jürgen, wir haben dein Versprechen schriftlich! Es schnürte
mir die Kehle zu. Der große junge Mann mit dem ausdrucksstarken Gesicht ging in den
ersten Arbeitsraum. Da setzte er sich hin und strickte eine Netzreihe herunter,
als wäre nichts geschehen. Ich sprach ihn kurz an und er antwortete normal, als
sei nichts passiert. In der Vollversammlung, die ich leitete, legte ich in
wenigen Sätzen die Situation dar. Entweder stellt Jürgen sich auf unsere Seite
oder er muss die Genossenschaft verlassen. „Die Pachtungen, die Jürgen
betreibt, schließen uns von dem Recht auf Wiederfang der von uns eingesetzten
Fische aus.” Er entgegnete: „Ich will frei sein und nehme nichts zurück! Mit
der Kommandowirtschaft ist es aus!”
„Dann
schließen wir dich aus!” Er schaute mich an. In
seinen Augen las ich die Ablehnung. Mich lehnte er ab, die Genossenschaft
lehnte er ab, die meisten Männer, außer Dieter Gisa und Willi Krage
widerstanden ihm längst, wegen seiner Arroganz. „Du hast dich in namentlicher Abstimmung für den Fortbestand
unseres Unternehmens ausgesprochen...” „Na und? Ich bin im Recht!” „Dann schneiden wir dich ab.”
Auszug aus dem Protokoll des 10. August 1990: „Nach kurzer Bedenkzeit und folgender Diskussion stellt Herr Skibbe
in der Mitgliederversammlung den Antrag auf Ausschluss von Jürgen N. aus der
Tollensegenossenschaft.
Von 16 stimmberechtigten
Mitgliedern, sind 14 anwesend.
3 Enthaltungen, 1 Gegenstimme, 10
Dafürstimmen ...“ Jürgen begab sich mit
seinen Freunden nach draußen. Er hielt mit ihnen Rat. Als ich sie so dastehen
sah, schien mir, er würde gar nicht begreifen, was ihm widerfahren war. „Wir sehen uns vor Gericht wieder!”,
sagte er nur und ich erinnerte mich der Worte der jungen Dame aus dem
Konrad-Adenauerhaus.
Zunächst musste ich meine Ankündigung in Kastorf wahr machen. Am
nächsten Morgen würden wir auf jeden Fall und demonstrativ im Kastorfer See
fischen. „Werner (Hansen), ich komme morgen mit!” sagte ich, denn wir
konnten sicher sein, dass wir auf heftigen, möglicherweise polizeilichen
Widerstand stoßen werden.
Werner Hansen wollte nicht, dass ich mit ihm
fahre, ich hätte zu Hause genug zu tun. Aber unser gemeinsames Auftreten im
Territorium Rosenow war mir wichtiger. Wir verluden einen der leichten grünen
Plastekähne, das Notstromaggregat, die Handelektrode, den Sicherheitsschalter,
Minuspol, Gleichrichter, Kescher, den großen Fischbehälter und setzten uns in
den Exmilitärwagen vom Typ Robur.
Hätten wir, als wir durch Knorrendorf fuhren,
die Sekretärin am Briefkasten gesehen, dann wäre uns vielleicht in den Sinn
gekommen, dass sie Post gegen uns einsteckt. Wie üblich schoben wir uns
vorsichtig und aufmerksam am Gelegesaum entlang. Werner, auf dem
Sicherheitsschalter stehend, stieß in vier – fünf – Meter -Abständen die an
einer etwa fünf Meter langen Glasfiberstange befestigte handtellergroße
Elektrode ins fast glasklare Wasser bis auf den Seegrund in Klaftertiefe. Wie
üblich waren acht von zehn Versuchen umsonst. Dann kam eine kleine
Quellmooswiese in Sicht. Da war es nur einen Meter tief. „Dor sünd wek!” ("Da sind welche
(Aale!") sagte er voraus.
Ich hatte oft genug elektrisch gefischt um
nicht zu wissen, dass er Recht bekommen würde. Zuerst schossen die untermaßigen
Aale heraus, sie wanden sich und taumelten narkotisiert zur Seite. Dann
schlängelte sich ein dicker, fünf Zentimeter breiter Aalschwanz heraus. Da der
Flossensaum eine verhältnismäßig große Potentialebene darstellt und wir ihm mit
der Anode dicht auf den Leib gerückt waren, hielt ihn der Gleichstrom fest. Die
Kraft, die von der Anode ausging, reichte jedoch nicht aus, ihn völlig aus
seinem Versteck zu ziehen. Werner Hansen half nach. Er war hochrot vor
Aufregung, weil es sich um einen kostbaren Starkaal handelte. Von drei Aalen
dieser Stärke entkommen in der Regel zwei, vor allem wenn sie sich weiter als
einen Meter vom Pluspol aufgehalten haben. Sie sind zudem geschwind und enorm
gewitzt. Werner hakte mit dem elektrisierten Metall in den sich krümmenden
Fischschwanz. In diesem Augenblick bemerkte ich, dass sich in vierhundert Schritt
Entfernung eine Sandwolke auf uns zu bewegte. Ich musste mich jedoch zuerst um
den Aal kümmern, der plötzlich in voller Länge auftauchte. Mit Mühe gelang es
mir, dem kräftigen Fisch den Kescher vor das breite Maul zu halten. Gemeinsam
erwischten wir ihn und ich kescherte den sich wild wehrenden Dreipfünder heraus
und schüttete ihn ins wassergefüllte Schweff. Da tobte er eine Weile umher. Die
kleinen Aale dagegen flohen wie üblich.
Sobald der Stromkreis unterbrochen wird,
machen sie sich davon. Augenblicklich erwachen sie aus der Narkose und schwimmen binnen
ein, zwei Sekunden davon, um eine wichtige Erfahrung reicher. Wenn
sie je wieder das Geräusch des im Rhythmus des dröhnenden Notstromaggregates
schwingenden Fischerkahnes vernehmen, flüchten sie rechtzeitig und es dauert
Wochen und manchmal Monate, bis der Handelektrodenfischer sie wieder sieht. Mitunter
liegen die knapp einhundertfünfzig Gramm schweren Satz- und Mittelaale so dicht
beieinander, dass man fünfzig, sechzig mit einem Schlag erwischt. Schade, weil
sich unter ihnen auch die fangreifen Männchen befinden, die nur etwa
einhundertundachtzig Gramm schwer werden. Man nennt sie, wie die großen,
geschlechtsreifen Weibchen, Blankaale. Aale die nicht mehr wachsen.
Das Aussortieren nimmt dann viel Zeit in
Anspruch. Ich stieß Werner Hansen an und wies mit dem Kopf hinüber. Da
erschien ein roter „Wartburg“. Er hatte die Staubwolke hinter sich hergezogen.
Für Sekunden entschwand er noch einmal aus unserem Blickfeld. Den Mann am
Steuer schien ungeheure Wut zu treiben. Wie ein Wahnsinniger war er auf der
Sandpiste entlang gesaust.
Den breiten Rücken durchdrückend wandte
Werner sich zu mir, sein volles bartstoppliges Gesicht verzog sich. Es war ein
etwas schräges Lächeln, das sich um seine blutvollen Lippen legte. Werner
nannte einen Namen, den ich nicht verstand.
Uns war bewusst, dass der Besuch mir vor
allem galt. Wir machten weiter und gewahrten vom neuen Standpunkt aus, dass der
„Wartburg“ sich nun direkt vor unseren Robur befand. Er hatte uns blockiert.
Aber wir konnten von dem Fahrer nichts entdecken. „De is int Dörp gohn, hei holt de Pulezei!” ("Der ist ins Dorf gegangen und holt die Polizei!")
Richtig. Wir wurden festgenagelt. Zur Linken unseres Robur befand sich ein
anderthalb Meter hoher Schotterberg, zur Rechten der See. Vor uns der Wartburg,
hinter uns der Kahnhänger auf dem wir unser Boot transportierten und dahinter
ein Graben. Fast wortlos einigten wir uns, es nicht auf eine Konfrontation mit
der Polizei ankommen zu lassen. Wenn man uns das Schreiben des Bürgermeisters
vorweisen würde, könnten sie uns zwingen, die Fische in den See
zurückzuschütten. So, wie das unseren Männern bereits andernorts ergangen war.
Vierzehn Tage zuvor hatte ich auf dem Polizeirevier in Stavenhagen
zwanzig Minuten aufwenden müssen, um meinen geharnischten Protest zu Papier zu
bringen und um zu erreichen, dass die von den Polizisten am Ivenacker See
beschlagnahmten Fanggeräte wieder herausgegeben wurden, was denn auch umgehend
geschah. Sie wunderten sich auf dem Revier nur, wegen der vielen Worte und
Sätze die in so kurzer Zeit auf ihrem weißen Papier entstanden. Allerdings die
Zander, die sie ins Wasser zurücksetzten, blieben verloren. Ärgerlich
nur, dass unsere Kunden, die sich die Fische bei uns bestellt hatten, später
unbefriedigt nach Hause gehen mussten.
Ziemlich eifrig, als wären wir Fischdiebe,
verluden wir das Geschirr und die Fische, schoben unser Boot auf den
Kahnhänger, banden es fest. Wir hatten keine Wahl. Entweder entkamen wir
unseren Gegnern oder wir waren blamiert.
Blamiert? lachte Werner. Er hatte es wieder
im Kreuz und ging schief.
Ich bräuchte ihn nicht einweisen, der Robur
sei ein Geländewagen und würde den Schutthaufen ohne weiteres erklimmen. Ohne
weiteres? Umkippen kann uns die Fuhre.
Das war Werner Hansen. Er äugte kurz,
startete, schob einen halben Meter zurück, kurvte bis hart vor den roten
Kotflügel des Wartburgs, schob noch einmal, das Lenkrad scharf herumreißend,
zurück. Jetzt wieder vorwärts. Noch war von dem PKW-Fahrer nichts zu sehen.
Jeden Augenblick konnte sich das jedoch ändern. Dass wir flohen wollten,
ließe sich ja wohl nicht leugnen. Dass niemand flieht, der unschuldig ist,
liegt wohl auf der Hand! So hörte ich sie schon höhnen. Nun erklomm unser
braver LKW tatsächlich den kleinen steilen Berg. Er rutschte ein wenig nach
links, dann nach rechts. Der Kahnhänger folgte uns. Das Wasser im
kubikmetergroßen Fischbehälter schwappte, doch es ging voran. Wir glitten und
rollten und bremsten den kleinen Abhang hinunter. Nicht die Spur eines
Kratzers am Wartburg, das war nun wieder das Wichtigste. „Dat Wüchtigste is,
dat se uns nich kriegen!” ("Das Wichtigste ist, dass sie uns nicht
fassen!") erwiderte Werner und schlug einen Weg ein, den ich noch
nie gesehen hatte. Querfeldein ging die Fahrt über Stock und Stein, vorbei an
Viehkoppeln und Maisstauden. Banditenhaft verhielten wir uns. Dieser eine
Begriff bemächtigte sich meiner Gedanken.
Ich und er waren unter die Räuber gegangen. Mindestens
drei ![]() Anzeigen wegen Fischwilderei führten mich wiederholt vor den Kadi.
Anzeigen wegen Fischwilderei führten mich wiederholt vor den Kadi.
Dabei hatten wir nie in anderen, als in den uns zur
Bewirtschaftung offiziell übertragenen Gewässern gefischt. Einmal
bekam ich Recht, zweimal Jürgen. Noch jedoch war nichts endgültig entschieden.
Der Krieg mit Jürgen ging weiter.
Er stellte Netze, wir gerieten mit unseren
Zugnetzen dazwischen.
Er pochte auf seine Verträge, wir auf unser
Gewohnheits- und Bewirtschaftungsrecht, das uns die DDR gegeben hatte. Ich
ging in Berufung.
Aber es gab auch großen
Krieg. In eben diesen Tagen, Anfang August 1990, waren irakische Truppen
in Kuwait einmarschiert. Der große Irak erklärte den kleinen Staat Kuwait zur
19. irakischen Provinz. Die entmachteten Scheiche schrieen so laut um Hilfe, dass auch wir
es vernehmen mussten. Am 29. November fasste die UNO einen Beschluss, der die
gewaltsame Vertreibung Iraks aus dem freien Land Kuwait androhte. Wie
eine düstere Ahnung, dass dies das Vorspiel zum dritten Weltkrieg sein könnte,
lag die alte Beklemmung wieder auf allen.
Meine Notiz zur Tagebucheintragung,
geschrieben am 6. Dezember, lautete: „Was wird uns 1991 bringen? Unter dem
Druck der Zuspitzung der Kuwaitkrise leidet jeder. Jeder weiß, wie leicht
Kriege, in die Supermächte verwickelt sind, ausufern können. Wir sehen die
vielen anderen Probleme, auch die wirtschaftlichen, rings um uns herum, ...”
Dunkle Geschäfte
Statt
Scheine von radikal abnehmendem Wert besaßen wir seit dem ersten Juli Geld. Wir
fühlten uns wie Geburtstageskinder, die sich freuen sollten und es doch nicht
so recht konnten. In den Lebensmittelgeschäften sah es paradiesisch farbig aus,
aber in unseren Seelen immer noch grau. Vorausblickend fanden wir, dass auf dem
Wege vor uns kaum überwindliche Hindernisse liegen würden. In einem handelten
die meisten Ex-DDR-Bürger logisch richtig. Jetzt drehte jeder den aufgewerteten
Groschen dreimal um, ehe er ihn einmal hergab. Bereits zu DDR-Zeiten war es
zunehmend schwierig geworden, selbst wertvolle Fische, wie Kleine Maränen, wenn
sie in Massen angelandet wurden, en Block abzusetzen. Auch die Disponenten und
Leiter der Fischauslieferungslager mussten längst wirtschaftlich rechnen und
ihr Risiko klein halten. Ihre Prämien hingen von ihrem eigenen Geschick ab.
Jetzt, nach der Wende, oblag uns die Fische nicht nur zu fangen, sondern sie
auch eigenhändig, Stück für Stück, zu veräußern. Im Spätherbst fingen unsere
Männer auf der Lieps wieder einmal große Mengen Brassen, alles stattliche
Exemplare. Werner Hansen kam mit seinem Trabant angesaust, um mich zu
informieren. Meine Kollegen hofften, dass ich aus zehn Tonnen Bleie mehr als
zehntausend Mark erlösen könnte. Werner, immer höchst agil und dabei nicht
selten angriffslustig, sah mich scheel an, weil ich mit den Achseln gezuckt und
kritisch fragend angemerkt hatte, wer im neuen Konsumentenwunderland noch Bleie
kaufen würde? „De Russen!”, konterte er scharf und schaute mich
vorwurfsvoll von der Seite an. Manchmal schielte er ein wenig. Auf diese Idee
hätte ich von alleine kommen müssen. Auf jeden Fall fahre er jetzt mit einem
LKW, Kisten zur Fahrgastschiff-Anlegestelle in Prillwitz. Das könne ja nicht
falsch sein. Die nächsten Russen saßen in Neustrelitz. Deren Bedarf jedoch
wurde meines Wissens von den Prenzlauer und Neustrelitzer Fischern gedeckt.
Noch dachte ich nicht in den modernen Kategorien. Dieses Denken: „Zuerst
komme ich!” erschien mir noch als unmoralisch.
Da ich verpflichtet war, den Betrieb
durchzubringen, blieb mir allerdings nichts weiter übrig, als mich über meine
Bedenken hinwegzusetzen. Es war bereits vierzehn Uhr geworden. Schnell. Ich
telefonierte, Dolmetscher Herbert Fischer war einverstanden. Er stünde mir zur
Verfügung. “Gleich?”
“Na, ja,
sagen wir in einer Stunde!” Exoberstleutnant Herbert
bereits seit vier Jahrzehnten im Umgang mit Offizieren der Roten Armee geübt,
bat fernmündlich um ein persönliches Gespräch mit dem Chef der rückwärtigen
Dienste der Neustrelitzer Panzerdivision. “Kommen Sie, wann immer Sie
wollen!”
“Wir sind in einer halben Stunde bei ihnen.” Ein
schneidiger Unterleutnant mit Glacéhandschuhen, der wie ein Eleve des Tanzensembles
des Bolschoi Theaters ging und auftrat, holte uns von der Torwache ab. Oberst
Berlett lasse bitten. Es war, glaube ich, dasselbe Tor, das ich erstmalig 1946
gesehen hatte. Es standen da, wie mir schien, immer noch dieselben Worte, die
sich um die an die Wand gemalten Panzer und Waffenbrüder rankten: Ruhm und
Ehre. Slawa i tschest.
Seit damals ging hier kein normaler
Sterblicher mehr ein und aus. In diesem Stadtteil mochten früher vielleicht
sechs- oder achthundert Neustrelitzer in ihren Einfamilienhäusern gelebt haben. Das
Tageslicht unter dem wolken-verhangenen Himmel nahm bereits merklich ab.
Deshalb erschien uns das Haus, in dem der Oberst sitzen sollte so düster. Er
erhob sich, als wir eintraten, reichte uns die Hand, zeigte seine Goldzähne und
gleich seine ganze Freundlichkeit.
Schon die vielen auf dem Flur herumstehenden
und diskutierenden Offiziere waren mir angenehm aufgefallen. Solche Russen
hatte ich bisher nur selten gesehen. Ich kannte fast nur eckige Gesichter und
die überwiegend groben Ausdrücke im Aussehen und in der Sprache. Kaum,
dass Berlett uns angehört hatte, nickte er ermutigend. Er müsse nur noch mit
seinem Vorgesetzten reden. Das geschah.
Herbert Fischer flüsterte, der Oberst
versuche seinen Chef zu überzeugen, dass sie gemeinsam dringend zehn Tonnen
Bleie benötigten.
„Wie
teuer?” In meinem Kopf existierte die Wunschgröße 1.75. „Knapp zwei
Mark je Kilogramm Frischfische!”, dolmetschte Herbert generös. So trat er
gelegentlich auch auf. Berlett strahlte. „Zwei Mark sind ein guter Preis. Wann können
Sie liefern?” „Fünf
Tonnen sofort. Den Rest morgen.”
Er zog zweifelnd die Stirn hoch. Aber
ich wusste es ja. Fünf Tonnen sind eine glatte Kutterladung und diese Menge
ziemlich schnell ein- und auszukeschern war für unsere Männer kein Problem. Ich
schaute auf die Uhr. Anderthalbe Stunden bis zum Laden, eine weitere höchstens
für den Umschlag, eine halbe für den Transport. „Zwischen acht und neun
Uhr!” Mit hundert Sachen, wo es möglich war, raste ich nach Prillwitz.
Denn da standen an diesem frühen Abend meine ungeduldigen Fischer und warteten
nur auf das ersehnte Zeichen. Als wir kurz vor neun mit der ersten Fuhre auf
dem ‚Russenspeicher’ ankamen, machten sich die uniformierten Jungs
umständlichst ans Abwiegen. Eine halbe Stunde lang sah ich mir das Theater an
und sagte schließlich: „Ihr seid wohl nicht recht bei Troste!”
Was Herbert übersetzte, kann ich nicht sagen.
Sie stutzten jedenfalls. „Da sind in jeder Fischkiste mindestens
zweiunddreißig Kilogramm Ware und auf dem Lieferschein stehen dreißig!” Bei dem
Schneckentempo, das sie beim Abwiegen vorlegten und bei dieser Menge, hätten
wir die Zeit bis zum Morgengrauen gebraucht und ich war todmüde. Natürlich
konnte nur die Gesamtmasse stimmen. „Lass sie mal.”, beruhigte Herbert
Fischer mich, er sei ja auch die Ruhe in Person. Sein Zuspruch tat mir gut.
Nun, da die DDR endgültig kaputt war, konnte einer wie er alles ganz gelassen
sehen. Sogar die Uhren liefen für ihn anders. Ich dachte an unser Gespräch
zurück. Den Zusammenbruch habe er bereits seit einem Jahrzehnt kommen
sehen, sagte Herbert Fischer, als wäre das so selbstverständlich, wie der
Blätterfall im Herbst. Der Kommunismus konnte nicht siegen. Gründlich hatte er
mir das auf der Herfahrt vorgerechnet.
Alleine die Wartung der komplizierten
Waffensysteme sei zu kostspielig geworden und dann diese
Zweiklassengesellschaft. Am meisten hätte ihn aufgeregt, dass die Hirsche den
Privilegierten unter den führenden Genossen vorbehalten blieben, während Leute
wie er, nur Heger statt Jäger sein sollten.
Ungeschönt habe er das seinen großen Militärs
des Öfteren an den Kopf geschmettert: „Die Jagd dem Volke, die Hirsche dem
Politbüro!” Höheren Ortes hätten sie ihm das ziemlich verübelt. In
ihrer Gunst sei er nur geblieben, weil sie seine Fähigkeit schätzten auch dann
simultan zu dolmetschen, wenn sie durcheinander und schnell redeten. Immer auf
diesen kasachischen Raketenübungsplätzen sei er mit beiden Seiten gut
ausgekommen, weil er sie eigentlich mochte, diese raubeinigen Typen auf
sowjetischer und die etwas großmäuligen auf der eigenen Seite. Herbert
meinte, die Lagerverwalter der Garnison würden sich nächstes Mal leichter
überzeugen lassen, wenn sie sehen würden, dass wir sie nicht gleich beim ersten
Versuch betrügen wollten. Ich wandte mich ab. Das war die Höhe. Meine
Fische hatte noch keiner nachgewogen. Wir gaben immer ein reichliches Plus,
außer bei Aalen. Während ich nun ärgerlich und hundemüde am dunklen Ende der
langen Verladerampe stehe und in den matten Lichtkreis hineinstarre, indem sich
zehn Mann traumhaft langsam bewegen, berührt mich jemand von hinten. Ich wende
mich um und sehe den Blitz in den Augen eines jungen Mannes und gleichzeitig
das Aufblinken seines Bajonettes. Dieses Seitengewehres Spitze ragte einen
halben Meter über den mehr als zur Hälfte verdeckten Kopf. „Fifthy, fifthy!”,
raunte mir der in einem großen sibirischen Pelzmantel steckende Wachposten zu.
Er machte einladende Gesten, zog mich mit sich, noch tiefer ins Dunkel hinein,
die kleine Holztreppe hinab. „Da, da! Kaufen!” Er nahm seine
Kalaschnikow, die er geschultert getragen hatte und hielt sie mir hin. Dabei
streckte er die andere Hand unmissverständlich vor. „Njet, njet”, wehrte ich, hilflos vor so viel Großmut, ab. Er
redete von Munition wie ich von kleinen Fischen und alles nur für sechzig Mark.
Für die Maschinenpistole fünfzig und den Rest für die ‚Murmeln’.
Ich machte ein großes Fragezeichen. Wir
befanden uns doch nicht an der tadschikisch-afghanischen Grenze. Als ich
mich von dem munteren Jungen abwandte und ihm den Rücken zukehrte, hatte ich
das Gefühl, dass er mir einen riesengroßen Vogel zeigte. Wie kann man nur so
dumm sein? Eine Kalaschnikow ist doch mehr als zehnmal so viel wert. Begeistert
waren die immer noch mit dem Abwiegen beschäftigten Männer nicht, als ich
erklärte, sie möchten mir nur den Erhalt der Fische quittieren, ich würde jetzt
nach Hause fahren.
„Wie
denn? Fünf Tonnen?” „Ja,
genau, und falls sich ein Minus herausstellt, liefern wir das Doppelte der
Fehlmenge nach.” Herbert Fischer redete auf sie ein, auch er hatte es inzwischen
satt, bloß dazustehen und immerzu nur die sich stereotyp wiederholenden
Schattenspiele zu betrachten. Es ging immer langsamer und wie mir schien im
Zeitlupentempo voran. Lag es nun daran, dass Herberts gutturales Säuseln sie
noch schläfriger machte oder interessierte sie gar nichts? Sie ließen sich aber
auch nicht bewegen die Unterschrift zu leisten. Plötzlich kam ein Offizier an. Ratsch
hatte ich die Unterschrift und batsch den Stempel.
Wir möchten bitte noch einmal zu Oberst
Berlett reinschauen.. Oberst Berlett saß immer noch, die Beine von sich
gestreckt, wie wir ihn verlassen hatten, im Halblicht seiner beiseite gedrehten
Schreibtischlampe und schrieb. Er hätte gehört, dass unsere Fische taufrisch
und groß wären. Er lächelte. Er möchte mit uns in Kontakt bleiben und unser
Kunde werden. „Aber du musst nach Berlin gehen und mit Co-Impex einen
Vertrag machen!” Oberst Berlett, ein vornehmer Typ mit leicht gewelltem dunklem
Haar und exakt gezogenem Scheitel, hätte mich nie ohne weiteres geduzt.
Das machte die Fischerübersetzung.
Co-Impex gab mir einen Termin
Zwei Tage später ging ich, mit gemischten Gefühlen, in dieses
blauweiße Gebäude in der Nähe der Friedrichstraße in Berlin und saß bald darauf
einem Mann gegenüber, der anfangs vierzig sein mochte und etwa eins achtzig
groß war. Wie mir auf den ersten Blick schien, war der da einer, der wusste,
wie man das Leben genießt. Blitzsauberes, hellblaues Oberhemd, dezenter
Schlips. Mir fiel in seinem glattrasierten Gesicht auf, wie gut sein Bartansatz
verteilt war. Er lächelte verbindlich. Du warst ein Stasioffizier, dachte ich. Er war
mir aber keineswegs unsympathisch, trotz alledem. Dieser da, wenn meine
Vermutung stimmte, hatte sicherlich zu den Großen gehört und wahrscheinlich
seinen Teil dazu beigetragen, dass Demokratie für Leute wie mich, vier lange
Jahrzehnte ein unerfüllbarer Wunschtraum geblieben war. Dennoch
differenzierte ich zwischen Programmen und Menschen, obwohl sie in der Politik
oft genug eine Einheit darstellten. Ich wollte beides voneinander trennen und
nur auf die Sache der Diktatur einschlagen. Ich glaubte manchmal, dass
mir dieser eine Satz, den ich so oft dachte, ins Gesicht geschrieben stand. Das
Recht sich frei entscheiden zu dürfen, ist wichtiger als das Recht zu leben.
Der auffallend gut Gekleidete fragte: „Könnten sie sechzig bis achtzig
Tonnen pro Quartal liefern, zu diesem Preis und in dieser Qualität?” Ich
denke, dass es mir gelang meine Miene zu wahren. Denn ich war schockiert. Mein
Hochziel lag bei höchstens einem Sechstel dieser Summe, die er mir genannt
hatte. Ich beeilte mich zu erklären: „Ja, wir können.” Doch ehrlich
gesagt, wusste ich noch nicht, wie das in die Praxis umgesetzt werden könnte.
Berlett muss mit ihm gesprochen haben! Berlett war also zufrieden, er hat uns
gelobt! In mir steckte noch dieser Gedanke an Zusammenarbeit (schließlich
waren wir nordöstlichen Binnenfischer der ehemaligen DDR, ob wir wollten oder
nicht, im Zweckverband ‚Qualitätsfisch der
Mecklenburger Seenplatte’ zu einer großen
Wirtschaftseinheit zusammen-gebunden worden.) Doch das war nun vorbei. Jetzt
war sich jeder selbst der Nächste. Binnen weniger Sekunden hatte ich mir
ausgerechnet, dass die Warener und die Prenzlauer Kollegen wie wir, über
Unmengen Tolstolob verfügten, Silberkarpfen, die kein Deutscher mochte. Sie
würden sicherlich zuschlagen, wenn ich ihnen eins vierzig aufs Kilo bieten
würde, und wir hätten ohne einen Finger krumm zu machen, sechshundert Mark je
Tonne verdient. Das wären ja knapp einhundertund-fünfzigtausend Mark pro Jahr
Nebeneinnahmen. Mensch, Helmut Kohl, lass’ bloß die Russen noch ein paar Jahre
in Deutschland. Wir Fischer würden liebend gern helfen, sie auf deine Kosten,
zu ernähren.
Silberkarpfen, diese fernöstlichen
Algenfresser, die bis zu zwei Meter hoch in die Lüfte springen können - und
dabei gelegentlich ins Boot eines ahnungslosen Anglers - hatten wir auf
Beschluss von Partei und Regierung in unsere Gewässer einsetzen müssen. Müssen!
Jawohl. Mir wurde warm ums Herz, als mein Gesprächspartner bestätigend
nickte: „Bleie und Tolstolob sind ok.” Er wusste also, wovon die
Rede war. Ich sah diese Unmengen Großfische vor mir, die häufig je Stück
mehr als zehn Kilogramm wogen und niemand wusste, wer uns diese hunderten
Tonnen abnehmen sollte. „Was
haben sie uns noch anzubieten?”
„Rotaugen.”
Er nickte abermals und schrieb: Silberkarpfen sowie Bleie, größer 500 Gramm je
Stück und Plötzen aller Größen.
Saß ich im Vorgarten des Paradieses?
Die scharfen Augen meines Gegenübers musterten
mich, ehe er behutsam fragte: „Aber was machen wir, falls die Sowjets
Sonderwünsche haben sollten? ... natürlich in geringem Umfang.” „Kein Problem, wenn es innerhalb eines, sagen wir,
Fünfprozentrahmens bleibt.”
Er winkte ab, war’s zufrieden. Details
interessierten ihn offensichtlich nicht. Die gepflegten, langen Finger
aneinanderlegend schloss der kompetente Vertreter von Co-Impex das Gespräch ab:
„Gut, Sie liefern auf Zuruf jede Woche zunächst fünf Tonnen nach
Neustrelitz.”
Hoffnungsvoll setzte ich hinzu: “Vertraglich
gebunden.” Er schmunzelte. Ich sorgte mich. Vertrauenerweckend setzte mein
Partner hinzu: „Eine mündliche Zusage ist ein Vertrag.” Wie gerne hätte
ich ein Stückchen Papier gehabt, auf dem, was wir ausgehandelt hatten,
niedergeschrieben stand. Es gab also noch eine Hürde.
Die Frage, was das sein könnte, quälte mich. Acht
Wochen lang lieferten wir kontinuierlich aus eigenem Aufkommen. Sogar
Heiligabend fischten wir, aber sehr erfolgreich. Oberst Berlett hatte bis dahin
lediglich zweimal bescheidene Sonderwünsche geäußert. Beim ersten Mal ließ er
uns mitteilen, dass sein General aus Karlshorst käme. Er würde sich freuen,
wenn wir ihm einen Hummer beschafften.
Ich wäre notfalls selbst bis Kiel gefahren,
um ihm den Wunsch zu erfüllen. Bescheidener als Berlett konnte man nicht sein.
Wir schickten ihm zwei Kilo Hummer und legten
drei goldgelbe Räucheraale obendrauf.
Beim zweiten Mal wollte er, für einen
ähnlichen Anlass, einen Karpfen haben. Wir boten ihm an, künftig statt sechs
Prozent Plus nur vier zu geben, aber dafür jedes Mal dreißig Kilo Feinfische
obenauf.
Von da an nannten die Verpflegungsoffiziere
mich “Väterchen Fisch”.
Berlett wurde plötzlich unterrichtet, er sei
zurück in die Heimat versetzt worden. Darüber war er unglücklich. In
Neustrelitz wusste er ein heiles Dach über seinem Kopf. In Russland wartete auf
seine Familie und ihn wahrscheinlich nur eine Scheune. Sein Nachfolger den er
noch einarbeiten sollte, war ein vierschrötiger Kerl, ein Oberstleutnant mit
dem Gesicht einer Bulldogge. Sofort überzog der Mann seine Kompetenzen. Berlett
hätte keine Ahnung. Statt fünf Tonnen sollten wir in der kommenden Woche zehn
liefern. Die erste Sendung am Dienstag, und die zweite am Freitag. Mir war
gleich unwohl zumute. Ich ahnte es. Das geht schief.
Doch der Neue setzte mich unter Druck. Was
sollten wir machen? Oberst Berlett befand sich auf Reisen ins Heimatland, wenn
auch sehr ungerne. Um mir den neuen Mann geneigt zu machen bot ich ihm mehrere
Kilogramm Hummer an und eine kleine Kiste Räucheraale. Mit bissiger Miene
senkte der Oberstleutnant sein Löwenhaupt und knurrte. War ihm das noch zu
wenig?
Bei der darauffolgenden Lieferung winkte er
mir mitzukommen. Da schlug mir schon von weitem ein ekelhafter Geruch entgegen.
Unsere bereits vor einer Woche eingelagerte Ware stand schwarz und unangetastet
in Kisten auf der Leichtkühlfläche. Mir stockte der Atem. Er hatte einhundert
Zentner Speisefische verfaulen lassen. Warum? Selbst dem unfähigsten
Lagerverwalter darf das nicht passieren. Eher verschenkt man die Fische. Seine
breiten Schultern zuckend zog er, wie mir eine freundliche Neutrelitzer Dame
übersetzte, über Berlett her. Ich biss mir auf die Zunge. Vorläufig,
wie ich nun selber gesehen hätte, benötige er keine Fische. Damit drehte er
sich von mir ab und tapste schwerfällig davon.
Sogleich als ich alleine war, redete der
Adjutant des Neuen auf mich ein. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff: Es
ginge ihm um ein Gegengeschäft.
„Wir
verkaufen dir einen Waggon Mehl.”
„Mehl?” „Was soll ich mit dem Mehl anfangen?”
„Na, für
die Brotfabrik!” Die beiden hielten mich ganz selbstverständlich für einen
Banditen. Sollte ich das Berlett petzen? Was musste ich tun, um
wieder zum normalen Handel zurückzukehren? Für uns war es überlebenswichtig
geworden seiner Einheit, in den verbleibenden anderthalb Jahren, mindestens
sechzig Tonnen Tolstolob, Plötzen und Bleie zu verkaufen. Wir verfügten über Kredite
und die mussten mit rund acht Prozent Zinsen getilgt werden.
„An
deiner Stelle würde ich Co-Impex informieren.”,
riet Herbert Fischer mir, als ich ihn aufsuchte um mich zu vergewissern, dass
uns kein Übermittlungsfehler unterlaufen war. Er kratzte seinen Kopf, weil er
keinen bessern Rat wusste. Nächstes Mal ließe er mich nicht wieder allein
fahren. Fernmündlich erteilte Co-Impex mir folgende Auskunft: „Es gibt
einen Strukturwandel. Jetzt schreiben wir Sommer ‘91. Wenden sie sich bitte an
‘Fischexport-import’ in Steglitz. Vielleicht wäre es besser, sie verhandeln
erst mit Wünsdorf. Wir bedauern sehr. Auch uns sind die Hände momentan
gebunden” In Wünsdorf kamen wir nicht weit. Wie Schulbengel standen wir vor
den schwarzen, eisengeschmiedeten Eingangs-pforten zum Park der Allmächtigen.
Links das große gelbe Gutshaus, in das wir nicht gelangen konnten, rechts die
Straße, auf der die Muschkoten entlang paradierten. Ein höherer Sowjetoffizier
kam angeradelt. Auf seinen Wortschwall hin zuckte Herbert mit den Achseln. „Morgen sollst du nach Berlin-Dahlem gehen.”„Morgen?”
„Morgen!” Noch
einmal müsste ich, allerdings aus zwingenden Gründen, auf seine
Dolmetscherdienste verzichten, aber die dort sitzenden Leute verstünden
Deutsch. Dieses Wort ‚Morgen’ war der ganze Ertrag einer Tagesreise von
fast dreihundert Kilometern.
Anderntags, im Bereich Berlin-Dahlem, als ich
das schlichte Schild am versteckt liegenden weißen Haus las, bedrückte mich
bereits die bloße Tatsache seiner Existenz. Es umdüsterte meinen Traum vom
großen Geschäft. Trotzdem ging ich mutig hinein. In einem kleinen Wartezimmer
nahm ich Platz. Ich sah diese harten und bleichen Gesichter nobel gekleideter
russischer Zivilisten, die geschäftig an mir vorbeieilten. Wortfetzen drangen
zu mir. Im Büro des unsichtbaren Dirigenten der Fisch- und Geldströme ging es
um tausende Tonnen. Ich wurde schließlich hereingebeten. Ein untersetzter,
kahlköpfiger Herr mit weißer Weste, der tatsächlich gut Deutsch sprach, saß
halb in sich zusammengesunken in einem schwarzen Ledersessel. „Was haben Sie uns anzubieten?” Ich erklärte es.
Von meinen Tolstolob und Plötzen war nicht
lange die Rede. Ein Blick hin, ein Blick her: „Achtzig Tonnen im Quartal?” Keine
Größenordnung für ihn. Tiefgefrostet könnte man die Dinger quer durch sein
großes Land schicken. „Eine Mark aufs Kilogramm.” Er
wedelte eine Fliege weg. Ich schluckte.
Meine Betroffenheit übersah er
geflissentlich. Die Hälfte steckt er in seine Tasche. 80 000 Mark im Quartal.
Aber immer noch besser als nichts. Seine schwarzen Kugelaugen erstarrten,
während er die für ihn wesentlichste Frage stellte: „Wie viel
Räucherlachse?” Er lächelte, während ich spürte, dass ich langsam errötete.
Mit seiner Geiernase roch er meinen
Widerwillen. Mühsam mich selbst beherrschend überlegte ich. Doch ich war
unfähig auszurechnen, wie viele Räucherlachse ich ihm maximal bieten könnte.
Was würden die Warener, was die Prenzlauer sagen, wenn ich ihnen nur sechzig,
oder achtzig Pfennige für ihre Tolstolob biete? Immerhin mussten sie aufwendige
Fischerei betreiben. Wir selbst hatten unsere Tolstolobbestände bereits
ausgedünnt, rechtzeitig.
Mit welchem Faktor durfte ich noch rechnen,
wenn der da so rigoros den Preis halbierte? Ich müsste erst mit den
Leitern unserer Nachbarfischereien reden und einen zweiten Termin vereinbaren.
Andererseits musste ich ihm jetzt und hier eine nennenswerte Menge Gratisfische
anbieten. Immerhin nahm er uns dreihundertundzwanzig Tonnen Silberkarpfen oder
Rotaugen ab. Es ging, wenn wir andere schwer absetzbare Arten einbringen
könnten um ein erweiterungsfähiges Geschäft von zunächst einer Drittel bis
maximal einer dreiviertel Million Mark Umsatz. Wenn er zurückzog, dann
brachte ich allein unser kleines Unternehmen um die direkte Einnahme von
fünfzig- bis achtzigtausend Mark, - und um wie viel indirekt? Zuerst
musste ich das andere ausrechnen.
„Acht
bis zehn Kilo jede Woche - gratis?” Das
wäre im Verlaufe eines Jahres eine halbe Tonne Räucherlachse, die erst erworben
sein wollten.
Über sein fettglänzendes Gesicht huschte ein
kleines, leicht verächtliches Zucken.
Kalte Wut kam in mir hoch. Du willst jede
Woche mindestens dreißig Kilo Räucherforellen für nichts und wieder nichts
haben? Du
nicht! dachte ich. Mit Gangstern mache ich keine Geschäfte. „So viele habe ich nicht!”, sagte
ich laut und bereute schon wieder, dass mich Emotionen verleitet hatten. Hätte
ich nicht sagen sollen, das muss ich erst überdenken? Mir
schien, dass er dachte: Du Leichtgewicht!
„Hm”, machte er nur, wog den runden Kopf und schüttelte ihn, wie die
Russen zu tun pflegten, wenn sie ablehnten. Ich stand auf oder besser
gesagt, der Ärger erhob mich. Ich hätte am liebsten die Glastür hinter mir
zugeschmettert. Um einhundertsechzigtausend Mark hatte er mich schon geprellt,
bevor von seinen dämlichen Lachsforellen die Rede war. Wir
hörten nie wieder voneinander, noch sah ich jemals den lieblichen Schuppen im
Russenmagazin zu Neustrelitz wieder.
Ein unvorhersehbarer Schluss
Eintrag in den Merkkalender am 5. September 1991: “Der Krieg
zwischen Jürgen N. der Genossenschaft und mir ist zu Ende!” Das
Bezirksgericht Neubrandenburg hatte endgültig gegen ihn, für uns entschieden. Herr Kurschus war mein Anwalt, der mich
wiederholt bremsen musste, wenn Jürgen auf Nachfragen Unwahrheiten behauptete.
Er besaß die Stirn dem Gerichtsvorsitzenden zu sagen, er hätte bei seiner
Pachtung unserer Gewässer zuvor meine Erlaubnis eingeholt. Da sprang ich auf.
Kurschus beruhigte er mich: Lass ihn doch, er hat schon verloren. Das Urteil erging schnell. Jürgen Meyer der
ehemalige und nun weiter amtierende Fischereiverwaltungsbeamte im
Neubrandenburger Großraum, hatte zuvor meinen Fehler ausgebügelt, den ich vor
Altentreptower Gericht beging, indem ich Bewirtschaftungs- mit Pachtverträgen
verwechselte, was dazu führte, dass ich als Fischdieb dastand. Ich musste mich
mühsam an neue Begriffe gewöhnen. Nun lag der Bescheid vor mir. Meine
Frau sagte mir am nächsten Tag: „Ich glaube, Jürgen war hier.” Sie meinte,
sie habe gesehen, wie er vor der Haustür gestanden, geklingelt und dann davon
gegangen sei, noch bevor er sie oder sie ihn hätte ansprechen können, denn sie
kannten einander nicht. Am Abend des folgenden Tages klopfte es an meine Wohnungstür.
Er war es. Hoch aufragend stand er
vor mir. Ich blickte ihn entgeistert an. Er wäre gekommen, um mir zu meinem
Sieg zu gratulieren. Jürgen streckte mir seine riesige Hand entgegen. „Du kannst mir
doch nicht zu deiner Niederlage gratulieren!“ Aber sein Plan sah das vor. Ich dachte: Was für ein Riesenunsinn.
Allein die Idee fand ich absurd, geschweige
denn die Verwirklichung. Wie Kopfjäger hatten wir uns bekriegt und er kommt um zu
gratulieren, weil er unterlag.
„Tritt
ein!” Tief atmend nahm Jürgen im Sessel Platz. Ich starrte auf seinen
Mund. Wie oft mochte er diese Szene in den letzten sechzig Stunden durchlitten
haben? Ein Mann wie er, der nichts tat, ohne es gründlich erwogen zu haben. Härteste
Brocken hatten wir uns gegenseitig in den Weg gelegt.
Ich sei ein Lügner! Er ein
Ehrabschneider. Dass ich vor Jahrzehnten in Prenzlau dreißig Berufsschüler in die
FDJ hineingepresst hätte.
Komisch, was die Leute alles wussten. Tatsächlich
war ich eine Weile angetan gewesen vom Kommunismus, dass ich mich, schnell
vorübergehend, auf dem Weg zu Josef Stalin befand. Natürlich
habe ich damals 25 Aufnahmeanträge von
der FDJ Kreisleitung geholt und sie jedem meiner jüngeren Mitschüler auf die
Klassenbank gelegt und danach eine kurze Rede gehalten. Sogar ein Stalinbild
pinnte ich an die Klassenwand, war ein oder zwei Tage lang drauf und dran
gewesen, in die SED einzutreten. Jürgen schaute sich aus den Augenwinkeln
blickend in unserer Wohnung um. Da gab es, wahrscheinlich zu seiner
Verwunderung, keine Anzeichen von Bigotterie, was er meiner bekannten
Glaubensansichten wegen sicherlich erwartet hatte. Ich
hätte viel darum gegeben, wenn es mir in diesem Augenblick möglich gewesen
wäre, seine Gedanken zu lesen. „Musste das sein?” fragte ich ihn.
Nur einmal zuvor, weit zurückliegend, als er
tief in einer Klemme steckte, - seine Staatsexamensarbeit wurde abgelehnt. Das
sei Lehrlingsgerede. Da habe ich seine
grauen Augen so bescheiden wie jetzt, so bittend gesehen. Ich wies ihn damals darauf hin, dass er etwas
noch nicht Dagewesenes beschreiben müsse und machte ihm Vorschläge… Er kam dann
geradeso durch. Wie damals rührte es mich auch
diesmal wieder an. Ich an seiner Stelle wäre nicht zu meinem Feind gegangen. Aber da saß
er nun. „Ich
wollte...”, begann er stockend. Da
wusste ich alles.
Sein Freiheitsdrang war stärker gewesen, als
seine Vernunft. Den politischen Umsturz habe er als seine große Möglichkeit
betrachtet, endlich wegzukommen von den Zwängen, die ein Leben in einem
Arbeitskollektiv oder in einem Team notwendigerweise mit sich brachten. Er war
nicht geboren worden, um Befehle oder Weisungen entgegen zu nehmen, sondern um
sie zu geben.
Immer stand, bis dahin, einer über ihm, und
darüber noch einer und so fort. Frei sein wollen und nicht frei und unabhängig
sein können, das war sein Problem.
Er hatte den Kampf aufgenommen, jedes Mittel
eingesetzt, auch die untauglichen. Jürgen breitete seine großen Hände aus, die
ich wohl gebunden sah, die jedoch nur unterstrichen, was seine hellen,
unruhigen Augen widerspiegelten. Sie baten darum, dass wir ihm vergeben
möchten. Ich sah, wie tief er bereute, mit dem Schädel gegen die Wand gerannt
zu sein. Ich sah diesen Hoffnungsblink. Jürgen war unbequem und halsstarrig,
groß im Hass und groß genug, sich selbst zu beugen. Weich
kamen die Formulierungen aus dem Kindermund, der mir nicht selten hart und kalt
wie Kieselstein erschienen war.
Lange Jahre hatte er vor mir und nicht nur
vor mir eine Mauer errichtet. Die stand sehr fest. Sie war hoch und breit. Deshalb
war sie unüberwindlich geworden. Lange Jahre hatte er vorgeben wollen, dass
sein Schild und Rüstung, die er sich zugelegt, sein angewachsener und
natürlicher Panzer sei. Dieses
selbstgefertigte Ungetüm hing nun als Ballast
an ihm.
Ja,
ich habe ihn manchmal wiedergehasst. Es war mir nicht leichtgefallen, diese
Gefühle niederzuringen. Auch die anderen Männer hegten starke Abneigung. „Nimmst
du mich wieder?” Einen Augenblick lang wusste ich nichts zu sagen. Hätte
ich Nein sagen können? Aber über das Ja entschied ich nicht allein.
Die neue Genossenschaft war von uns so
strukturiert worden, dass alle Mitglieder dieselben Rechte wie vorher besaßen,
sogar mehr als zu alten Zeiten. Unsagbar schwer würde es werden, die Fischer
davon zu überzeugen, dass er von nun an friedlicher und freundlicher mit ihnen
umgehen wolle.
Wie ein aus einem bösen Traum erwachender
Mann schaute er daher, als ich offen ansprach, was er angerichtet hat. Er
stellte dieselbe Frage, vielleicht weil er annahm, ich hätte sie überhört: „Nimmst
du mich wieder?” Mann für Mann wolle er aufsuchen, zum zweiten Mal, ja, auch das
sei richtig, aber diesmal wirklich geläutert, bekehrt durch großen Schmerz. Ich
kannte ihn. Er würde genauso verbohrt, genau so verbissen, wie er bisher gegen
uns gewütet hatte, diesen unerhörten Anlauf solange wiederholen, bis die versteifte
Wand fiel, und sei es erst beim hundertsten Versuch. Er
konnte gegen alle Logik der Welt anrennen. Etwas anderes als Fische zu fangen -
und darin war er Meister - kam für ihn nicht in Frage. Er
wollte an das Unmögliche glauben, anders war für ihn kein Leben möglich.
Entschlossen allen Hohn und jeden Spott auf sich zu nehmen, war er zu mir
gekommen, allen Zweifel, jedes Bedenken überwindend.
Seiner Frau wegen, die er mehr liebte als
sich selbst, der Zukunft seiner Kinder wegen. Er musste es tun. Nicht eine
Minute lang, nachdem seine Niederlage besiegelt worden war, habe er eine andere
Möglichkeit erwogen. Da musste er durch. Er bitte um Vergebung. Selbst
wenn ich es nicht von Herzen gewollt hätte, nach diesen Worten musste ich ihm
die Hand zur Versöhnung reichen.
Mir war sonderbar zumute, als seine große Hand meine Finger umschloss.
Er wagte ein kleines Lächeln. „Wenn du zu
mir hältst, dann wird das auch was.”
Am drittnächsten Tag wollten wir beraten, was
ich für ihn bei den härtesten seiner Widersacher tun, wen wir für ihn gewinnen
könnten.
Um seinen Wunsch zu erfüllen, benötigten wir
neun Ja-Stimmen.
Es gab diesen dritten Tag nicht, nicht für
ihn. Nachdem er von mir weggegangen war, sprach er viele Stunden lang
mit seiner Frau. Jede Einzelheit seines langen Gespräches mit mir erfuhr sie.
Danach legte er sich zum letzten Mal in seinem noch jungen Leben zu Bett. Denn
anderntags verunfallte Jürgen im Verkehr auf der Landstraße tödlich. Ich
hätte es mir nie verziehen, wenn ich seine dargebotene Hand ausgeschlagen
hätte. Noch nie habe ich auf einer Beerdigung, einen Schlager, gespielt von
einem Orgelorganisten, gehört, aber auch noch nie so beeindruckend eine
schlichte Melodie empfunden wie dieses Lied: „Wenn bei Capri die rote Sonne
im Meer versinkt.” Ich sah ihn die Netze ausfahren und plötzlich mich als
Dreizehnjährigen auf der Ducht des Segelbootes unseres Nachbarn Janzen sitzen,
sah das korngelbe, gebauschte Segel und wie die rote Sonne versank und
erinnerte mich der darauf folgenden Nacht der Schrecken, - der Bombardierung
Peenemündes - die aber nicht das Ende bedeuteten, sondern mir die wunderbare
Einsicht gaben, zu begreifen wie wertvoll jeder Tag ist, an dem wir leben
dürfen, um nach düsteren Stunden wieder und wieder die aufgehende Sonne zu
sehen …
Präsident Dieter Uchtdorf
Während meiner Zeit als Ratsherr in Neubrandenburg (1990-1998) war
ich zugleich Ratgeber versch. Missionspräsidenten. Ab Mitte 1996 klagten die
Missionare über Schwierigkeiten zur Erlangung ihrer Aufenthalts-genehmigungen
in den größerer Städten Mecklenburg-Vorpommerns. Insbesondere war das in
Stralsund der Fall. Da ich mich
naturgemäß oft im Rathaus unserer Stadt aufhielt klopfte ich eines morgens bei
Carlo an, einem Freund. Dieser Mann jedoch war ein eingefleischter
Evangelikaler - Pietist - und keineswegs ein Freund unserer Kirche. (Er war als
Berater aus dem Westen zu uns gekommen.) Er schmunzelte als ich eintrat. Seine
Augen funkelten: ich habe etwas für dich! Selbst mir durfte er nicht alles
sagen und zeigen... und so erhob er sich und ging hinaus, er käme gleich
wieder. Zuvor rückte er ein Blatt Papier so hin, dass mein Blick unweigerlich
auf die Zeilen fallen musste. Es handelte sich um das „vertrauliche“
Rundschreiben Nr. 18-95 des Landesinnenministeriums. Ich war schockiert: Denn es betraf unsere
Missionsarbeit. Sofort war mir klar: Dahinter steckt die Kultusministerin des
Landes Mecklenburg-Vorpommern Frau R. Marquardt, die Ehefrau des Schweriner
Hauptpastors. Es sollte sich sehr schnell herausstellen, dass es so war. Diese Dame hatte bereits zuvor einigen Wirbel
gegen uns verursacht. Nun versuchte sie, unter fadenscheinigen Gründen unsere
Missionare mit gewissen Klauseln, die unter Mitwirkung des Innenministeriums
erarbeitet wurden, aus dem Land zu drängen.
Wie schon angedeutet, hatte Frau Ministerin, mit SPD-Mandat im
Amt, u.a. eine überarbeitete "Informationsbroschüre" herausgebracht,
angeblich um mehr Kenntnisse über Sekten und Weltanschauungsgruppen zu
verbreiten, obwohl sich die „alte“ von 1990 noch kaum im Umlauf befand. Die
Hefte lagen zu Hunderten im Neubrandenburger Rathaus herum.
![]() Beachte den leicht schräg gestellten Aufdruck
: "aktualisierte überarbeitete Neuauflage 95"
Beachte den leicht schräg gestellten Aufdruck
: "aktualisierte überarbeitete Neuauflage 95"
Die Überarbeitung bestand im Wesentlichen darin, ein Kapitel über
"Mormonen" einzufügen, die sie persönlich als ein Dorn im Auge
empfand. Sie versuchte, soweit ihr das möglich war, unsere Kirche als nicht
ungefährliche "Sekte" darzustellen, weil "die Mormonen"
nicht offenlegen, welche Details in ihrem Tempelritual vorkommen. Das ging auch
aus der „Schweriner Volkszeitung“ vom 20. Dezember 1995 hervor. Die Überschrift
lautete: „Wir wollen keine Ängste schüren!“
Frau Ministerin Marquardt wollte kraft ihrer Reputation erreichen,
dass Mormonen mit Argwohn betrachtet werden, oder bereits bestehende Vorurteile
verstärken, was ihr durchaus teilweise gelang. Welch ein Trick. Diesmal politisch untersetzt und auf
Staatskosten. Ich telefonierte mit dem zuständigen Journalisten Herrn Schultz,
der einigermaßen rüde reagierte. Für ihn schien festzustehen, dass am anderen
Ende der Strippe ein engherziger, halbblinder Sektierer steht. Einige
Mitglieder der Schweriner Gemeinde reagierten empört, bestellten die Zeitung
ab… Als Mitglied des
Jugendhilfeausschusses Neubrandenburgs mit CDU-Mandat hatte ich eigentlich den
Ruf eines moderaten Mannes, der mit nicht wenigen PDS-Mitgliedern auf gutem Fuß
stand, und mit denen der SPD ebenfalls. Umgehend suchte ich meinen Freund, den
stellvertretenden OB Neubrandenburgs, Burkhard Räuber auf und sagte ihm
geradezu, ich würde in der nächsten Sitzung der Stadtvertreter mein Amt als
Ratsherr mit einer Erklärung niederlegen. Burkhard, ein aktiver Katholik, schüttelte
sofort den Kopf. Fest stand, dass die Neubrandenburger Presse mich bislang
häufig, etwa zwei-bis dreimal in jeder Woche, seit Jahren positiv zitiert
hatte. Es würde einiges Aufsehen erregen, wenn ich in meiner angekündigten
"persönlichen Erklärung" u.a. sagen würde: „Seit einhundert Jahren
verbot niemand (außer den Kommunisten der sechziger Jahre) unseren Missionaren,
in Deutschland zu wirken. Jetzt, mit der neuen Demokratie, nachdem wir die
Diktatur der Kommunisten überwunden haben, soll meine Religion der Freiheit und
der Rechtschaffenheit verdrängt werden…“ Wahr ist, ich hätte meine ganze
Redezeit ausgeschöpft, und die Presse hätte es im Wesentlichen weitergegeben.
Diese Rede hätte ich sorgfältig vorbereitet. Burkhard wusste das, er
telefonierte umgehend mit Schweriner Beamten.
Ich informierte Präsident
Dieter Uchtdorf, der mir sofort seine Sympathie und ![]() seine volle Unterstützung zusagte und der
mich umgehend bat, mein Mandat nicht nieder zu legen. So fanden wir, Präs. Uchtdorf und ich, uns
kurz darauf, im Frühling 1997, auf die erwartete Einladung hin, im Landes-Innenministerium
in Schwerin zusammen. Zwei Staatssekretäre kamen zu uns. Präsident Uchtdorf
nahm die Gelegenheit wahr, etwa eine halbe Stunde lang mittels eines Bildbandes
beeindruckend darzulegen, was die Lehren und Absichten unserer Kirche sind. Umgehend wurden wir unterrichtet, dass das
Innenministerium M.-V. das besagte Rundschreiben zurückzieht. Das geschah. Dieter Uchtdorf, der die 600 km
weite Anreise nicht gescheut hatte, und ich fuhren anschließend zum
Kultusministerium, um beim zuständigen Staatsekretär H. darzulegen, welche
Richtigstellungen erforderlich wären. Daraufhin vernahmen wir, dass Frau Kultusministerin
Weisung geben würde die glücklicherweise mittig angeordneten Seiten, unsere
Kirche betreffend, entfernen zu lassen
seine volle Unterstützung zusagte und der
mich umgehend bat, mein Mandat nicht nieder zu legen. So fanden wir, Präs. Uchtdorf und ich, uns
kurz darauf, im Frühling 1997, auf die erwartete Einladung hin, im Landes-Innenministerium
in Schwerin zusammen. Zwei Staatssekretäre kamen zu uns. Präsident Uchtdorf
nahm die Gelegenheit wahr, etwa eine halbe Stunde lang mittels eines Bildbandes
beeindruckend darzulegen, was die Lehren und Absichten unserer Kirche sind. Umgehend wurden wir unterrichtet, dass das
Innenministerium M.-V. das besagte Rundschreiben zurückzieht. Das geschah. Dieter Uchtdorf, der die 600 km
weite Anreise nicht gescheut hatte, und ich fuhren anschließend zum
Kultusministerium, um beim zuständigen Staatsekretär H. darzulegen, welche
Richtigstellungen erforderlich wären. Daraufhin vernahmen wir, dass Frau Kultusministerin
Weisung geben würde die glücklicherweise mittig angeordneten Seiten, unsere
Kirche betreffend, entfernen zu lassen
Dieter F. Uchtdorf war damals Chefpilot der Deutschen Lufthansa.
Er wurde im Februar 2008 als Mitglied der Ersten Präsidentschaft der Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage berufen und am 30. Oktober 2012 mit
dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
2004 antworte Präsident Uchtdorf auf unsere, Ingrids und meine,
Gratulation zum Mitglied des Rates der Zwölf:
Zu den schönsten Entdeckungen, die ich je machte, gehört Raffaels Sixtinische Madonna, gemalt 1514.
„Man muss das Originalgemälde mit eigenen Augen gesehen haben“, sagte schon Gogol, der bedeutende russische Autor. „Im 19. Jahrhundert hielt man das Gemälde für das bedeutendste Bild der Dresdener Galerie, und manche Besucher kamen nur seinetwegen.“ Juri Alpatow, ebenfalls Russe und Kunsthistoriker sagte zu Sowjetzeiten: “Seitdem hat sich der allgemeine Geschmack stark verändert, man neigt eher zu einer Geringschätzung des Werkes. Es erfordert eine gewisse Anstrengung vom modernen Menschen, um seinen eigentlichen Wert zu erkennen.” Wahr ist, die grundsätzliche Denkweise hat sich seither sehr verändert. Nicht mehr die Kraft in den Dingen, sondern die Oberflächen sind wichtig geworden. Dennoch ist auch das tiefer liegende immer noch da. Wie ist das möglich, fragte ich mich, dass einige Gramm Farben, von einem Künstler auf ein Stück Leinwand übertragen, solch tiefen Eindruck in mir hinterließen? Immerhin sind es insgesamt nur ein paar Quadratdezimeter Ölfarbe und diese Augen nur ein bisschen Umbra. Zugleich aber wusste ich, dass Raffaels Gemälde allen Inhalt des uralten, ursprünglichen Evangeliums Jesu Christi wiedergibt. Milliarden Menschen, die bereits auf der Erde gelebt haben, und Milliarden weitere, die noch nicht berufen wurden, ihren Platz in einem der für sie bereiteten Körper einzunehmen, blicken mit Spannung auf diesen entscheidenden Moment und Scheideweg in der Weltgeschichte, den Raffael zeigt. Christus, das Lamm, das in die Welt der Wölfe fällt, darf und wird nicht versagen. Nur er kann uns eine glückliche Rückkehr ermöglichen.
Raffael malte dieses uferlose Meer von Geistern. Kopf an Kopf, dicht aneinander gedrängt erleben sie - wir sind es! - den Beginn des wichtigen Lebenslaufes irgendeines Wesens. Raffael zeigt Jesus und uns selbst. Wir sind es, die wissen, dass er uns aus dem Loch herausholen wird, in das wir freiwillig stürzten. Nur er kann uns von Folgen dieses Falls, aus der ewigen Heimat, heilen, den wir uns wünschten, um zu lernen Gut von Böse zu unterscheiden. Wir konnten kaum diesen Teil unseres unvergänglichen Seins erwarten: die Selbständigkeit in der Phase der Sterblichkeit. Wie Kindern erging es uns, die alt genug wurden, um eine eigene Familie zu gründen. Wir drängten fort aus einem schönen Zuhause, in die Welt der unendlichen Möglichkeiten, in der wir uns selbst verwirklichen wollen. Nun da wir, aus gutem Grund, im großen Vergessen leben, kann die Botschaft Raffaels jedem helfen: Ihr seid nicht nur von dieser Welt! Diese Botschaft ist der andere Teil der Software, ohne den der Mensch als fehlprogrammiert erscheint. Zahllose haben ihre Gründe, nicht denken zu wollen, dass wir Doppelwesen sind. Aber was ändert das an der Tatsache, dass wir ein Dasein hatten, bevor wir geboren wurden? Schiller ahnt es, das drückt er mit seiner „Ode an die Freude aus “: „… Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen…“
1832, kurz vor seinem Lebensende sagte Goethe im Gespräch mit seinem Freund und Sekretär Eckermann: „…Diese plumpe Welt aus einfachen Elementen zusammenzusetzen … hätte ihm (Gottvater) sicher wenig Spaß gemacht, wenn er nicht den Plan gehabt hätte, sich auf dieser materiellen Unterlage eine Pflanzschule für eine Welt von Geistern zu gründen. So ist er nun fortwährend in höheren Naturen wirksam, um die geringeren heranzuziehen.” Jacob Moleschott „Anthologie aus der Weltliteratur,“ 1894
Verwunderlich ist, dass zahlreiche Intellektuelle sich mit dem Unterton der Überlegenheit zum Atheismus bekennen, als sei das eine Errungenschaft, denn von unserer Natur aus sind wir allesamt Ungläubige. Eben dasselbe sagt im Buch
Mormon König Benjamin: „der natürliche Mensch ist ein Feind Gottes!“ Mosia Goethe sagte es: „Wenn du es nicht erfühlst, du wirst es nicht erjagen. Schwerwiegende Eingriffe in urchristliche Praxis und Theologie machten aus dem liebevollen, toleranten Christentum nahezu das Gegenteil.
 Cäsaropapisten wie Kaiser Konstantin, änderten zunächst das Gottesbild der Christen, dann das Charakterbild der Kirche, sie musste „…die Wünsche Konstantins, befolgen, obwohl sie sie nicht billigte…Eben so wenig, wie Konstantin Christus erwähnt, ist die (neue) Kirche auf Christusbezogen...“. H. Kraft, Habilitationsschrift „Konstantins religiöse Entwicklung“ Uni Heidelberg - Greifswald, 1954
Cäsaropapisten wie Kaiser Konstantin, änderten zunächst das Gottesbild der Christen, dann das Charakterbild der Kirche, sie musste „…die Wünsche Konstantins, befolgen, obwohl sie sie nicht billigte…Eben so wenig, wie Konstantin Christus erwähnt, ist die (neue) Kirche auf Christusbezogen...“. H. Kraft, Habilitationsschrift „Konstantins religiöse Entwicklung“ Uni Heidelberg - Greifswald, 1954 Er „... machte sich (325, in Nicäa) zum Herrn der Kirche. In ihre Streitigkeiten griff er entscheidend ein und verteilte mit geschickten Fingern Recht und Unrecht. ... im Handumdrehen füllte sich der Hof des Kaisers mit einer Menge von Persönlichkeiten, die mit ihrem Christentum Geschäfte machen wollten. Edlere Naturen konnten neben ihnen kaum noch hervorkommen. (Sie) zogen sich angewidert zurück. Die siegreiche Kirche“ (kam hervor.) Pfarrer E. F. Klein „Zeitbilder aus der Kirchengeschichte“, Berlin, Ackerverlag, 1930
Vor Konstantin glaubten nur wenige trinitarisch, nach ihm wurde es, bis heute geltend, zur obersten Christenpflicht erklärt. Mitglied der „christlichen Ökumene“ zu werden, setzt das Bekenntnis zum „dreifaltigen“ Gott voraus. Aber jede Anerkennung des christlichen Monotheismus ist zugleich Leugnung der „christlichen Wahrheit“. Das Athanasianum, das zu den drei großen Bekennt-nissen der westlichen Kirche gehört, verlangt diese Leugnung mit den Worten:
- „wir (sind) gezwungen, in christlicher Wahrheit jede einzelne Person für sich als Gott und als Herrn zu bekennen,“
- doch „der katholische Glaube verbietet uns, von drei Göttern oder Herren zu sprechen.“
Der „katholische Glaube“ wurde erzwungen: „Seitens des Kaisers Konstantin wurde mit Drohungen und Ankündigung von Repressalien gearbeitet. Jeder Bischof wird einzeln vorgenommen. Ihm wird das Bekenntnis (das Nicänum) vorgelegt und er wird zugleich vor die Alternative gestellt, entweder zu unterschreiben oder in die Verbannung zu gehen...“ Rudolf Leeb „Konstantin und Christus“ – die Verchristlichung der imperialen Repräsentation, Walter de Gruyter, 1992
Die katholische Quelle "Familia Spiritualis Opus" bekennt 2013: „Alles schien in bester Ordnung, jedoch hatten einige Bischöfe nur ein Lippenbekenntnis abgelegt, da Kaiser Konstantin mit der Verbannung jener Bischöfe gedroht hatte, die das Bekenntnis nicht unterschrieben..." Als bekennendes Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage lese ich mit Entsetzen, dass Dumme und Gescheite, Gelehrte und Ungelehrte schwören: „Mormonen sind keine Christen!“ Sie (lehnen) die Lehre von der Dreifaltigkeit strikt ab. Allein diese Tatsache abgesehen von den bisweilen mehr als seltsamen Offenbarungsinhalten, machen deutlich, dass wir es hier nicht mit einer christlichen Konfession zu tun haben.“ 01.04.2012 Pater Hans Peters SVD Pressesprecher Thomas Schneider von der Arbeitsgemeinschaft Weltan-schauungsfragen setzte den Höhepunkt: „Diese Sekte … lehnt die Trinität… ab…. Christen sollten sich in der Öffentlichkeit deutlich von der auch in Deutschland missionierenden Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) und ihren Vertretern distanzieren.“ Sektierer als Gastredner bei Willow- Creek“, 2016
Seit wann darf man das Christsein daran messen, ob jemand trinitarisch glaubt oder nicht? Warum setzen hochrangige Christen das von Christus gesetzte Kriterium für ein „Christsein“ beiseite? Sagte er nicht: „Wer meine Gebote hat und hält sie der ist es…“ Joh. 14: 21 Zahllose Trinitarier neigten seit Nicäa zur Intoleranz. Ihre Gegner waren zuerst die Arianer. Die haben sie verfolgt. Ahnherr solcher Gesinnung war der anscheinend grobschlächtige Bischof Alexander von Alexandria. Um 320 prägt er die Standardparole: „Dem Arius muss man Widerstand leisten bis aufs Blut“ Ernst F. Klein „Zeitbilder der Kirchengeschichte“ Dieses Hasswort wurde zum Todesurteil der Antike. Erst kurz vor seinem Lebensende um 335, vielleicht auch schon früher, leuchtete Kaiser Konstantin ein, dass er Arius zu Unrecht verdammt hatte, inhaltlich und praktisch. Praktisch, weil sein „christlicher“ Chefideologe Athanasius ihm nur Scherereien bereitete und inhaltlich, weil er eben Henotheist war. In Nicäa hatte er sich verrannt. Mehrfach musste Konstantin den wütenden Athanasius wegen Kompetenzüberschreitung und Unruheschürung maßregeln. 336 befahl er - unerwartet - die Versöhnung der Kirche mit Arius. Das passte vielen der Angepassten nicht. Allen voran ging es dem Metropoliten Alexander von Konstantinopel gegen den Strich. Er war gleich nach Nicäa, 325, geistlicher Herr der neuen Hauptstadt geworden und prahlte damit ein guter Orthodoxer zu sein, als ob der angemaßte und frei erfundene Titel "Rechtgläubiger", je Garantie für die Richtigkeit irgendeines Glaubens sein könnte. Sein ganzes Gehabe ähnelte zu sehr den Manieren der Kommunisten die sich selbst für unfehlbar erklärten und die dieser „Unfehlbarkeit“ wegen den 3. Weltkrieg in Kauf genommen hätten. So erheben sich einige Fragen. Darunter die, ob es wahr ist, dass dieser fanatische Metropolit in seiner Basilika zu Konstantinopel laut gebetet hatte: „dass entweder er oder Arius aus der Welt entfernt würden" Sokrates Scholastikus Kirchengeschichte I XXXVIII Unbedingt wünschte der athanasianische Metropolit die unmittelbar bevorstehende Aussöhnung des Ketzers Arius mit der Kirche unmöglich zu machen. Obwohl Kaiser Konstantin sie nun, 336, mit Nachdruck verlangte.
Die moderne Forschung kommt, gegen den noch vorherrschenden Trend, zu folgendem Schluss: „…der Erzketzer Arius ist Traditionalist. Er steht fest auf dem Boden der kirchlichen Lehrtradition." „Kirchen und Ketzer" 2004 mit Unterstützung des norwegischen Forschungsbeirates für Klassische Philologie und Religionswissenschaft, Uni Bergen
Eine Kursänderung Konstantins hätte das damals durchaus noch nicht gesicherte Lehrgebäude des neuen Kirchensystems in seinen Grundfesten erschüttert. Es wäre nicht nur zu einem Paradigmenwechsel, sondern zum Machtverfall der Orthodoxie gekommen. Um die Pfründe gewisser Neukatholiken wäre es geschehen gewesen. Die Sittengeschichte des Trinitarismus wurde mit Blut und Tränen geschrieben. Fanatische Trinitarier trieben mit ihrem intoleranten Benehmen die schwach Gottgläubigen in tiefste Zweifel. Ihretwegen dominierte religiöse Unduldsamkeit sehr lange. Indessen hielt Tertullian, ein Urchrist des Jahres 160, fest: „… ist es nicht gottlos, wenn man jemand die Freiheit der Religion nimmt und ihm die freie Wahl seiner Gottheit verbietet?“ Georg Denzler, „Mutige Querdenker, der Wahrheit verpflichtet“
Toleranz ist göttlich. Selbst die stärkste Liebe leidet, wenn Gewalt ins Spiel kommt. Beständiger Mut zur Wertesuche, zur Selbstkritik und zur Wahrhaftigkeit müssen errungen, dann verteidigt werden. Sie sind Kulturgeschöpfe wie Blumengärten. Nur durch unser, von Jesus Christus gefordertes Zutun, - dem Halten seiner Gebote - können sie und wir bestehen.




























