Gerd Skibbe
Fischerleben – im Wandel der Zeit
Junior Edition Steffen 2006
Impressum
Gesamtherstellung: Junior Edition Steffen, Steffen Verlag, Friedland/Meckl.
2006 Junior Edition Steffen
1. Auflage
www.verlag-steffen.com
ISBN
Eine Korrektur, vor allem wegen einiger kleinerer chronologischer Differenzen erschien mir notwendig
Leseprobe
Fischerleben im Wandel der Zeit - hier als korrigierte Version vom 15. Juni 2017
„Nach durchzitterten Nachtstunden, mit kurzen, ohnmachtsähnlichen Phasen, aus denen Biederstaedt immer erneut hochschreckte, holten sie ihn. Seit langem hatte er sein Wasser lassen müssen. Der Posten verzog keine Miene, als er auf seine Not aufmerksam machte. In dem Zimmer, in das sie ihn brachten, ruhten auf nicht aufgedeckten Ehebetten zwei Offiziere, in Uniform. Sie lagen mit ihren schwarzen, neuen Stiefeln und schliefen. Grelles Licht blendete ihn. Der Dolmetscher fragte, wem er die Pistole abgekauft und wie viel Fische er dafür bezahlt hat.
Seine Erklärungsversuche beantwortete der Mann in Zivil mit Fußtritten. Fritz schaute hilfesuchend nach den beiden Männern, die sich, gleichmäßig schniefend, auf den grünen Steppdecken räkelten.
Auf wen er habe schießen wollen.
Fußtritte.
Er solle die Fragen korrekt beantworten und nicht wie ein Weib lachen.
Schließlich bedeuteten sie ihm, er stünde vor einem sowjetischen Militärgericht und solle endlich die Wahrheit sagen. Zum hundertsten Mal, wie ihm vorkam, antwortete Fritz: „Ich habe Wild gejagt!“
Diese Lügen würden sie ihm schon noch austreiben. Wer unter seiner Führung auf Sowjetoffiziere geschossen hätte. Fritz kniff die Augenlider zusammen. „Sagen sie die Wahrheit!“ Der Zehnerukas sei ihm ohnehin gewiss, so oder so. Er sah ein, es war zwecklos, sich zu verteidigen.“
Die meisten dieser Geschichten hat mir Fritz Biederstaedt erzählt, mit dem ich jahrelang zusammenarbeitete. Nächtelang plauderte er freimütig, während wir gemeinsam an den damals noch üblichen Handwinden standen um das Zugnetz heranzuziehen.
Ich - Gerd, -

bemühte mich, in jedem Detail nahe bei der geschichtlichen Wahrheit zu bleiben. Eingebettet in die dramatischen Ereignisse zwischen 1920 und 1992 kann der Leser nacherleben, wie es nicht nur den Fischern vom Tollensesee erging.
Junior Edition Steffen 2006
www.verlag-steffen.com ISBN
Bereits zuvor hatte ich im Lenoververlag Teil 1 veröffentlicht:
 |
| Foto mit Genehmigung, Luftaufnahme: Tollensesee und Stadt Neubrandenburg |
Sturz in die Inflation
Ein vierzehnjähriger Bengel mit Halbhosen und langen Wollstrümpfen stand wartend vor dem Treptower Tor.
Noch lag die Dunkelheit auf den Dächern der Stadt und der Wind pfiff um die Ecke des vielwinkligen großen Bauwerkes. Von Sankt Marien schlugen die Glocken eine volle Stunde. Sieben Uhr. Gleich musste die dritte Haustür von links aufgehen und der Fischermeister Franz Meltz würde in den matten Lichtkranz unter der Gaslaterne treten. Er würde ein-, zweimal nervös mit dem Kopf rucken, den starken Schnurrbart aufzwirbeln, die beiden Kescher schultern und hinunter zum Tollensebach, zu seinen Fischen und zu seinen Kunden eilen.
Die Tür öffnete sich, der erwartete Mann kam, rückte den Hut zurecht und ging auf den Jungen zu. Fischereipächter Meltz erwiderte den überlauten Gruß mit der unwirschen Bemerkung: „Fritz Biederstaedt, ick hew di all dremol seggt, dat du bi mi nich arbeeten kannst. Du büst noch to spack!“
(„Fritz Biederstaedt, ich habe dir schon dreimal gesagt, dass du bei mir nicht arbeiten kannst. Du bist noch zu dürre!“)
Auf seinen Holzpantoffeln klapperte der Junge hinter dem vorwärtsstürmenden Manne her. Dabei schniefte er durch die auffallend starke Sattelnase. Also würde seine Mutter ihn nach Berlin in die Lehre schicken. Aber hundertmal lieber als hochherrschaftlicher Diener zu werden, würde er zusammen mit den anderen Fischerknechten auf den schönen See fahren, den erfahrene Reisende die "Perle" unter den norddeutschen Seen nannten. Doch Meister Meltz hatte keine Ohren für den Bettler. Ihn belasteten schwere Sorgen. Sein Blick richtete sich auf die dunkel schimmernde Menge Menschen, die vielleicht zum letzten Mal zu ihm gekommen waren, um seine Weihnachtskarpfen zu kaufen. Denn sein zwölftes Pachtjahr für die Neubrandenburger Großfischerei ging zu Ende. Erstmalig würde es einen ernsthaften Mitbewerber geben. Die Bürgermeisterei der Viertorestadt hatte die mehr als zwanzig Quadratkilometer Wasserfläche zur freien Bewerbung ausgeschrieben.
 |
| Bild: Autor Cv ivk "Der Tollensesee" |
Möglicherweise wird ihm die Wanzkaer Fischerfamilie Peters den Rang ablaufen. Der Meistbietende könnte, nach mehr als achtzig Wirtschaftjahren, nicht mehr Meltz heißen, was eigentlich undenkbar war. Nach gutem Weihnachts- und Silvesterumsatz des Jahres 1920 wurde es ernst. Mitte Januar 1921 erfuhr Fischer Meltz, dass sogar ein zweiter Konkurrent aufgetaucht war. Ein Ingenieur aus Berlin namens Johne. Das schlug dem Fass den Boden aus, ein Berliner, dazu noch ein Laie! Damit sanken für den Altpächter die Chancen noch einmal.
 |
| Bild:privat Ernst Peters sen. (ca1890-1953) |
Nachdem Meltz und Peters einige ihrer Gefühle und Gedanken ausgetauscht, gingen sie mit großer innerer Anspannung auseinander, um sich in der Stunde der Entscheidung im Neubrandenburger Rathaus wieder zu sehen. Falls der Stadtrat zugunsten Johnes entschiede, würde Fischer Meltz sich natürlich stärker als die Petersmänner betroffen sehen.
Der vorzeitig gealterte Meltz presste die Fäuste aneinander. In seinem Denken und auf seinem Gehöft war alles auf die Fortführung der Fischereigeschäfte eingestellt. Ernst Peters und Vater dagegen verfügten gewiss nur in geringem Umfang über eigenes Fanggeschirr. Für ihn, den Erben einer erfolgreichen Tradition, war es unvorstellbar, auf neue Weise seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Den Peters dagegen, mit ihrem Geld, stand die ganze Welt offen. Sie würden den Schlag hinnehmen wie einen Klaps von Mutterhand. Er aber würde davon getroffen auf den Boden stürzen. Was wären seine vielen teuren, lieb gewonnenen Gerätschaften noch wert: die Bungen und die Stellnetze, die Reusen und Waden, die Arbeitsboote mitsamt den Pätschen und die Hälterkähne, dazu die Kescher und Stangen? An all dem hingen sein Herz und seine Erinnerungen. Wie oft hatte er beim Schein einer Petroleumlampe bis in die Nacht hinein draußen im Nebel oder in der Kälte gestanden und mit der Holznadel das zerfledderte Eingarn wieder zu einer heilen Netzwand zusammengeflickt, damit die Männer frühmorgens wieder hinausfahren konnten auf den See. Was sollten dann noch diese tausend Kleinigkeiten die Gaffeln und Piekhaken? Wo bliebe er mit den Eisäxten, den Jageruten und den Knüppelwinden, den Eisschlitten, den Leinen, Tauen, Tampen, Ankerseilen? Wohin mit den bereitliegenden Reusenbügeln, dem Netzwerk, den Ledderungen, den Stellnetzblättern, die ihm seine Leute an stürmischen Tagen auf Vorrat gestrickt hatten? Wohin mit dem Katechu, den Teerfässern und den Großkesseln, in denen er die Netze imprägnieren ließ? Welchem Zweck könnte das alles dann noch dienen? Sollte er das ganze Inventar etwa diesem dahergereisten Ingenieur für ein Butterbrot vor die Füße schmeißen? Hatte er dafür ein Leben lang geschuftet? Sollte solche Verschleuderung von Werten der Abschluss seines Lebenswerkes werden?
Auch an seine Leute dachte Fischer Meltz, aber mit Zorn. Weil mit ihnen ihr ungeheurer, unbezahlbarer Erfahrungsschatz dem Berliner sozusagen wie ein Sternentalerregen in den Schoß fiele. Der Großstädter würde auf sie nicht verzichten können und sie würden ihn akzeptieren. Sie wären ihm noch dankbar dafür, dass sie für ihn arbeiten durften. Dieser Gedanke regte den Mann Meltz noch mehr auf als der Seelenschmerz, selbst fortgeworfen zu werden. Nach kurzer Zeit der Umgewöhnung wird sich niemand mehr daran erinnern, dass es ihn, den großzügigen Franz Meltz, je gegeben hatte. Sie werden ihm noch nachreden, dass er sein Lebensglück mutwillig im Alkohol ertränkte.
Wie sich schon vor der für die drei potentiellen Pächter schicksalhaften Ratssitzung herumgesprochen hatte, befanden sich unter den dreiundzwanzig stimmberechtigten Neubrandenburger Stadtverordneten auch drei Kommunisten, die jeder Privatwirtschafterei abhold waren. Das pfiffen die Spatzen von den Dächern, dass diese drei Utopisten sich einbildeten, sie selbst könnten eine Fischermannschaft aus Arbeitslosen zusammenstellen. Da war der eine und der andere mal mit hinausgefahren und hatte ins Fanggeschäft hinein gerochen. Sie glaubten ganz einfach, man nehme ein Zugnetz, werfe es im See aus und schon würden sich große Fischschwärme überlisten lassen. Diese Phantasten wollten den „Raub”, wäre er ihnen denn zugefallen, einfach an die Stadtarmen und Notleidenden verschenken! Als ob die Welt existieren könnte, wenn man auch die vor Energie strotzenden Kerle durchfüttert. Darin war Peters mit Meltz einer Meinung gewesen, dass die Jungen mit ihren kräftigen Armen hingehen und sich ein Stückchen Wiese urbar machen sollten. Statt in den Straßen und Plätzen herumzulungern und zu schielen, ob ein „reicherer“ als sie, einen Zigarettenkippen wegwirft, sollten sie Kartoffeln und Erdbeeren anbauen. Fischer Franz Meltz ahnte, dass sich mehr Ratsherren als diese drei Kommunisten gegen ihn verschworen hatten.
Sogar einige, die ihm bisher gewogen waren, könnten sich mit ihren Hintergedanken dem neureichen Peters zuwenden. Bloß um ihn zu ärgern und um ihm zu beweisen, über wie viel Macht sie als Deputierte des Volkes verfügten. Im Grunde gab es keine Argumente gegen ihn. Sie könnten ihm gut und gerne noch einmal, nur dieses eine Mal noch, den Tollensesee und dazu die ihm
vorgelagerte flache Lieps mit ihren vierhundert Hektar Wasserfläche verpachten. Dann mag geschehen was will. Hatte er nicht bewiesen, die Pachtsumme pünktlichst zahlen zu können? Waren sie nicht allzeit gut mit ihm gefahren? Der Unterschied der Gebote war bedeutungslos. Es liefe rein logisch gesehen auf dasselbe hinaus.
Aber sein Gefühl sagte ihm, dass er sich solcher Hoffnung nicht länger hingeben sollte. Nun, da nach der Revolution alles anders geworden war, musste auch in der Fischerei eine Änderung herbeigeführt werden. Egal, ob es sinnvoll war oder nicht. Das war eben diese verrückte Nachkriegswelt, die törichterweise glaubte, dass alles Neue besser ist als alles Alte. Deshalb zogen die Kerle auch so vehement das frische Menschenfleisch dem alten vor. Das wusste Franz Meltz an jenem Morgen des 22.Januar 1921 wenige Stunden vor Beginn der Plenartagung so sicher, wie er wusste, dass man einen Mann und sogar die ganze menschliche Gesellschaft zwar auf den Kopf stellen aber damit wahre Besserung nicht erzielen kann. Nur anders wird es sein, sehr viel anders. Den verlorenen Krieg überstanden, fiel er nun erst - wie paradox - ins größere Elend. Ihm war es, je länger der Krieg gedauert hatte, jedenfalls in materieller Hinsicht immer besser ergangen. Sie hatten ihm nach 1916, nach der verlorenen Schlacht an der Somme in Frankreich, jeden, auch den minderwertigsten Fisch, geradezu aus der Hand gerissen. An der Front aßen sie nach Neujahr 1917 Margarinestullen mit ekelhafter Marmelade, in der Heimat Wrukensuppe. Welche Delikatesse war dagegen ein Gericht aus gebratenen, sauer eingelegten Plötzen gewesen. Jede Karausche, selbst jeder Grätenblei war Goldes wert in einer Zeit, da es an Stelle von Kolonialwaren nur noch glasige Kartoffeln und höchstens Gerstenschrot auf Lebensmittelkarten gab, die immer kleiner wurden .
Böse Gefühle beschlichen den Mann mit dem Faltengesicht, als er auf seine Weise ahnungsvoll aufs Rathaus zuging.
 |
| Bild Wikipedia, das damalige Rathaus, 1945 vernichtet |
Als Franz Meltz seinem Konkurrenten Ernst Peters die Hand zum Gruß reichte, glaubte er noch befürchten zu müssen, dass das große Fischerglück sich diesem Johne zuwenden würde. Aus vollem Herzen und mit wüsten Ausdrücken fielen sie brüderlich vereint noch einmal über den vermutlich unfähigen Ingenieur Johne her. Zum ersten und letzten Mal in ihrem Leben machten sie sich gegenseitig Mut. Denn der wenig später erfolgende Beschluss der Ratsversammlung lautete: Peters vor Johne. „Denn man tau“, erwiderte der zutiefst verletzte Altpächter, nun auch des Trostes beraubt, im Unglück nicht allein zu sein, „se warn dat schon moken. Ewer wenn se glöben, dat de Bli goldene Flossen hem, denn irrn se sick.“ („Dann man zu, ...sie werden das schon machen. Aber, wenn sie glauben, dass die Bleie goldene Flossen haben, dann irren sie sich.“)
Und er sagte noch etwas, an sich selbst gerichtet: „To spack, Franz Meltz Hunnertundachtzig harst du beden müßt! To spack!“ ("Zu dürre, Franz Meltz! Hundertachtzig hättest du bieten müssen! Zu dürre!“)
Die Bleie hatten nie goldene Flossen gehabt. Aber wenn Peters sie damals gleich gefangen hätte, schon im ersten oder zweiten Bewirtschaftungsjahr, dann wären sie nicht einmal ihren Namen wert gewesen. Ein Großfang hätte ihm wenig genutzt, solange der Geldwert instabil war. Der Krieg hatte seinen Preis; die Revolution von 1919 ebenfalls. Das Resultat beider Ereignisse war die Inflation. Zusätzlich verheerend sollte sich die Missernte von 1920 auswirken. Statt der erwarteten Brotgetreideernte von 2,3 Millionen Tonnen gelangte lediglich ein Viertel der lebensnotwendigen Menge auf den Binnenmarkt. Irgendwie musste deshalb seitens der Regierung eine Möglichkeit gefunden werden, um die Fehlmenge irgendwo in der Welt billig einkaufen zu können. Der sowieso schon schwer angeschlagene Finanzhaushalt Deutschlands musste abermals überrechnet werden. Eigentlich müsste ein Brot nun vierzehn Mark kosten. Doch die großen Politiker wussten, dass sie das nicht zulassen durften. So subventionierten sie es, und die Hausfrauen bekamen es - zunächst noch -für Viermarkfünfzig. Das aber verschlimmerte die Finanzsituation im Großen. Ernst Peters musste mit der Preisentwicklung Schritt halten. Dem kleinen Mann erschien die Lage schon damals nur schwer erträglich zu sein. Doch das war erst der Anfang vom großen Elend. Denn noch sahen die mittleren Produzenten und die Händler die eigentlichen Gefahren zum Glück nicht so deutlich. Man hatte ja Geld in den Fingern. Die zunächst noch von den mit Zahlen bedruckten Papierfetzen hervorgerufene sonderbare Illusion verursachte, dass sich die Deutschen wieder „hochrappelten.“ Ein gewisser Optimismus lag in der Luft. Das sahen die Spitzenpolitiker Frankreichs und Englands mit Neid, und dieser Neid sollte weitere böse Folgen zeitigen. Als Siegermächte fassten sie im Januar 1921 einen für alle Deutschen verhängnisvollen Reparationsbeschluss. Unsere einst so übermütige Nation, von ihren geistigen und geistlichen Führern in den Kriegsrausch getrieben, hatte nun für ihre Sünden zu zahlen; für Verdun, für Lüttich, für ihre gewonnene Schlacht bei den masurischen Seen gegen Russland.
Insgesamt brummte das Welttribunal den Deutschen die ungeheure Strafe von zweihundertundsechsundzwanzig Milliarden Goldmark auf. Zahlbar bis 1963, jahraus, jahrein anteilig. Der Betrag sollte in Goldmark und in Naturalien, Steinkohle und Handelswaren geleistet werden, später nach Auflagen. Noch in diesem Schicksalsjahr 1921 waren zwei Milliarden fällig. Das drückte gewaltig auf die Hauptschlagader der deutschen Volkswirtschaft.
Die Arbeiter der Neubrandenburger Baustofffirma Jäger streikten, weil sie mit ihren neunhundert Mark Monatslohn nicht mehr auskamen. Sogar die Fischerknechte muckten auf. Jede Familie mit zwei oder drei Kindern, und das waren die meisten, die Ende 1921 weniger als Zwölftausend im Jahr zur Verfügung hatte, litt große Not.
Vor dem 1. Weltkrieg verdiente der in der Stadt lebende mecklenburgische Arbeiter in der 60-Stunden-Woche etwa fünfundzwanzig Mark. Aber er konnte sich sein Bier leisten, sonntags sogar zwei Flaschen. Und je mehr er sich leisten konnte, umsomehr Brauereiarbeiter fanden eine Beschäftigung. Dasselbe Rad konnte allerdings zum Teufelsrad werden, wenn es sich rückwärts drehte. Vor dem Krieg hatte jeder kleine Mann seinen Sonntagsanzug. Wobei er für fünfzig Pfennige Anzahlung vom Neubrandenburger Juden Rosenstein schon einen Billiganzug erwerben konnte, der schließlich nicht teurer als dreizehn Mark war.
Selbst die ärmste Fischerfrau besaß vor den schlimmen Jahren ihr Ausgehkleid, ihren Hut und für Wintertage ihren Muff. Nun hätten sie den zwanzig-, dreißig-, hundertfachen Betrag für dieselbe Ware hinblättern müssen. Damals kostete eine Flasche Kulmbacher Bier zwanzig Pfennige, nun war sie unerschwinglich geworden. Die Arbeiter saßen nach Feierabend mit gemischten Gefühlen in den Gasthäusern und trauerten der guten alten Zeit nach, als ein Ei noch für einen halben Groschen und ein breitrückiger Matjeshering für zwei Groschen zu haben war. Nun kostete derselbe Fisch, wenn es ihn überhaupt gab, sechs Mark. Sie fluchten auf die Ausbeuter und auf den Staat. In ihrer Trunkenheit gifteten die Männer einander an, und zu Hause bekamen die Kinder Dresche für etwas, das sie nicht verschuldet hatten.
Die Reparationsleistungen und die schlechten Ernten (auch infolge einer verfehlten Landwirtschaftspolitik) rissen in das Staatssäckel ungeheure Löcher. Der diamantharte Dollar minderte den Tausch- und Realwert der Reichsmark, von Tagesschwankungen abgesehen, unaufhörlich.
Zu alledem fasste das Reichsgericht den verhängnisvollen Spruch: eine Mark ist eine Mark. Ein Gläubiger, der 1914 eintausend Goldmark verliehen hatte, musste 1922 mit der Rückzahlung eines wertlosen Tausenders plus der Zinsen zufrieden sein. Wer vor dem
Krieg die glatte Summe von zehntausend auf seinem Konto stehen hatte, besaß in Wahrheit noch, sage und schreibe, fünfunddreißig Mark. Den Großen passierte das nicht. Die waren rechtzeitig in holländische und dänische Währungen geflüchtet. Unter diesen Zwängen leidend, musste jeder Finanzplan wie eine leergesaugte Hülle ihre Form verlieren und zusammenfallen. Jeder Laie konnte voraussehen, dass dieser zähe Ball, in seinem Bestreben, sich wieder herzustellen, den Schwächsten die Atemluft nehmen würde. Wohl denen, die auf dem Lande lebten, oder wie die Fischer, auch wenn sie bloß als Knechte schufteten, sich zusätzliche Nahrungsquellen erschließen konnten und sei es auf illegale Weise.
So zog das Jahr 1923 wie eine schwarze Gewitterwolke herauf. Die psychologischen Folgen der Angst vor einer galoppierenden Inflation wirkten sich schließlich als Katastrophe aus. Das plötzliche Misstrauen des Mittelstandes, die staatliche Finanzpolitik sei auf Täuschung der Öffentlichkeit aufgebaut, reizte und peitschte die Nerven aller. Vorsicht trieb die Händler zu überzogenen Reaktionen. Das künstliche Finanzgefüge brach zusammen. Eine Schachtel Streichhölzer, 1910 für einen einzigen Pfennig zu erwerben, kostete im November 1923 schließlich fünfundfünfzig Milliarden Mark. Selbst kleinere Fabriken mussten, um das Geld zur Löhnung ihrer Arbeiter transportieren zu können, Pferdefuhrwerke zu den Banken schicken. In sechzig deutschen Notendruckereien spuckten die insgesamt 1723 Druckmaschinen pausenlos Geldscheine mit astronomischen Zahlen aus. Tag und Nacht liefen die Aggregate der Papierfabriken. In dieser Zeit der Verschärfung der Konflikte warnte der Utah-Senator Reed Smoot den amerikanischen Kongress davor, den Bogen zu überspannen. Smoot erklärte, Deutschlands Bürger könnten durch die maßlosen Forderungen der Allierten ihren Reparationszahlungen pünktlicher nachzukommen, in die Arme von Chauvinisten getrieben werden.
In einigen Orten wurde Notgeld gedruckt. Es löste die Probleme nicht. Weiterhin überschwemmten die bunten Inflationscheine den Markt.
Wer einen einfachen Brief verschicken wollte musste zuletzt 20 Milliarden Mark auf den Tisch einer Deutschen Postfiliale legen.
 |
| Bild Wikipedia |
Einmal hieß es: ”Gebt die blauen Geldscheine nicht aus” ein andermal: “Behaltet die roten, die werden demnächst aufgewertet.”
Ernst Peters kam trotz alledem einigermaßen zurecht. Seine „Massenfische“ - Plötzen, Plieten -, die seine Kunden in guten Jahren kaum anschauten, konnte er verhältnismäßig günstig verkaufen. Wenn alles wankte, seine Reusenpfähle auf den Fangplätzen standen fest. Seine Maxime lautete, solange der Wert der Geldscheine unbestimmt ist, gilt es, sich sofort von diesen Papieren zu trennen. Die Summen vom Vormittagsverkauf setzte er mittags in unverderbliche Waren um, die der Markt gerade anbot. Es schien, als wollte ihn das Schicksal für solche Umsicht belohnen. Da gab es am Oberbach eine herrliche Villa, die gehörte dem Juden Heimann. Sonderbarerweise war Herr Heimann davon überzeugt, dass die blauen Scheine nach dem Währungstohuwabohu Zahlungsmittel sein würden. Zweitens hegte er die Absicht auszuwandern, weshalb er schnell viel Geld benötigte.
Heimann bot dem Fischermeister das sehr geräumige Haus samt Garten zu einem schauderhaft klingenden Preis an. Soundsoviele Billionen in blauen Scheinen.
Ob das sein Ernst sei? Der Jude nickte. Er habe den Eindruck, die Villa stünde am falschen Ort. In Amerika müsste sein Haus stehen. Er könne seine Befürchtungen nicht in Worte fassen, aber in Deutschland liege seine Zukunft nicht. Deshalb sei er entschlossen, sofort davonzugehen.
Ernst Peters fragte sich, ob er träume oder wache und ob sie das Geschäft denn auch sofort abschließen könnten.
Herr Heimann nickte abermals Zustimmung. Großfischereipächter Ernst Peters begab sich nach Hause. Er eilte, er stürzte durch die Stadt heim und konnte mit dem Verkäufer eine Stunde später einig werden. Heimann, offensichtlich von irrationalen inneren Zwängen getrieben, unterschrieb und Peters hielt sich für einen Liebling der Götter. Bei der Besichtigung des Grundstückes stellte er fest, dass die Stallungen, das nahe Bollwerk, sowie sämtliche Umstände für ihn und seine Zwecke wie geschaffen waren. Nur die Erlenbäume am Bach störten ihn. Dass Peters die Bäume fällen lassen wollte, wurde in der Stadt bekannt. Alle, die den Spaziergang am malerisch schönen Oberbach entlang zum nahen See liebten, wandten sich hilfesuchend an die Stadtoberen. Die Ratsherren zuckten mit den Achseln. Protestierend stellten sich ein paar beherzte Männer vor die Bäume. Doch Fischer Peters beharrte darauf, dass er mit seinem Eigentum tun und lassen könne, was er wolle.
„Das kannst du nicht, Herr Großmaul!”, schimpften die Verteidiger des gefährdeten Panoramas. Sie erregten die Stadtbevölkerung. Allerdings war der ganze Wirbel umsonst. Rigoros setzte Ernst Peters seinen Willen durch. Krachend stürzten die Erlen zu Boden.
Dass er, wenig später, unmittelbar nach der Grundbucheintragung einen Holzpantoffelmacher fand, der ihm für diese Erlen gerade die Summe bot, die er selbst insgesamt für den Erwerb des Grundstückes aufgewandt hatte, war eine ihm selbst geradezu unglaublich erscheinende Tatsache. Danach schrieb der ehemalige Rekrutenausbilder in sein Bewusstsein den Satz: Ich bin der Größte!
Er zog aus der Katharinenstraße aus einem schönen Wohnhaus in seinen neu erworbenen Palast in Seenähe.
Er ahnte nicht im Mindesten, dass bittere Monate und Jahre vor seiner Tür standen.
Fürs Erste war er obenauf. Er erwarb für eine handvoll nicht gerade hochwertiger Fische Kutschen und Kaleschen, Pferde und nagelneue Ledergeschirre. Seine Leute spotteten, er ginge unter der Last des Glücks schon breitbeinig.
Was wollte ihm das Schicksal nun noch anhaben? Das Beste des Lebens fiel ihm selbstverständlich, wie Regen dem Acker, zu. Doch als wollte ihm eine unbekannte Macht beweisen, dass die Gerüchte von der realen Existenz einer ausgleichenden Gerechtigkeit mehr sind als Fiktionen der Nervenschwachen, schlug das Schicksal aus dem vollen Lauf heraus unerwartet einen scharfen Haken.
Die Nachwehen der bald überwundenen Inflationszeit, kombiniert mit Fischerpech, sollten ihn noch an den Rand des Wahnsinns treiben.
Ursache war der Gedanke eines Finanzgenies. Dieser Jemand war auf die tragfähige Idee gekommen, eine Währungseinheit zu schaffen, die durch auf Gold lautende Rentenbriefe gedeckt wäre. So kam die berühmte Rentenmark in Umlauf. Hausfrauen konnten ein Brot wieder für einen Preis unter einer Mark erwerben. Die Arbeiter mussten den sauerverdienten Wochenlohn nicht mehr in der Aktentasche oder in einem Wäschekarton nach Hause schleppen. Diese Wendung sollte das Überleben der großen Bevölkerungsmehrheit wieder bezahlbar machen.
Schlagartig minderten sich dagegen die Chancen für Glücksritter aller Schattierungen. Die Pächter von Feldern und Seen mussten zu ihrem Leidwesen nach 1924 wieder in bar zahlen. Das tat ihnen sehr weh. Für Ernst Peters bedeutete dies, für zwölftausend Rentenmark Fische zusätzlich verkaufen zu müssen. Er stöhnte laut, als ihn diese Normalität einholte. Außerdem fingen seine Männer im Jahre 1925 miserabel. Sie fingen entschieden zu wenige Fische.
Schon bald, ab Mitte 1926, musste er kurzfristig bei Bekannten und Freunden Geld leihen. Und nur wenige Monate später mahnte ihn schon der Bürgermeister, pünktlicher seinen Verbindlichkeiten nachzukommen.
Seinem Ärger über diese Aufforderung zur Zahlung machte er an der falschen Stelle Luft. Wadenmeister Jan Schlämann, den er mitsamt seinen wertvollen Fängererfahrungen von seinem Vorgänger übernommen hatte, kratzte sich ratlos das Kinn, als er die rüden Vorwürfe des unter zunehmendem Zahlungsdruck stehenden Pächters hörte. Das war leicht gesagt, gefälligst mehr und bessere Fische vom See heranzubringen. Peters belehrte Jan Schlämann in ungerechtfertigt harschem Ton. Die Bevölkerung drehe jetzt jeden Pfennig dreimal in der Tasche um, ehe sie ihn ausgebe. Mit ihren spitzen Fingern wühlten die Hausfrauen mäkelnd wie noch nie in seinen Fischkisten herum. „Se hem ja blot Wittfisch!“(„Sie haben ja bloß Weißfische!“)
Er sei ein Plietenfischer!
Das war eine schwere Beleidigung. Schlämann allerdings gab zu, er brächte in letzter Zeit vom Tollensesee überwiegend Plötzen und immer weniger Fische heim, aber er müsse sich und seine Männer deshalb jedoch noch lange nicht beschimpfen lassen. Von Peters nicht und von niemandem. Sie wären fleißiger denn je. Das sei doch keine Bewirtschaftung des Tollensesees gewesen, was sie in letzten sieben Jahren betrieben hätten, sondern Raubbau auf Pächters Befehl hin. Er habe ja den Rachen nicht voll genug bekommen können. „Disse Frechheit hew ick nich hürt!“(„Diese Frechheit habe ich nicht gehört!“entrüstete sich Ernst Peters. Doch Schlämann konterte, immer noch ruhig: „De Uprägung steiht sei ditmol nich an!“ („Die Aufregung steht ihnen diesmal nicht zu!“)
Und überhaupt verlange er für sich und die Männer mehr Geld. Mit dem Kopf auf die Villa weisend, meinte er, so schlecht ginge es Peters ja nicht. Es wurmte ihn seit langem. Der Rekrutenschinder saß in dem schönen Haus wie ein Schwan auf seinem sturmsicheren Nest und sie waren bloß dazu da ihn noch hochmütiger zu machen. „Aach! Dorher weiht de Wind!“ ("Ach! daher weht der Wind"), jaulte der Getroffene. „Dorher weiht de Wind!“, echote Schlämann, ausnahmsweise unbesonnen. Beide Männer setzten zeitgleich einen Schritt aufeinander zu. Fast hätten sie sich berührt. Zum ersten Mal standen sich der raubeinige Exrekrutenausbilder und sein langer Gentlemanfischer ungewollt erhitzt, Aug‘ in Auge gegenüber, bereit zu handfester Auseinandersetzung.
Die Stimmung erschien den Fängern unerträglich. Ausnahmslos hielten sie zu ihrem Wadenmeister.
Wenn der Pächter nicht sofort das Maul hielt, passierte ein Unglück. Falls Peters Faust auch nur zuckte, würden sie ihm bedenkenlos an die Gurgel springen. Die große Geschäftigkeit täuschten sie nur vor.
Bis es plötzlich wie ein Peitschenschlag in sie hineinknallte: „Wenn juch dat bi mi nich passt, denn söcht juch annere Arbeit!“andere Arbeit!" ("Wenn euch das bei mir nicht passt, dann sucht euch andere Arbeit") Den überraschten Männern ging der Mund auf. Sofort war ihnen klar, dass ein Hinauswurf Dauerarbeitslosigkeit bedeutete.
Peters sah befriedigt, dass dieser Hieb gesessen hatte. Wäre er gescheit gewesen, hätte er sich vorsichtig umgedreht und wäre zurück ins Haus gegangen. Mehr als diese Nachdenklichkeit konnte er nicht zuwege bringen. Übermütig jedoch fasste er nach. Viel zu schnell. Er erwarte, dass sie, solange sie sein Brot verzehrten, untertänig parierten. Ab sofort wünsche er, dass sie täglich einen Fischzug mehr machten, also vier statt drei und zwar für dasselbe Geld.
Das war zuviel. Mit dieser Provokation hatte er die Grenze überschritten. Schlämann reckte sich. Jetzt musste er handeln. Das gebot ihm die Selbstachtung. Seine Leute, die gerade den ungewöhnlich guten Liepser Nachtfang aus dem Schweff gekeschert hatten, standen immer noch wie erstarrt. Zwölf Kisten voller großer Bleie und Hechte, die sie in der Nacht gefangen hatten, bezeugten ihren Fleiß. Es lag eine Dringendbestellung aus der Küche der Artilleriekasernen vor. Schlämanns redlicher Überzeugung nach hätte der Pächter dankbar und versöhnlich sein sollen. In diesen Sekunden der Hochspannung hörte man nichts als das Poltern der gegen die Kistendeckel schlagenden, vergeblich um ihr Leben kämpfenden Fische. Peters, der schon glaubte das Machtwort gesprochen zu haben, meinte plötzlich seinen Augen nicht zu trauen. Sein Wadenmeister ging, hob eine der gefüllten Fischkisten und schüttete den zappelnden Inhalt zurück ins freie Wasser. Er nahm, ehe Peters herankam, eine zweite Kiste und schüttete sie ebenfalls aus. Die kräftigen Fische schlugen mit den Schwänzen. „Jan!“ schrie Neumann. Schlämann drehte sich ruckartig um. Ernst Peters hielt einen Kescherstiel schlagbereit. Die grauen Augen des Wadenmeisters warnten ihn dringend. Peters musste auch die Blicke der sechs Männer spüren, die ihm Funken ins Genick sprühten. Der Fischereipächter erkannte, dass sie den Verstand verloren hatten und dass es plötzlich ums nackte Leben ging. Seine Autorität aufs Spiel setzend rannte er weg. Vor der Haustür stoppte Peters jäh, drückte das Kreuz durch, wandte sich um. Markerschütternd schrie der Gedemütigte: „Jan! Kommens in min Büro!“("Jan, kommen sie in mein Büro!") Er glaubte oder hoffte wenigstens, mit dem letzten aller tauglichen Mittel dem stolzen Mann bei zu kommen. Die Papiere würde er ihm vor die Füße schmeißen und gleich ihm den anderen unbotmäßigen Fischerknechten.
Theater war es.
Auf beiden Seiten. Ein zähes Ringen. Sie konnten aufeinander nicht verzichten.
Schlämann gab zähneknirschend nach und sagte atemringend: „Meisting, loten se dat man good sünd. Wie willn uns doch nich vertürnen.”("Meister, lassen sie es gut sein, wir wollen uns doch nicht verzanken.") Auch Peters gab nach. Am nächsten Fangtag äußerte er einlenkend, drei gute Fischzüge wären besser als vier schlechte. Der soziale Friede war vorübergehend gerettet.
Vom leichten Anstieg des Lebensstandards 1928 bemerkten die Menschen vor allem in den ländlichen Gegenden wenig. Strümpfe, Nahrungsmittel, Schuhe waren billig. Aber die wenigen Groschen, die sie verdienten, rannen wie Wasser durch die Finger.
Im Dezember 1924 hatte es zum ersten Mal nach dem Krieg eine Million Arbeitslose gegeben. Ende 1928 waren es, nach kurzzeitiger Besserung, schon über drei Millionen, die teilweise in langen Schlangen vor den Arbeitsämtern anstanden. Man ging „stempeln”, empfing Arbeitslosenunterstützung. Hunderte Neubrandenburger Familienväter bekamen wöchentlich 6,25 Mark Arbeitslosengeld. Davon konnten sie sich keine Butter und nur selten Frischfische leisten. Allein die Miete verschlang mehr als die Hälfte des Geldes. Nicht wenige Raucher schämten sich, dass sie ihrer Frau die letzten fünfzig Pfennige stahlen. Da half alles Jammern nicht.
Wer noch eine Arbeitsstelle hatte, biss die Zähne zusammen.
Aufstieg mit Schmerzen
Statt ihnen mehr zu geben, beschnitt Peters wieder einmal das Deputat seiner Leute. Denn auch er musste mehr denn je rechnen. Dennoch ging keine seiner vielen Kalkulationen auf.
Wenn sie ihn weit weg wussten, verfluchten die Wadenfischer den alten Geizkragen. Allerdings in seiner Haut stecken wollten sie auch nicht, währenddem er richtig vermutete, dass sie ihn beklauten.
Ehrlich gefragt, war das Diebstahl, von den Massen selbst gefangener Fische, die Mutter Natur wachsen ließ und nicht Meister Peters, sich zusätzlich ein paar Stück einzusacken, damit die Mäuler daheim und die große, erwartungsvolle Verwandtschaft gleichfalls nicht klagten? Mit den Peterschen Bettelpfennigen konnte man einfach nicht durchkommen. Es gab kein Erbarmen in diesem Kampf ums Dasein. Auch die Stadtväter kannten keine Gnade mit dem zahlungsunfähigen Pächter des Tollensesees. Sie schickten eine Zahlungsaufforderung nach der anderen. Denn ständig war des Kämmerers Kasse leer. Dabei wollte jeder am vermuteten Reichtum der gewachsenen Stadt teilnehmen.
Hoffnungsvoll richteten sich die Blicke aller Mütter auf die Zukunft. Denn so konnte es nicht weitergehen. Andererseits fielen in jedem Herbst der ausgehenden Zwanziger mit den Blättern auch die Hoffnungen. Viele verloren den Glauben, dass es je wieder so schön wie vor dem Krieg werden könnte. Immer wieder hatten sie die Kinder am Heiligabend vergeblich vertröstet, im nächsten Jahr ginge der Weihnachtsmann nicht wieder an ihrer Wohnungstür vorbei, sondern würde dann mit einem großen Sack voll guter Gaben hereinkommen. Und nun? Die Ungewissheit wuchs. Zu den wenigen Gewissheiten für die jungen Frauen gehörte die nächste Schwangerschaft. Ernst Peters musste sich erneut bei Privatleuten Geld borgen. Im Vertrauen darauf, dass sich der Fischreichtum wie eine Goldader im eigenen Claim vor seinen Füßen befinden würde, gingen einige der besser gestellten Neubrandenburger das Risiko ein und gaben ihm zu ihren Bedingungen, was er verlangte. Da brach aber nach allem Ungemach das ganz große Unglück herein. Nach einer Periode erträglicher Wintertemperaturen kam Mitte Januar 1929 für alle eine böse Überraschung. Plötzlich wälzten sich über Nordeuropa und Deutschland extrem kalte Luftmassen. Viele hatten schon geglaubt und gehofft, dass ihnen ein zeitiger Frühling bevorstünde und damit vielleicht sogar der Aufstieg aus dem Elend. Zuvor war Schnee gefallen. Wadenhoch lag die weiße Decke. Seit langem hatte kein Winter die Menschen und die kleineren Unternehmen so unvorbereitet angetroffen wie dieser. In den Stuben der meisten Einwohner vereiste das Pumpenwasser im Eimer, sogar die Pumpen versagten schließlich. Die Städter mussten zum Preis von 5 Pfennigen je Eimer aus den Hydranten versorgt werden.
Krachende Kälte herrschte. Morgens zeigte das Thermometer nicht selten minus fünfundzwanzig Grad Celsius an. Die Metereologen bestätigten: die tiefste jemals in Deutschland gemessene Temperatur betrug am 12. Februar in Hüll minus 37.8 Grad Celsius.
Wenn der Morgenwind aufkam, waren die Straßen menschenleer. Niemand wagte weite Strecken zu gehen, um auf dem Lande für wenig gutes Geld viele Kartoffeln einzukaufen. Sie gefroren im Sack zu Stein. Mit Schubkarre und Handwagen zogen viele der auch durch die Witterung arbeitslos gewordenen Männer in die umliegenden Forsten. Sie fegten die Waldböden von allem Brennbaren frei. Sorgenvolle Blicke richteten sich auf den tiefblauen Himmel. Denn das Hoch erwies sich als sehr stabil und die Nächte waren noch recht lang. Wenn sie in der Kneipe beieinander hockten, drehten sich die Gespräche ums Essen, die sibirische Eisluft und die Politik. Es hieß, russische Winter seien erträglicher, weil die Luft dort trockener wäre. Überhaupt sei dort jetzt alles besser, sagten die einen. Die Sowjetunion, „das Arbeiter - und Bauern -Paradies“ stand ihnen wie ein Garten Eden vor Augen. Manche schworen darauf, andere widersprachen. Zu entscheiden, ob die langfristige Besserung von Moskau oder von Berlin kommen könnte, von den Kommunisten mit Teddy Thälmann oder von Hindenburg und Hitler, war schwierig. Viele glaubten an gar nichts mehr. Sie fühlten sich von Gott, dem Kaiser und ihrem Glück verlassen. Natürlich mussten sie nächstes Mal wieder zur Wahl gehen, aber die da oben würden ja doch machen, was sie wollen, sagten die Gleichgültigen, und deshalb sei es egal, ob die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei oder die Kommunisten ans Ruder kämen. Andere meinten man sei nun einmal Deutscher und stünde deshalb einem Deutschnationalen näher als seinem Feind.
 |
| Bild Wikipedia: der deutsche Kommunistenführer E. Thälmann |
Sie sagten selbst, der tiefgefrorene Baumwollfaden, aus dem das Zugnetz nun einmal bestand, könnte brechen. Auch fürchteten die Männer sie könnten sich Erfrierungen zuziehen, denn man kann das Netz nicht mit Handschuhen einholen. So hauchten die Fänger daheim Löcher in die Eishaut ihrer Fensterscheiben, statt das Eis des Sees aufzubrechen. Trübsinnig starrten sie vor sich hin, denn ihr Verdienst hing direkt vom Fischaufkommen ab. Es schmerzte sie, so hilflos den Launen der Natur ausgesetzt zu sein. Manchmal um die Mittagszeit trafen sie sich in der Stadt, manchmal in der Nähe des Petersgehöftes.
Ernst Peters, wenn sie ihn ansprachen, ging wortkarg an ihnen vorbei. Sie seien arbeitslos, meinte er, und er hätte mit ihnen nichts zu schaffen. Sie sollten ihr Geld vom Arbeitsamt beziehen. Nur Hermann Müller, das Fliegengewicht, beschäftigte er als Netzmacher weiter. Der Asthmatiker hielt ihm das Geschirr instand, fertigte auf dem beheizbaren Netzboden auch neues an. Und da war noch ein junger Mann, - derselbe, den Franz Meltz an jenem Weihnachtsmorgen des Jahres 1920 mit den Worten, er sei noch zu spack, abgewiesen hatte. Fritz Biederstaedt.
 |
| Fritz (1905-1965) |
Dass er allerdings sowieso machte, was er wollte, hütete er als sein Geheimnis. Aber er hielt Peters wenigstens die Menge der Gläubiger vom Hals. „Der Meister ist verreist.“ Das war er in der Tat, verreist ins Traumland.
Das große Los
Mitunter stand Ernst Peters tagelang nicht auf. Er stieß, wenn er seinen Getreuen sah, kurz das Fenster auf und wollte von Fritz wissen, wie das Wetter sei, zog sich allerdings sogleich mit einem Seufzer zurück ins Bett, griff darunter und fand vielleicht unter den leeren Flaschen auch eine mit Inhalt. Wer das prächtige Fischerhaus sah, hätte nicht glauben wollen, wie viel Kummer es beherbergte. Wenn die Pechsträhne sich in die Länge zog, verlor Peters am Ende noch das schöne Dach über dem Kopf. Wie gewonnen, so zerronnen! Das würden seine Neider hämisch vermerken. Im März, endlich, änderte sich die Wetterlage. Es kündigte sich das Ende der Herrschaft des Winters an. Bis dahin hatte der Tieffrost sich in die glasharte Haut des Gewässers gekrallt und sie hier und da mit seiner titanenhaften Kraft kilometerweit aufgerissen. Wie von Schmerz erfüllt hatte der See jedesmal aufgebrüllt. Es schallte schaurig, wenn die Eismassen barsten. Nicht selten schob diese Urkraft große Eisplatten übereinander oder weit aufs feste Land hinauf und türmte sie dort zu Bergen. Peters hätte es nicht bemerkt, wenn Fritz nicht zu ihm gekommen wäre
Fritz Biederstaedt schaute sich in der verdunkelten Stube um, in die er, nach einer Weile vergeblichen Klopfens, eingedrungen war. Da wölbte sich der Körper des reglosen Mannes und Fritz Biederstaedt sah den Strick unter dem Bett liegen. Er erschrak bei der Vorstellung, was das bedeutete. Mit einem Redeschwall versuchte er seinen Herrn zu wecken, um ihn dann auf helle Gedanken zu bringen: „Meisting! Meister! Ick glöw, wi könn‘n nu to Is fischen!“("Meister, ich glaube, wir können nun zu Eis fischen.") Der Pächter reagierte langsam. Er flüsterte etwas, murmelte vor sich hin, alle wollten ihm an den Kragen. Er zählte ein paar Namen auf. Die Liste seiner Gläubiger. Auch der Name Meltz kam über seine spröden Lippen. Dabei nickte er mit dem Kopf. Meltz hatte ihn gewarnt. Als er endlich begriff forderte der Pächter seinen treuen Fritz auf, die Männer zusammenzutrommeln.
Sie sollten um Himmels Willen wieder anfangen zu arbeiten. Fritz sprang aufgeregt durch die sich allmählich wieder belebenden Straßen, um die Stammfischer auf die Beine zu bringen. Die Frage, ob der Geizkragen sie auch entlohnen könne und wolle, verkniffen die Fänger sich. Sie kamen erneut hoffnungsvoll, verluden das knochentrockene Garn, die Gaffeln und Stangen, die Seile und Haken. Nachdenklich allerdings betrachteten sie die Eisäxte. Das ging nicht an. Sie müssten Riesenlöcher schlagen, anders ließe sich der Eisblock nicht heraushieven. Und das alle fünfzehn Schritte. Vierzig Löcher für jede Seite des Zuges waren erforderlich! Mindestens! Wer wollte das leisten? Sie benötigten doppelt soviel Leute! Die würde Peters ihnen nicht zugestehen.
Nach einigem Hin und Her beschlossen sie, sich zuerst zu einigen, welchen Zug sie ziehen würden. Jan Schlämann sprach sich für Zanderskamp aus, einen zuverlässigen Winterzug, allerdings am anderen Seeende gelegen. Die Männer schüttelten die Köpfe. Zehn Kilometer Hinmarsch, zehn zurück, ein Stück Arbeit für sich. Zudem sei der See von Spalten durchzogen.
Lieber würden sie „Linden“ ziehen. Das waren nur anderthalb Kilometer Fußmarsch. Ja, aber! Man könne mit „Linden“ Pech haben. Sie wollten glauben, dass sie gut fangen würden. Am ersten Tag würden sie die Löcher für die Jageruten schlagen, am nächsten das Zeug zum Fischen ins Wasser einlassen. Als sie vor Ort ankamen, stellten sie fest, dass es, wie sie schon befürchtet hatten, nicht möglich war, den sechzig Zentimeter starken Eispanzer an einhundert verschiedenen Stellen auf herkömmliche Weise aufzubrechen. Das aber war unumgänglich.
Die Jagerute musste unter dem Eismantel vorwärts bewegt werden. Denn an ihr hingen die Leinen. Diese waren zu den Orten zu transportieren, wo die Windenschlitten standen.
Dorthin jeweils sollten schubweise die Zugnetzflügel herangezogen werden. Schließlich wurden sie im Uferbereich ans Tageslicht geholt. Einer der Altgedienten erinnerte sich, dass in Ostpreußen in solchen Fällen Stoßäxte eingesetzt wurden. Man nahm einen gut meterlangen Stahlstab, ließ vom Schmied seine Enden umschlagen, das eine um es wie einen Meißel anzuspitzen, das andere wurde mit einem Griff versehen, ähnlich dem einer Handramme. Damit konnten sie das Eisloch erheblich kleiner halten. Das ausgesplitterte Eis schwamm sogleich oben, auch wenn nur ein winziger Durchbruch erzielt wurde. So konnte es leicht vom aufschießenden Wasser abgeschöpft werden und der Arbeitsaufwand reduzierte sich beträchtlich. Endlich waren sie soweit. Sie öffneten den Zug und das Inlett. Sie fuhren das Zugnetz hinter das große Loch. Mit einem Trick drehten sie die Schlitten und stießen sie rückwärts ins Wasser, zogen die Sicherungsschleifen auf und entließen das zehn Meter tiefe und zweimal zweihundert Meter lange Garn in die Seetiefe. Ihre Erwartungen spannten sie hoch. Sie hasteten vorwärts und machten sich ans Werk. Vier Stunden später kam das Wintergarn wieder ans Tageslicht. Mit großem Hallo wurden die ersten kleinen in den Netzflügeln steckenden Plötzen begrüßt. Doch die Männer fingen erbärmlich wenig. Nur ein paar kleine Hechte, eine Kiste voll brauchbarer Fische blieben übrig, nachdem sie sich selbst, allerdings nur bescheiden bedient hatten. Es wäre ihnen nicht schwer gefallen, den ganzen Fang restlos aufzuteilen.
Als es eine ganz Woche lang so ging, begannen sie zu zweifeln, ob es überhaupt Sinn habe, was sie unternahmen.
Fritz, der am Tage zuvor einen der Hauptgläubiger kopfschüttelnd das Petershaus verlassen sah, empfand die ganze Dramatik der Situation. Wenn es Peters nicht mehr gab, dann standen auch er und die anderen Männer im Dunkeln. Niemand in der Stadt würde ihn, Karl Neumann oder einen der anderen Männer einstellen. Auch mit der hochherrschaftlichen Dienerei war es ein für allemal vorbei. Morgen für Morgen war er nun vergeblich an der Seite Jan Schlämanns übers gleißende Eis gezockelt.
Wie ging es weiter?
Noch einen Zug! Nicht weit vorausdenken, sondern nur den neuen Tag durchhalten. Zähne zusammenbeißen, nicht aufgeben! Die steif gefrorene Schlittenleine geschultert, stemmte Fritz seine Eiskrampen, die er zwischen Hacken und Sohlen seiner sorgfältig eingefetteten Lederstiefel trug, ins spiegelglatte Kristall. Daran wird er sich nie gewöhnen, auf diesen Eispickeln zu gehen. Spätestens nach einer Stunde Marsch empfand er jeden weiteren Kilometer Wegstrecke als Qual. Unentwegt drückten die Eisen unter das Fußgewölbe. Die ganze Körperschwere schien nur auf diesen drei empfindlichen Quadratzoll seiner Fußsohlen zu lasten.
Mittags dagegen, nachdem die Sonne die Oberflächen aufgeweicht hatte, patschten sie in der Eispampe, die nicht abfließen konnte, weil die untere Hälfte der Eishaut sich als immer noch undurchlässig erwies. Unter diesen Umständen war es schwierig, allein die Schlitten vom Fleck wegzureißen. Sie erwogen, das Eisfischen aufzugeben und zu warten, bis die Sonne ganze Arbeit geleistet hatte. Denn die Bächlein gluckerten schon. Allnächtlich jedoch wurden die Eisflächen wieder vom Frost gehärtet.
Karl Neumann, der klotzige Mann mit der hasenschartigen Lippe, jung verheiratet wie Fritz Biederstaedt, bestand darauf, dass sie noch den Fischzug vor Alt-Rehse machen sollten. Karl wünschte eher, auf dem See zu sterben als sich zu Hause den lieben, langen Tag hindurch Vorhaltungen machen zu lassen, er fresse seinem Sohn die Haare vom Kopf. Denn sein Eheweib war nicht gerade ausgesprochen friedfertig.
Ob er von Sinnen sei, fragten ihn seine Leidensgenossen mit gemeinen Ausdrücken, die er trotz seiner kolossalen Körperkräfte nie verwandt hätte, weil er eine natürliche Scheu davor empfand, seine Mitmenschen mutwillig zu Zornesäußerungen herauszufordern.
Wenn sie, wie er empfahl, da hinaufzögen, in die weit entfernteste Seeecke, dann wären sie ja schon kaputt, ehe sie ankämen. Karl beharrte diesmal. Fritz Biederstaedt fixierte seinen Widersacher ärgerlich, dem er sich weit überlegen fühlte, weil der Kerl, wie er meinte, nicht einmal mit Messer und Gabel zu essen verstand, sondern nur den Löffel und die Finger als Essbesteck kannte. Doch bei der Erwähnung des Fischzuges vor Alt-Rehse, war ihm zumute gewesen, als hätte er selbst den Vorschlag unterbreitet. Immer gerieten sie beide aneinander. Fritz Biederstaedt mit forschen Redensarten, Karl mit seinem walrossartigen Schnauben und dem Vorwerfen seines Bauches. Es zuckte dem fünfundzwanzigjährigen Muskelmenschen in den Fingern. Er verkrallte sie auch, wenn er in Wut geriet. Doch sie griffen immer nur die Luft. Manchmal fürchtete Biederstaedt sich vor diesen mächtigen Fäusten, denn es gab keine Garantie, dass er sie nicht doch einmal einsetzen würde. Neumann schaute ihn diesmal geradezu bittend an. Er wusste, von Biederstaedt Äußerung würde abhängen, ob sie diesen einen Fangversuch noch machten oder nicht. Jan Schlämann wagte nicht, etwas zu sagen. Ihn drückten die letzten Misserfolge nieder. Fritz dagegen könnte unbeschwert entscheiden.
Karl kaute wie immer, wenn er ungeduldig wurde, an einem der Enden seines mächtigen, blonden Schnurrbartes und wartete. Der große Mund ging ihm auf, als er Biederstaedt unerwartet reden hörte: „Los Lüd! Korl hett Recht. Trecken wie noch Old-Rähse!“ ("Los, Leute, Karl hat Recht, ziehen wir - fischen wir - noch vor Alt Rhese."
Die sieben anderen Männer wogen die buntbemützen Köpfe zunächst eher ablehnend, dann wankend und schließlich zustimmend, weil auch Jan Schlämann sich zum letzten Eiszug des Jahres 1929 bekannte.
Es war schon spät an diesem Nachmittag, aber das Eis wegen der Himmelsbedeckung noch leidlich fest.
Sie beschlossen, das Wadenzeug noch einige Kilometer weiter in Richtung Südwesten zu schleppen um festzustellen, ob ihnen durch ‚Busten‘ der Weg versperrt würde oder nicht. Obwohl sich zur Linken in Richtung Klein Nemerow weithin verlaufende blaue, klafterbreite Rinnen zeigten und gewaltige Eisbarrieren auf den beiden Landzungen Buchort und Gatsch Eck in die Höhe ragten, erkannten sie nach einstündigem Marsch, dass der Weg frei war. Am nächsten Morgen, als sie von Neubrandenburg loszogen, sahen sie alles riesengroß. Das bedeutete Sturm, zumindest eine erhebliche Wetteränderung. Oben auf einem der Eisberge lag hingestreckt eine große Erle, die viele Winter überdauert hatte, nur diesen einen nicht.
Schweigend erreichten sie ihre Schlitten, schulterten die Seile und wuchteten los in Richtung Grote Lanke, vor Alt Rehse. Endlich vor Ort angekommen, warf der Wadenmeister Jan Schlämann die Schlittenleine prustend ab. „Man tau!“("Nur zu!"), sagte er ein wenig brummig, weil sie ihm so viele Züge schon abgenötigt hatten, die nichts eingebracht hatten. Weiß der Kuckuck, wo die Fischschwärme sich hingezogen haben mochten.
„Wennt wat wat, denn wat dat wat!“ ("Wenn es was wird, dann wird es was.") kalauerte Fritz den Spruch des Wadenmeisters zu Ende. Schlämann versprach ihnen dies sei der letzte Versuch. Danach ginge es zu Kahn im offenen Wasser weiter. Schlämann galt als Genie. Er kannte die tausend Tricks der Fischerei: Wann und wo bei welchem Wetter und bei welcher Mondkonstellation gute Fische gefangen werden konnten. Nur bei
Eisbedeckung hatten seine Voraussagen bisher nichts getaugt. Sonst konnte er alles. Er kannte und nannte und erklärte jedem, der sich dafür interessierte, wenn er mit ihm über den nächtlichen See fuhr, die Namen der auffälligsten Sternbilder: Großer und Kleiner Bär, den Himmelsdrachen und Kassiopeia. Die Keplerschen Gesetze, sogar das komplizierte dritte vermochte er verständlich zu erläutern. Er besaß eine gewisse Vorstellung von den ungeheuren Dimensionen der Milchstraße und den Details des Sonnensystems. Mitunter, in besonders klaren Nächten, wies er hinauf und behauptete, es gäbe im Weltall mehr Sterne als Sandkörner auf der Erde. Das erschien den Fischern natürlich übertrieben, denn auch sie hatten gewisse Vorstellungen, nämlich wie viele Körnchen sich allein in einer einzigen Sanduhr befanden. Schlämann aber liebte es, laut über die Unendlichkeit nachzusinnen. Selbstverständlich ging es hier nicht um die Werte der Ewigkeit, sondern buchstäblich nur ums Heute und Morgen, ums eigene Überleben und das des Pächters Peters. Seufzend stieß der hochgewachsene Schlämann die Stoßaxt ins Zentrum des damit markierten Inletts. Das mussten sie aufbrechen, dahinein würden sie eine Stunde später die Schlitten stoßen und mit ihnen das Winternetz. Dahinein würden sie dann die achtzehn Schritte langen Jageruten schieben, um sie von Loch zu Loch weiterzubefördern. Bald warfen die Männer ihre Joppen ab. Sie zertrümmerten die Hauptscholle in drei Teile, die einen drückten auf die seeseitigen Kanten des nun frei schwimmenden Eises und die anderen stießen die Spitzen ihrer an langen Stangen befestigten Piekhaken in die sich leicht aus dem Seewasser erhebenden Ränder und schoben so die tonnenschweren Brocken mit Anstrengung unter die unversehrte Eisfläche. Dunkelgrünes, dumpf riechendes Süßwasser gluckste auf und dehnte sich schließlich auf zehn Quadratmetern aus. Die „Jäger“ banden die zentimeterstarken bis zu sechzig Meter langen Zugseile an die Butttampen, an denen das Netz hing. Dann beeilten sie sich, ihre Ruten von Loch zu Loch zu schieben und folgten den „Stößern“. Auf ihren Rücken wippten die geflickten, von zahllosen Regengüssen ausgewaschenen Fischersäcke, in denen das Frühstück und die Kaffeeflasche sowie trockene Strümpfe und Kleidung steckten. Etwa fünfhundert Meter Wegstrecke lagen vor ihnen. Schweißgebadet beeilten sie sich, denn die Jäger waren ihnen auf den Fersen und kurz hinter denen kamen hüben und drüben schon die beiden Männer mit den Schlittenwinden, die das Zeug immer weiter in das abzufischende Gebiet hineinbeförderten. Sie mussten sich sputen, denn der Arbeitstag war nicht eher zu Ende, bis das Zugnetz jeden Quadratmeter der riesigen Fläche umfasst hatte, bis alles wieder am fernen Seeufer ans Tageslicht befördert wurde und danach richtig verstaut auf den beiden Schlitten verteilt lag. Die Stammplätze der beiden größten Kontrahenten befanden sich jeweils an den auf ihren Arbeitsschlitten montierten Knüppelwinden ihrer Flügel. Der eine arbeitete auf der rechten Seite, der andere auf der linken, beide dreihundert Meter voneinander getrennt, jeder den anderen scharf im Auge, ob er Schritt halten könne. Beide bereit, tadelnd hin und herüber zu schreien: Korl, du büst all to wiet! oder: Fritz hol up! Im Stillen lag jeder der Fänger mit seinem Gewissen im Streit. Man bekam einen frühen Feierabend, wenn so gut wie nichts gefangen wurde. Aber wenn man´s nur für die Katze fing, lohnte es erst recht nicht. Je weiter die Windenleute kamen, umso schwerer wog die Last der sich systematisch entfaltenden Netzwände. Allmählich bewegte sich der Wadensack, der noch zum Teil auf dem Hintereis des Inletts ausgebreitet dalag, den Jan Schlämann mit großer Umsicht nur gleichmäßig ins Wasser rutschen ließ. Waren die Männer an den Windenschlitten zu schnell, dann riss es den Sack zur Seite. Das veranlasste den Wadenmeister, einen Finger in den Mund zu stecken und laut zu pfeifen. Sie schauten dann hin zu ihm und wurden dirigiert. Er winkte auch mit der erhobenen Hand als Zeichen, dass beide Seiten gleich weit gezogen worden waren. Wie ein paar ins Riesenhafte ausgestreckte Arme müssen beide Flügel zu Seiten des großen Wadensackes die vielleicht vorhandenen Fischschwärme umzingeln und sie in der Finsternis, die unter solchem starken und zudem milchig getrübten sowie mit Schnee bedeckten Eis herrscht, zusammenhalten. Nur wenn das im zehntel Schritttempo vorwärts bewegte Netz einigermaßen gleichseitig läuft, kann es die begehrten Fische auch überlisten.
Die Fischerknechte mit ihren Stoßäxten arbeiteten sich bereits wieder, nachdem sie in Schilfnähe angekommen waren, aufeinander zu. Bald würden sie das Aufzugsloch schlagen können, so groß wie das Inlett. Wie an den Vortagen erwärmte sie die Sonne. Über dem gelben Ried flimmerte die unbewegte Luft. Das Himmelsblau nahm gegen ein Uhr weißliche Farbe an. Mitten im Eis stehend, empfingen sie den Frühling. Fast fünf Stunden Schwerstarbeit lagen hinter ihnen, und doch begann der wichtigste und auch spannendste Teil ihrer Tätigkeit erst in dem Augenblick, wenn die Buttstücke, die Wadenanfänge, sich bemerkbar machten, indem sie raschelnd zwischen den frei schwimmenden Eissplittern aus dem Wasser auftauchten.
| Bild: Archiv, Eisfischrei |
Dann wurden die beiden Flügel des Netzes, zuerst von den im Uferbereich verankerten Handwinden und später von Hand herausgezogen. Vom Beginn des Netzeinholens an ist alle bisherige Schwere und Knüppelei vergessen, wie anstrengend der Rest der Arbeit auch noch sein mochte, weil sich nun bald erweisen sollte, was ihnen der Zug bescherte. Jedes Mal, selbst bei den hartgesottensten Leuten, steigerte sich die Spannung. Wie bei Goldwäschern sind die Augen dann auf einen bestimmten Punkt gerichtet. Wann zeigt sich das erste verheißungsvolle Blinken? Wann kommt der erste große Fisch? Was kündigt er an? Keiner dachte jetzt daran einen Bissen zu sich zu nehmen. Nun dauerte es höchstens noch eine Stunde, dann wusste man, ob es wieder einmal umsonst oder vielleicht das große Los gewesen war, das sie gezogen hatten. Viele Geschichten gingen in ihren Köpfen herum, selbsterlebte, nacherzählte, von Phantasien aufgewertete. Sie wussten sich außerdem in völliger Sicherheit. Der Eisklotz, auf dem sie nun standen, ruhte auf dem Gelegesand. Jan Schlämann kam mit langen Schritten vom Ort des Netzeinlasses auf sie zugeschritten. Auch an ihm zerrten die Kräfte des Zweifels und der Hoffnung. Seine Aufgabe bestand nun darin, sich ein Loch in fünfzehn Metern Entfernung vom Aufzugsloch - in der Mitte der sich nun unentwegt vorwärts bewegenden Netzwände - zu schlagen und dahinein mit einer Pulskeule zu schießen, einem Instrument aus Blech, wie eine große Tüte, mit dem er Krach machte. Jedesmal wenn er das Gerät, das sich am Ende einer Stange befand, hineinstieß, riss es eine Menge Luft hinunter, die sich durch den Lichteinfall silbrig erhellte und große Scheuchwirkung besaß. Als die Hälfte des Netzes herausgeholt worden war, erschien ein großer, um seine Freiheit kämpfender Hecht. Wütend drehte sich der meterlange Fisch ins lose Garn. Das galt den abergläubischen Fischern als bestes aller denkbaren Vorzeichen. Ein Barsch durfte es niemals sein. Karl Neumann, schickte einen Anerkennung fordernden Blick zu Fritz Biederstaedt hinüber. Beiden liefen Schweißtropfen über das Gesicht. Fritz knurrte laut auf. Es war nicht auszumachen, ob es Wut oder Freude war.
Einer der Männer rief jauchzend: „Een goodes Teken!“ ("Ein gutes Zeichen.")
Wenig später kamen die ersten rotsilbern schimmernden Fische zum Vorschein. Lebhaft schlugen sie mit den Schwänzen. Sie wehrten sich gegen die Gefangenschaft. Rotaugen. Die Franzosen nennen sie so, respektvoll. Plötzen werden sie abwertend von den Mecklenburgern geschimpft, weil die Norddeutschen die große Kunst der Zubereitung dieser Fischart im Grunde nicht beherrschen. Diese zappelnden Fische vermehrten die Hoffnung auf einen guten, vielleicht sogar einen außergewöhnlichen Fischzug. Wenn sie in solchen Mengen schon vor dem letzten Wadenstück erscheinen, schlägt kein Fischerherz mehr normal. „Dat sünd Bliplötzen!“16, riefen sie in ihrer Aufregung wiederholt einander zu, naiv und offen in ihrer Freude. „Wi hem se! Wi hem se!“17 Das trug ihnen eine laute Rüge Schlämanns ein, der nicht leiden konnte, wenn jemand den Tag vor dem Abend lobte. Noch konnte jede Art von Unglück passieren. Selbst wenn es denn ein Großschwarm Bleie war, der sich im völlig unsichtbaren und inzwischen klein gewordenen Umfassungsbereiches des Zugnetzes aufhielt. Bis zuletzt war möglich, dass er noch unmittelbar vor der drohenden, endgültigen Gefangenschaft an den immerhin einig zig Quadratmeter großen Lücken unter den Zugleinen durchbrach. Oder es stand noch kurz vor dem Aufzugsloch ein abgebrochener
Reusenpfahl. Ein paar Zentimeter Holzsplitter reichten aus, den Wadensack, in dem sich der Fang sammeln soll, von vorne bis hinten aufzuschlitzen. Wer wusste schon, was sich unter Wasser und dem Eis befand? Manchmal reichte ein verloren gegangener Anker aus, um alles zunichte zu machen. Dafür gab es genügend Beispiele. Neumann schrie wie ein Schuljunge: „Hew ick juch dat nich glick secht? Hüt fäng wi wat. Hüten fäng‘n wie wat!“ ("Habe ich euch das nicht gleich gesagt? Heute fangen wir was?")
 |
| Bild privat, 1990 aufgenommen, aber der geschilderten Situation vergleichbar |
Gewaltig sprudelte es aus dem Pulsloch heraus.
Soviel Wirbel konnte nur ein Massenfang verursachen. Die Unterleinenzieher bemerkten diesen kräftigen Ruck. Die unsichtbare Gewalt widerstand ihnen. Der bereits vom Wadensack umschlossene Schwarm drängte mit Macht zurück. Jetzt hieß es für die Fänger sich schnell und ganz nahe ans Aufzugsloch heranzuarbeiten. Unter keinen Umständen durften ihnen die Leinen entgleiten. Im Gegenteil, es galt das Unterspann so schnell und so weit wie die Vorsicht erlaubte hochzuziehen, aufs Eis zu bringen und festzuhalten, gleichgültig, wie schwer die Last würde. Erst wenn sie einen Teil der Sackringe um die Stangen gewickelt hatten, war ihr Anteil geleistet worden.
Mit Hilfe der Eiskrampen standen sie fest und stemmten sich gegen die Verursacher des brodelnden Wasserstromes. Energisch mussten sie dem Druck der immer noch unsichtbar zurückflutenden Menge von Tausenden und Abertausenden kiloschweren Fischleiber, die den letzten verzweifelten Ausreißversuch wagten, ihre Kraft entgegenstellen. Das waren mehr als einhundert Zentner Edelfische! Das waren zweihundert! Sie pusteten und stöhnten mehr aus Vergnügen als aus Qual. Welch ein Tag! Wie lange hatten sie darauf warten müssen? An der Anzahl der gefüllten Sackringe vermochten die Männer einigermaßen genau die Fischmenge abzuschätzen. Jan Schlämann tat das, äußerlich schon wieder gelassen. Er schaute über die Schulter zurück und sah zufällig Fritz Biederstaedt an: „Föfteigen Tunnen!“("Fünfzehn Tonnen!"), sagte er. Das klang nicht nur herrlich, das war das Größte, denn seine Schätzungen waren stets die zuverlässigsten gewesen.
Wer würde nun hinuntereilen, um dem Pächter Peters die wichtige Botschaft zu bringen? Es bestand dringender Handlungsbedarf. Augenblicklich müssen die umfangreichen Maßnahmen zum„Donnerschock!“ Sie schrieen ihr Fängerglück in den Himmel. Dreihundert Zentner! Dabei hatten sie von den gefangenen Fischen bisher nur einzelne Exemplare zu Gesicht bekommen. Immer noch schwamm die Menge unter dem schneebedeckten und milchigen Eis im Verborgenen.
Verkauf eingeleitet werden. Wer in einhundert Kilometer Umkreis konnte solche Fischmassen einigermaßen preiswert vermarkten? „Ick lop runner!“ ("Ich lauf runter!") , bot Karl Neumanns Erzrivale Fritz Biederstaedt schneller an, als ein anderer denken konnte und flog auch schon los.
Er war bereits einige Schritte weg, da erst reagierte Neumann. Zu spät, Karl, sagte sich der Koloss und biss neidisch in seine dicken Lippen. Eigentlich hätte ihm und niemandem anders zugestanden, die freudige Nachricht hinzubringen. Er hatte die Idee gehabt und durchgesetzt. Wieder einmal hatte sich bestätigt, dass keiner den See so gut kannte wie er, und keiner des Pächters Lob und Dankbarkeit mehr als er verdient hätte. Doch da war das große Glück längst einem anderen zugefallen. Der Lakellümmel stahl ihm wieder einmal den Erfolg. Ehe er seine einhundertundzehn Kilogramm Masse hatte in Schwung bringen können, war Biederstaedt auf und davon. Karl Neumann schaute Schlämann vorwurfsvoll an, weil der auch noch hinter dem Galopp rennenden Biederstaedt anerkennend hinterher nickte. Viel mehr als das Recht zählte bei diesem dürren Schlämann, wer sich am meisten bemühte, sein lieb Kindchen zu sein.
Viel zu gern ließ sich der alte Sternenspinner von dem katzbuckelnden Biederstaedt um den Bart schnurren. Das konnte der. Das haben sie ihm ja in Berlin beigebracht. Karl Neumann konnte sich den Bengel gut vorstellen. „Jawohl, gnädige Frau, bitte sehr, Herr Baron.“ Alter Silberputzer! Karl dachte ein obszönes Wort hinterher und machte sich zornbebend über den Rest des Frühstückes her. Er biss so schnell und kräftig große Happen aus dem Quarkbrot heraus, dass der steife Schnurrbart in die weißen Krümel hineinbürstete. Nie wird er dem unterwürfigen Menschen vergessen, wie der sich gleich am ersten Tag bei den beiden Chefs einzukratzen wusste. Sich und ihn sah er in der Erinnerung an damals, als sie beide zufällig und exakt, als hätten sie sich abgesprochen, an jenem Frühlingstag des ersten Nachinflationsjahres 1924 zum ersten Mal und in derselben Absicht aufeinander stießen. Peters stand auf dem Hof und fast gleichzeitig gingen sie auf ihn zu. Er in der guten Hoffnung, er würde dem anderen vorgezogen und angenommen werden. Als wäre es vom Schicksal gewollt gewesen, waren sie gemeinsam aufgetreten und stießen sich doch sofort mit Gewalt gegenseitig ab wie Feuer und Wasser. Peters, der, wie sich herumgesprochen hatte, neue Leute suchte, nahm den linkisch ungeschickten Diener mit demselben Gleichmut an wie ihn, dem man doch eher ansah, was er an Muskelpaketen unter der blauen Arbeitsbluse trug. Peters hörte den verkrachten Diener sogar zuerst an.
Das hätte der Pächter doch auf den ersten Blick bemerken müssen, dass dieser Biederstaedt bloß ein Süßholzraspler und Ohrenkratzer war. Indessen näherte sich Fritz Biederstaedt, nach zehn Kilometern Eilmarsch, endlich dem Petersgehöft. Er fragte sich zunehmend besorgt, wie er den Pächter antreffen würde. Das Haus lag merkwürdig still da. Gewiss, die beiden Bengel, der fröhliche, hoch aufgeschossene Ernst und sein zehnjähriger Bruder Heinz drückten die Schulbank oder hielten sich bei ihren Kameraden auf. Doch auch die Ehefrau des Pächters stand nicht hinter den Gardinen. Fritz klopfte kräftig. Die Türen waren nicht verschlossen. Im dunklen Zimmer fand er sich zurecht. „Meisting!“, rief er zunächst verhalten, schließlich wesentlich lauter. Der Meister atmete doch hoffentlich noch. Schaudernd, zog er die Vorhänge zurück. Frau Peters kam über den Hof aus dem Stall, den Eierkorb tragend. Fritz eilte hinaus zu ihr.
„Fru Meistern, wie hem de Bli!“("Frau Meisterin, wir haben die Bleie!") Ihre trüben Augen blitzten auf. „De Bli!“, murmelte sie. Der freudige Schreck war groß. „Ernst!“, schrie sie laut. Sie stürmte vorneweg. Die schon beiseite geschobenen Vorhänge zog sie noch einmal, öffnete das Fenster. Irgendwie vernahm der Pächter einen hellen Ton. Zwei schwarze Schatten ragten vor ihm auf. Er konnte sich nicht konzentrieren. Schwere Mühlräder rieben gegeneinander. Seine Frau stand unmittelbar vor ihm, mit ihren in die Seiten gestemmten Fäusten. Groß wie ein Monument erschien sie ihm. „De Bli, de Bli!“, hörte er wie ein Echo. Seine zitternde Hand fuhr über die Bartstoppeln. Er fragte: „Büst du dat, Fritz?“ ("Bist du das, Fritz?")
„Jo, Meister, wie hem Bli up de Grote Lank fungen. Bli, grot as de Waschbredder.“ ("Ja, Meister, wir haben die Bleie auf der "Großen Lanke" gefangen. Bleie so groß wie Waschbretter.") Peters sah verwundert diese vor dem Hintergrund gleißender Helle sich ausbreitenden Hände. Sein weißes Gesicht kam hoch. „De Bli?“, fragte er nach und fuhr, die Decke beiseite werfend, hoch. Sofort ernüchtert saß er auf seinem Lager. In seinem Kopf war ein Stachel, dessen Spitze hieß „Bleie in Massen.“ Eine Woge frischen Blutes schoss ihm in den Kopf hinein. „Woväl hett Jan schätzt?“
„Jan Schlämann hett seggt, dat sünd drehunnert Zentner!“("Jan sagt es wären dreihundert Zentner") Ernst Peters ging der Mund auf. Fast flüsternd zuerst wiederholte er den Satz. Wie spät es sei, und welchen Wochentag sie schrieben? Sekunden vergingen. Möglicherweise wagte er seinen Sinnen nicht zu trauen. Innerlich bewegt, wiederholte Fritz Biederstaedt alles zum dritten oder vierten Mal. Zwei der Prachtexemplare hätte er selbst in seinen Händen gehalten. Peters stand mit einem Ruck auf. Sein soldatisch eckiger Schädel fuhr herum. Er stellte sich vor Fritz hin und dröhnte: „Is dat würklich wohr?“ ("Ist das wirklich wahr?")
„Meister, hew ick all eis logen?“ ("Meister, habe ich schon mal gelogen?")
Natürlich hatte er mehr als einmal gelogen, sehr sogar. Aber diese unglaubliche Nachricht war die reinste aller Wahrheiten. Peters dehnte die Brust, streckte das Rückgrat. Mit vibrierenden Händen zog er die Hose an, stopfte das Hemd ins Bund, ging zum Fenster. Wenn sein Haus gebrannt hätte, oder der Himmel wäre über ihm eingestürzt, außer dieser Meldung hätte ihn nichts mehr erschüttern können. Es galt zu handeln. Seine Frau interessierte ihn nicht. Keines ihrer vielen Worte vermochte tiefer als bis auf sein Trommelfell zu dringen. „Fritz spann an!“, den Fuchs sollte er nehmen und den kleinen Schlitten. Das wusste der Alte also doch, dass nur der Fuchs mit Stollen beschlagen worden war. Seine Frau zog ihn in die Küche. Fritz bemerkte, dass er sich nicht zerren lassen wollte. Sie habe Feuer im Herd, sie wolle ihm wenigstens einen Kaffee kochen oder ein Glas Milch warm machen. Milch und Kaffee konnten warten, seine Bleie nicht. Er erkannte, dass er keine Minute seines Lebens mehr zu verschenken hatte. Er stürzte hinter seinem Knecht her. Er riss ihm im Stall das Pferdegeschirr aus der Hand, hängte es eigenhändig, allerdings mit großer Kraftanstrengung über den Kopf des plötzlich nervösen Tieres. Das Vollblut spürte, dass etwas in der Luft lag. Fritz kam nicht dazu, Peters behilflich zu sein. Selbst die Halfter schloss er persönlich, obwohl Fritz es hätte schneller machen können. Er ging in die Remise um den Schlitten herauszuschieben.
Als Fritz das Pferd anschirrte, kam des Pächters Frau angelaufen, mit einem Beutel. Mit Gewalt musste sie ihm den zustecken. Fritz sah sie beide, den dürre gewordenen Mann mit seinem unnatürlich weißgelben Gesicht und der schwarzen Pelzmütze, der sich zitternd in den dicken Mantel einhüllte, und die untersetzte Frau mit ihrem energisch vorstoßenden Kinn. Das Tauwasser tropfte hörbar vom Dach in den grauen Schnee. Es roch nach neuem Leben. Gedankenversunken stieg Peters auf und ließ sich auf die Schlittenbank fallen.
Den ganzen Verstand eines gewieften Händlers wird er benötigen, aus diesen Massen Fisch in solchen Zeiten viel Geld zu machen. Als sie den halben Weg hinauf zum Fangort zurückgelegt hatten, begann er laut zu rechnen. Bekäme er zweiundfünfzig Pfennige aufs Pfund, den Maximalpreis, den er je im größeren Posten erzielen konnte, dann wären das über fünfzehntausend. Die beiden Glöckchen am Wintergeschirr klingelten hell. Dumpf setzten die Hufe des fuchsfarbenen, sechsjährigen Wallach auf den Waldboden vor Meyershof auf. Es lag nur noch wenig Schnee. Übermütig und vor Kraft strotzend hielt das Pferd den Dauertrab spielend durch. Eher litten im Hause Peters die Besitzer Mangel als die Tiere.
„Föfteigendusend“, bestätigte Fritz ehrfürchtig. Ernst nickte. Die Pachtsumme wäre das und die Lohnsumme, die er seinen Leuten schuldete. Ja, er würde sogar eine beträchtliche Rückzahlung an seinen Hauptgläubiger Kaufmann G. leisten können. Er wog den schmalen, harten Kopf. Aber zweiundfünfzig Pfennige würde er gewiss nicht erzielen. Sie werden ihn erheblich unter Druck setzen. Die Großhändler würden selbst viel verdienen wollen. Höchstens vierzig aufs Pfund werden sie herausrücken, diese Geldsäcke. Ihre Habgier würde seine Hoffnungssumme gewaltig senken und doch seinen Fortbestand sichern.
Wenn er nur erst vor Ort wäre, um seine Fische zu sehen. Die Kufen sirrten. Noch war es taghell. Aber die Sonne ging in spätestens anderthalb Stunden unter. Unaufhaltsam rückten die Uhrzeiger vor. Sie mussten sich sputen. Und was wäre, wenn ihm die Stettiner und die Berliner Fischgroßhändler das Fell vollends über die Ohren zögen? Und was, wenn der Wadensack ein Loch hat? Doch die düsteren Gedanken die er monatelang nicht losgeworden war, die sich nur vor dem plötzlichen Neulicht in eine unbekannte Ecke zurückgezogen aber nicht verloren hatten, fühlten sich plötzlich wieder hervorgelockt und warfen sich gnadenlos über ihn. „Hüh!“, schrie er und knallte mit der Peitsche. „Wier dat Tüch all morsch, Fritz?“("War das Netz schon morsch?") Das Sackzeug zumindest sei nagelneu und ganz stabil. Der Wadenmeister hätte die Winterfischerei mit dem Reservesack begonnen. „Jo, up Jan is Verlot!“ ("Ja, auf Jan ist Verlass.") Mit der Rechten fuhr er wiederholt über die Bartstoppeln. Du wirst kein Trinker, schwor Fritz Biederstaedt sich. Er ahnte, wie wüst es in dem Manne aussah, der neben ihm unruhig hin und her ruckte, als säße er auf Kohlen. Auf der Höhe von Deep Uhlentoch berührten die Schlittenkufen zum ersten Mal den See. Da lag ein wenig zusammengetriebener Schnee. Nun kamen gleich die Fänger und das Geschirr in Sicht. Endlich vor Ort angekommen empfingen ihn viele strahlende Gesichter. Es hatte sich bis ins Dorf hinauf herumgesprochen. Gelangweilte und Neugierige waren gleichermaßen hinunter geeilt. Hausfrauen in ihren dünnen Mäntelchen standen frierend beieinander. Die Weidenbügel ihrer Fischkörbe unter den Arm geklemmt, warteten sie geduldig. Billiger kämen sie nie wieder zu einer Mahlzeit. Hier und da lagen Plötzen auf dem Eis herum, man konnte Glück haben, einige hinzusammeln zu dürfen. Schlämann erwartete seinen aufgeschreckten Herrn am Eisloch. Ernst Peters kam langsam näher. Seine Gedanken eilten seinem ungelenk gewordenen Körper voraus. Auffallend unsicher schritt er über das weiße, vom Aufzugswasser beleckte Eis. Er schaute seinen Wadenmeister nur kurz und freundlich an, starrte dann, an ihm vorbei aufs dunkle Wasserviereck. Er nickte, als hätte er nunmehr eine deutlichere Vorstellung von den Fischmassen. Da schwammen
sie, die lange ersehnten Bleie, lauter breitrückige, fast schwarze Riesen. Greifbar nahe sah er sein Geld vor sich. Wie mit Quirlen wühlte es in seinem Hirn. Auf die Idee, Schlämann und den Männern zu danken, kam er nicht. Seine Mundwinkel hingen herunter. Dann murmelte er zweimal: „Schöne Bli!“ Das war den Fängern genug Lob. Sie kannten und mochten ihn eigentlich. Sie werden, ohne ihn zu fragen, jeder zwei, drei der Prachtexemplare in den Rucksack einpacken und dann wird es ein paar Festessen geben. In Biersoße gekochte oder saure, auch in Petersiliensoße zubereitete oder gebratene Seitenstücke. Dazu wird es Pellkartoffeln geben, und vom Gastwirt eine Kanne Bier für einen Extrablei. Die Verwandtschaft wird später etwas abbekommen, in den nächsten Tagen, wenn die Fische ausgekeschert werden. Das wird dauern, diese dreihundert Zentner abzuwiegen, einzukisten und zur Bahn zu schaffen. Viele Gelegenheiten werden sein, von denen der Alte nichts bemerken musste. Was hätten ihm die vielen, herrlichen Edelbrassen genutzt, wenn ihnen nicht gelungen wäre, sie für ihn zu fangen? Außerdem erhoben sie Anspruch auf den Beifang in den Flügeln. Fritz Biederstaedt kutschierte den Alten umgehend hinauf ins Dorf Alt- Rehse. Jetzt mussten Ferngespräche geführt werden. Der Gastwirt und der Pastor besaßen Telefone. Aber allemal zog Ernst Peters den Dunst einer Kneipe dem Geruch von Frömmigkeit vor. Mit M. und M. in Stettin wünschte er zuerst zu verhandeln, dann mit den Reicherts. Er nahm sich vor, nüchtern und gelassen zu reden, mit mannhaft fester Stimme, mit jenem Ton auf der Zunge, der den Großhändlern vorgaukeln sollte, dass er ihr Geld eigentlich nicht benötige, sie dagegen vermochten in diesen schweren Zeiten nur zu bestehen, weil es Männer wie ihn gab.
Das Fernamt brachte die Verbindung glücklicherweise schnell zustande. Er stotterte. Eigentlich wollte er sagen, er habe bereits Angebote erhalten, bessere als sie ihm je würden unterbreiten können. Doch er spürte, wie sie am anderen Ende der Leitung die Ohren spitzten. Sie wussten, dass er unter Druck stand. „Wat denn Herr Peters, sie wolln uns dreihunnert Zentner Plieten andrehen? Da machen se mal nen Punkt. Fünfzig Pfennge vor de Jrätendinger (Grätendinger),pro Pfund? Ick lach’ mir nen Ast. Fünfunddreissig sind schon füll zu fülle.“ Die Reicherts boten gar nur zweiunddreißig Pfennige aufs Pfund bei Frankolieferung. Ernst stellte sich die furchtbare Frage, ob etwa die Haffgewässer schon eisfrei waren, vielleicht durch den Schiffsverkehr. Gegen alle Logik drängte sich ihm diese Befürchtung auf. Dann musste er sofort zuschlagen. Ihm wurde schwarz vor Augen. Die Transportkosten abgezogen und dann noch vielleicht ein Loch im Wadensack. Dann war der ganze herrliche Raub wie ein Schlag ins Wasser. Er dachte allerdings auch, sich selbst beschwichtigend, dreißig effektive Pfennige sind besser als Nichts. Nur mit Mühe beherrschte er seine Zunge. Aus der plötzlichen Panikstimmung heraus hätte er fast zugegriffen.
„Na, denn nich Herr Peters, ick muss ja schließlich auch leben. Leben und leben lassen, Herr Peters.“
Diese Artigkeit nahm ihm die Luft. Wenn Berlin ihm jetzt einen Korb gab, dann musste er mit dem Preis in den Keller gehen. Als er sich mit Grüneberg, Berliner Markthallen, verbinden ließ, wummerte sein Herz. Zehntausende, hunderttausende Bleiesser wohnten in Berlin, die steinreichen Juden, vielmehr als in Stettin. Fischkenner, die aus „Plieten“ eine Delikatesse zu bereiten wussten, weil die Jüdinnen durch Generationen hindurch einander von Mund zu Mund die perfekten und geheimen Rezepte übermittelt hatten.
Am anderen Ende meldete sich der Prokurist des bekannten Großhändlers Grüneberg im freundlichen Ton: „Ich habe schon seit vierzehn Tagen auf ihr Angebot gewartet. Berlin nimmt ihnen jeden Heringsschwanz ab.“ Das klang wie Himmelsmusik. „Auch Bleie?“
„Wenn sie groß sind, bis fünfhundert Zentner, ohne mit der Wimper zu zucken!“ Ernst presste den Hörer aufs Ohr und sagte: „Ganz so viele habe ich nicht!“
„Her damit. Fündundachtzig Pfennige. Ich gebe ihnen auch neunzig pro Kilo, aber franko, mein Herr!“ Im Hirn des Pächters hämmerte es: Nur ein Groschen weniger als sein Wunsch. Dreizehntausendfünfhundert! Er wusste es plötzlich. „Top!“, dröhnte Ernst in die Sprechmuschel hinein, als hätte er Angst, sein Verhandlungspartner könnte das schnelle Wort noch bereuen. Pro Tonne Neunhundert. Das war zwar nicht sein Hochziel, aber nach den Stettiner Angeboten fast paradiesisch.
Sie jagten wieder hinunter zum See. Ernst Peters knallte mit der Peitsche. „De Bli, Meister Meltzen, hem doch goldne Flossen!“ Fritz Biederstaedt sah und hörte den Pächter seit Jahr und Tag zum ersten Mal wieder lachen.
Es begann zu dunkeln. „Morgen früh um sieben fangen wir an zu verladen.“ Und: „Wer steht die Nacht hindurch Wache?“
Neumann schielte nach Fritz Biederstaedt. „Na Lackel? Wer macht jetzt die Punkte? Wem wird er wohl das Vertrauen aussprechen?“ Eine Weile zögerte der kräftige Karl noch, dann riss er die Hand hoch. Die Männer nickten heimlich spöttisch, das hatten sie gewusst, wenn es einen Dummen gibt, dann meldet er sich auch. So war das im Leben.
Als die zehn Männer, unter ihnen der schulschwänzende Primaner Ernst, am nächsten Morgen wieder um die Landzunge des Rehser Eck bogen, sahen sie den aus der Entfernung klein erscheinenden Karl Neumann vor einem riesigen, halbrunden und blau schimmernden Eisloch stehen. Die jüngeren, noch unerfahrenen Fischer rissen ihre rauen Münder auf, mit dem ganzen Ausdruck von Entsetzen. Wadenmeister Schlämann lachte. Das kannte er. Die Menge wirbelnder Fischschwänze hatte das Eis stundenlang unterspült und zermürbt. Die Großfische hatten sich Luft und Licht verschafft. Es war allerdings die Bestätigung, dass alles in bester Ordnung war. Die Fische hatten keinen Ausweg gefunden. Zwei volle Arbeitstage lang kescherten die Männer, wogen und verluden die zappelnden, sich vergeblich wehrenden Prachtbrassen und schafften sie mit schweren Ackerwagen zur Bahn. Junior Ernst machte wie ein Alter mit, rannte, die gefüllten Fischkiepen schleppend, mit Biederstaedt um die Wette. Sieben Jahre trennten sie, doch es verband sie die gemeinsame Lust am Plaudern. In der Stadt indessen ging es wie ein Lauffeuer um: Peters hat die Bleie. Man konnte es auch in der Presse lesen: Große Bleie zu kaufen bei Ernst Peters am Oberbach. Seinem ärgsten Gläubiger liefen
wahrscheinlich Schauer des Entzückens über den Rücken: „Der liebe Gott verlässt einen redlichen Geldborger nicht!“
Die Dreihundertzentnergrenze war längst überschritten, die Städter außerdem versorgt worden, legal und illegal, doch der Segen nahm noch lange kein Ende. Immer noch sprudelte es aus dem Wadensack heraus. Es schien, dass die Fische immer größer wurden. Dieses Wunder allerdings war keins, denn die stärksten Fische drängten und verdrängten aus der äußersten Fluchtnische stets die schwächeren. Als auf dem Notizblock des Wadenmeisters, die Vierhundertzentnersumme erschien und überschritten wurde, ging der hochgewachsene Schlämann auf den „Alten“ zu und gratulierte ihm. Das Selbstwertgefühl steifte seinen Rücken. Sie hatten durchgehalten, obwohl auch er in diesen furchtbaren Wintertagen der Verzweiflung manchmal sehr nahe gewesen war. Seinem strahlenden Gesicht war anzusehen, dass er eine seiner Maximen dachte: Vom letzten Zoll einer Durchhaltestrecke hängt die Entscheidung ab, ob gute Vorsätze zum Ziel führen oder nicht.
Eine Stunde später erhielt der Alt-Rehser Gastwirt einen Anruf aus Berlin. Die Fischgroßhandelsfirma Grüneberg bestätige Herrn Peters die von ihm deklarierte Qualität der Brassen mit Dank. Der Gastwirt schickte einen Boten hinunter. Als Peters diese Nachricht entgegen nahm, fühlte er sich minutenlang schweben. Das Glücksgefühl riss ihn hin zu sagen, dass sich jeder Mann zwei Bleie einsacken dürfe, obwohl er wusste oder zumindest annehmen konnte, dass sie sich bereits eingedeckt hatten. Das erschreckte sie. So kannten sie den berechnenden Mann nicht. Ehe er seine Großzügigkeit bereute, schlugen sie zu und hofften nur, dass er sie das nicht irgendwie abbüßen ließe.
Ernst Peters, nachdem er fast zwanzigtausend Goldmark kassiert hatte, dachte daran zunächst seine Gläubiger zu befriedigen. Als zweites würde er zur Kämmerei gehen und die Talerchen dort mit Genuss auf den Tisch legen. Dreimal hatte er es durchgerechnet, es verblieben ihm trotz alledem fast sechstausend.
Zuerst aber ging er zu seinem Hauptquäler, der ihm das Leben vergällt und zur Hölle gemacht und ein Gutteil dazu beigetragen, dass er sich schließlich den Strick zurechtgelegt hatte. Ernst Peters sah die Szene im Voraus, wie G. sich bemühen würde, den Eindruck zu verwischen, den er mit zahllosen rigorosen Auftritten hinterlassen hatte.
Und so geschah es!
Als Kaufmann G. den Batzen Bargeld samt den Zinsen in seiner Hand hielt, atmete er tief durch und beteuerte mit weicher Stimme, als hätte er Kreide gefressen, das hätte doch noch Zeit gehabt.
Ernst Peters dachte sich seinen Teil. Als sein Gegenüber ihm auf die Schulter klopfte und sich auch noch verneigte, durchfröstelte es ihn. Diese Gesten galten nicht ihm. Dieses Bücken war nicht entschuldigend gemeint.
G. tat es nicht als wiedergewonnener, alter, neuer Freund, wie er glauben machen wollte. Ausschließlich dem Geld galt seine ganze widerliche Unterwürfigkeit. Nichts und niemanden anders als der Geldmacht hatte G. sein Leben lang von Herzen gedient.
Peters hätte fünfzig Mark draufgegeben, wenn er nur eine Minute lang all die niederträchtigen Gedanken des anderen hätte lesen können.
SS marschiert
Ein milder, glückhafter Frühling folgte. Die Reusen auf der Lieps fingen ungeahnte Fischmengen, vor allem Hechte. Fritz Biederstaedt war jedesmal überrascht, wenn er den Steertpfahl einer neuen Reuse zog. Grünbraun wälzten sich zwischen den peitschenden Aalschwänzen die armlangen Laichhechte. Nie zuvor kauften die Bürger wie in diesen Wochen. Alles lief gut. Auch der Verbindungsgraben, den der jeweilige Pächter des Tollensesees gemäß einem uralten Privileg mit Reusengeschirr verstellen durfte, erwies sich als Goldfluss. „Der alte Graben“ wurde diese Fischhauptstraße im Unterschied zum „Neuen Graben“ genannt. Diesen hatte der Großherzog von Mecklenburg-Strelitz auf seine Kosten graben lassen müssen, weil der damalige Pächter ihm die Durchfahrt verwehrte und nach der Klage vor dem Landesgericht sein Recht behielt.
Beide Kanäle verliefen zwischen dem großen und tiefen Tollensesee sowie der flachen, sich wesentlich schneller erwärmenden Lieps. Da sich das wärmere Liepswasser alljährlich im Frühjahr weithin als Lockstrom in den noch kalten Tollensesee ergießt, schwimmen ihm Barsche, Plötze, Hechte entgegen um an einem freundlicheren Ort Fischhochzeit zu halten.
 |
| Bild Wikipedia: Lieps, durchschn. 1.80 m tief |
Nach dieser unangenehmen Arbeit wusch er sich und atmete tief die Mailuft ein, die zwischen den ihn umgebenden grünenden Birken und Erlen wehte. Er liebte die Schönheit der Landschaft und freute sich der Fischmengen, die er überlistet hatte. Er erfreute sich des besseren Lebens, auch der besser ausgestatteten Wohnung, da er um einen geringen Preis ein paar Möbel erwerben konnte. Jedesmal, wenn er nach getaner Arbeit den schmalen, leicht am Ufer dahingleitenden Kahn mit einem Stakruder heimwärts schob, malte er sich das Bild aus, wie seine Inge im Korbstuhl vor dem Fenster und der Geranienbank saß. Immer wenn er zurückfuhr, dachte er, wie gut es das Leben mit ihm gemeint hatte. Denn wäre er nur zehn Jahre früher geboren worden, wie sein ältester Bruder Paul, dann läge er jetzt an seiner Stelle unter dem Boden vor Verdun, wo die
kaiserlichen Generäle zehntausende deutsche Jungen sinnlos ins Trommelfeuer der Franzosen gejagt hatten. Die bösen Jahre lagen zum Glück weit zurück.
Dann kam die Zeit, in der die ersten Hakenkreuzfahnen in der Stadt wehten. Bunter wurden durch sie die von grauen Hausreihen beherrschten Straßenzüge. Öfter als sonst sah man fröhliche Gesichter. Bloß Schlämann meckerte: „Dat dömliche Tüchs wat uns noch veel Arger moken!“32
Das mitunter scharfe Spötteln über die Nazis sei Schlämanns Verschrobenheit zuzurechnen, glaubte Biederstaedt und der Junior stimmte ihm zu.
Als es 1936 keine Arbeitslosen mehr gab, hörte Fritz Biederstaedt die Leute auf den Straßen und Plätzen immer dasselbe reden. Nun sei es wieder fast so gut wie zu Kaisers Zeit geworden: Heil Hitler!
Pächter Peters gab ein rauschendes Fest. Der vierundzwanzigste Geburtstag seines Ältesten wurde aufwendig gefeiert.
Eigentlich war das Ereignis nur ein Anlass zum Feiern unter vielen. Möglicherweise hätte sich Ernst Peters senior vor dieser Festlichkeit sogar gedrückt, wenn ihm eine gute Ausrede eingefallen wäre. Denn Vater und Sohn mochten einander nicht. Dem Vater war sein ältester Spross, der junge Fischereigehilfe, der kurz vor seiner Meisterprüfung stand, zu zimperlich, dem Sohn der Vater zu poltrig, allzu ungehobelt, zu laut.
Auch an diesem Tage gingen sie sich unübersehbar aus dem Weg und blieben einander ein Ärgernis.
Fritz schien, es würde zwischen beiden immer schlimmer. Wenn Ernst Peters junior aus seinem Zimmer kam, ging er blicklos an seinem auf dem Hof umherkrakelenden Vater vorbei, stieg in den Heuer, gab den Leuten ein Zeichen, kurbelte den Motor an, legte den Gang ein, fuhr los ohne den Alten zu fragen. Fritz Biederstaedt litt unter diesem Zerwürfnis seiner Chefs. Einerseits liebte er den echt aristokratisch wirkenden Sohn, andererseits mochte er den Senior, der seine Rolle als pedantischer Unteroffizier aufregend widersprüchlich spielte, weil die Liederlichkeit seiner Erscheinung nicht zu seinem Anspruch passte, denn manchmal hielt ihm nur ein
Bindfaden die Hosen auf den Hüften. Doch niemand konnte es dem ehemaligen Rekrutenausbilder recht machen.
Vater und Sohn befanden sich nur in einer Hinsicht in gewisser Übereinstimmung. Politik interessierte sie nicht. Beide meinten, jeder auf seine Weise, sie seien nur urdeutsch.
Fritz Biederstaedt, der auch an diesem Geburtstagsnachmittag und am Abend dienerte, richtete seine Meinung nach der seiner Vorgesetzten aus. Umso mehr schmerzte ihn die schneidende Härte, mit der sich die beiden Petersmänner behandelten. An diesem neunten Oktobertag kamen, um den angehenden Fischermeister Ernst junior zu gratulieren, auch zwei seiner ehemaligen Schulkameraden in schwarzer SS-Uniform. Sie schüttelten ihm übermütig die Hände. Der eine rechts, der andere links. Hoch soll er leben! Halb im Scherz meinten sie schließlich, bei seiner sportlichen Figur mit Gardemaß würde ihm ihre Uniform gut zu Gesicht stehen und es wäre hoch an der Zeit für ihn, sich richtig zu entscheiden. Jeder anständige Deutsche würde die Farben seines geliebten Führers tragen, braun oder schwarz. Schwarz sei auf jeden Fall besser, wenn man sich den Pöbel anschaue, der in Braun ginge. Schwarz sei die deutsche Elite. Deshalb jedenfalls wären sie überzeugte SSler.
Einer der beiden, Bäcker H., nun ein angehender Gerichtsassessor, frozzelte, Ernst junior solle es lieber doch nicht tun, denn schon jetzt würden ihm die Herzen der meisten Mädchen der Stadt zufallen. Dann verdrehe er ihnen ganz und gar die hübschen Köpfe und sie beide wären trotz ihrer feschen Uniformen abgemeldet. Ernst junior war verlegen und zugleich heimlich stolz auf sich. Er wusste, dass er nicht nur gut aussah, sondern einfach gut war, gebildet und menschenfreundlich, dass er, wenn er hoch zu Ross ausritt, bewundernde Blicke auf sich zog. Wie viele Menschen grüßten ihn! Wie viele würden ihn dann vielleicht bewundern. „Reitet für Deutschland.“ Jemand hatte ihn mit dem Hauptdarsteller dieses Filmes, Willy Birgel, verglichen, dem er ein wenig ähnelte. Ein paar Sekunden lang wünschte er eine Steigerung seines Glücksgefühls und stellte sich vor, was er noch erreichen könnte. Alles musste besser werden, das schuldete ihm das Leben. Und so erwärmte ihn plötzlich der Gedanke, dass auch seine Zukunft, dank des Führers Adolf Hitler groß und bunt wie ein Garten Gottes vor ihm und der deutschen Jugend lag. Nie zuvor hatte er das so lichthell empfunden.
Tante Ilse, die seinetwegen von Berlin gekommen war, eine Volljüdin, zog ihren Neffen Ernst junior nach dem vorabendlichen Kaffeetisch beiseite. Sie gingen in die Veranda, setzten sich nebeneinander. Die Glastür stand offen. Wenige Schritte von ihnen entfernt tanzten seine fröhlichen, jungen Gäste einen Foxtrott zu plärrender Musik aus dem Grammophon. Die unbequemen Jacketts hatten sie ausgezogen, die Mädchen in den Arm genommen und sie setzten die Beine im Rhythmus von „Liebe Lotte“. Fritz sah die elegante Frau neben dem schönen Ernst sitzen. Sieh mal an, dachte er. Er hätte zu gern gewusst, was sie miteinander tuschelten.
„Hand aufs Herz, Junior, wie vielen deiner Kameraden hast du anvertraut, dass ich Jüdin bin?“
Ernst junior verstand sie nicht oder wollte sie nicht verstehen. Doch als sie seinem Verständnis ein wenig nachhalf, legte Ernst tatsächlich die Hand aufs Herz. Seine germanischblauen Augen leuchteten. “Tante Ilse, von mir wird niemand jemals etwas erfahren!“
„Niemals?“ „Niemals!“, sagte er und hob die Rechte zum Schwur. Sie griff behutsam nach dieser Hand und holte sie mit sanfter Gewalt herunter. Mit kleiner Geste winkte sie ab. Ihre freundlichen dunkelbraunen Augen suchten seinen Blick. „Nie schwören, Ernst, wir sind alle nur Menschen. Dein Wort reicht mir.“
Weich von Gemüt, sah Ernst sich außerstande, viel zu reden, seine Lidwinkel füllten sich mit Wasser. Er neigte sich über ihre Hand und küsste ihre Finger. Er wusste tief in seinem Herzen, dass Juden bessere Menschen als die Christen waren.
Aber er wusste natürlich auch, dass der ungewöhnlich kluge Jude Rosenstein sein Geschäft am Markt vor Jahresfrist aufgegeben hatte und in die Emigration gegangen war. Seiner Meinung nach war der Mann aus kaum begründbarer Furcht geflüchtet.
Biederstaedt hielt es nicht mehr an seinem Platz. Er ging auf die beiden zu mit einem Tablett. Er bot ihnen Champagner an. Das war jedoch, wie er schnell bemerkte, kein Techtelmechtel zwischen den beiden. Aber was war es dann?
Ein kleiner Hintergedanke blieb. So küsste man einer Tante nicht den Handrücken. Fritz Biederstaedt wollte das Geheimnis herausfinden und hielt seine unverschämte Neugierde für eine Tugend.
Gern trug er weiße Handschuhe, die seine unbedingte Sauberkeit belegten. Viel zu selten gab es Gelegenheiten, sie zu tragen. Mit Hingabe bewies er an jenem Abend seine noch nicht verlernte Dienerkunst. Elegant wie ein Oberkellner balancierte er die Speisen. Mit den in Berlin auswendig gelernten Floskeln umschmeichelte er zu deren Verwunderung die Gäste des späten Abends. Sogar dem Gutsbesitzer von Neverin, der zu später Stunde hereinkam, fiel er auf. Fritz war überglücklich zu hören, wie sie den Pächter seinetwegen lobten. Man hob an zu singen. Die Gäste waren beschwipst, Ernst junior angeheitert, Vater Ernst betrunken.
Die leichten Disharmonien überhörten sie. Wie Minuten verrannen die Stunden. So erschien den Gastgebern der ganze Abend rundum gelungen.
Irgendwann nach Mitternacht stellte Diener Fritz ermattet das Tablett ab und da er sich ungestört glaubte, trank er hastig hintereinander ein paar Gläser Wein, schlief im Sitzen eine Weile, schrak dann jedoch zusammen. Das hätte er sich in Berlin nie erlauben dürfen. Er erhob sich, nahm eine der vier SS-Mützen vom Garderobehaken des Flures und betastete mit seinen Handschuhen die Totenkopfkokarde und den darüber angesteckten silbernen, flügelausbreitenden Reichsadler. Er setzte die Kopfbedeckung auf. Sie war ihm zu groß. Fritz nahm eine andere. Auch die rutschte über seine stark fliehende Stirn auf die kräftigen Augenwülste. Er trat vor den Spiegel und lachte. Wie ein Clown sah er aus. Wer sich wohl diesen Blödsinn mit dem silbernen knopfgroßen Totenschädel und den gekreuzten Beinknochen ausgedacht hatte? Dieses Emblem konnte niemand für voll nehmen. Er ahnte nicht, dass dieses Zeichen den Weltuntergang bereits heraufbeschworen hatte, ahnte auch nicht, dass es im westlichen Ausland genügend sonst nicht unbedeutende Berufspolitiker gab, die darüber, ihrem Kenntnisstand zum Trotze, naiv wie er dachten. Gerade als er die Uniformmütze zurücklegen wollte, kamen als Kette zwei Mädchen Arm in Arm mit den beiden jungen SSlern und Ernst Peters junior, leicht schwankend und harmlos lachend auf den Flur.
Das Bild begeisterte den Mann. So hatte man sich den Bilderbuchgermanen vorzustellen. Intelligent, zackig und absolut gehorsam. Kaum spürt der Herrenmensch die Uniform auf dem Leib, nimmt er Haltung vor dem Oberherren an. So war das. Mitdiesen Kerlen konnte man die Welt aus den Angeln heben. „Rührt euch, Männer!“, kommandierte der robuste Fleischer bemüht freundlich. „Einsfünfundachtzig, wie?“ Ernst junior nickte: „Nicht ganz, Herr Hauptscharführer.“ „Jawohl!“, bestätigte Gau „der Führer macht euch alle größer!“ Das war es, was Ernst Peters junior in diesen wenigen Augenblicken empfand und auf eine Weise begriff, die ihm selbst unerklärlich schien. Es war ein inneres Leuchten, nicht grell, eben angenehm. Deutschlands Glanz und Größe! Das ging ihm ins Blut. Eine Melodie vom Heroismus. Nur Fritz Biederstaedt erschrak, als er seinen Freund Ernst junior so verändert unmittelbar vor sich stehen sah. Da gab es, seinem Empfinden nach, nichts mehr zu lachen. Diese beiden schwarzen Kleidungsstücke hatten den feinen, freundlichen Ernst für ihn unerwartet in einen arrogant wirkenden Bengel verwandelt.
In den sonst leger auftretenden Zivilisten schien auf einmal ein Geist von unerbittlichem Gewissen und Schneid gefahren zu sein. „Komm zu uns!“, lockte Herr Schlachtermeister Gau sofort, überzeugt, dass dem großen Pächterssohn zwar zufällig, aber definitiv die vorgeschriebene Lebensrolle auf den Leib gerückt war. Zufällig hatte inzwischen Heinz, der siebzehnjährige Bruder von Ernst, die Szene betreten. Seine Augen bewundernd auf den älteren Bruder gerichtet, die Hacken zusammenreißend, rief er aus: „Jawohl Hauptscharführer, wenn sie befehlen, dann kommen wir!“
„Grünschnabel!“, flüsterte Ernst, im Ton verbindlich, zog ohne Hast die Jacke aus und hängte die Mütze auf den Garderobenhaken. Als Heinz dicht neben ihn trat, möglicherweise um seinerseits zu probieren, ob er sich als schwarzer SSler gefallen würde, sagte Ernst leise: „Halte Dich bitte zurück!“
Nachdem sich die Gäste überschwänglich bedankt hatten und davon gegangen waren, suchte Ernst seinen Freund Fritz.
Müde hockte Diener Fritz Biederstaedt im Korbstuhl und sehnte sich nach seinem Bett. Ernst junior sah ihn, ging auf ihn zu. Als Fritz aufschaute bemerkte Ernst die Ablehnung in Biederstaedt offenem Gesicht. Der stille Vorwurf störte ihn. Ernst war plötzlich zumute als fielen Wermutstropfen in seinen Sekt.
Beschwichtigend legte er ihm die Hand auf die Schulter, drückte ihn zurück auf den Sitz und sagte leise: „Fritz, du brukst di dorbi nix to denken.“ ("Fritz, du brauchst dir dabei nichts zu denken.") Er würde niemals ein Nazi werden, was auch geschehen würde. Niemals!
Als Ernst junior sich in sein Zimmer begab, schimmerte noch lange um ihn herum das Licht des unvergesslichen Abends.
Die vielen Komplimente waren ihm zu Herzen gegangen - und zu Kopf gestiegen. Die SS riss sich ja geradezu um ihn. Er dachte es plötzlich deutlich: „Warum nicht? Wenn ihr wollt, dann komme ich eben!“
Tief in Gedanken versunken stellte er sich vor dem Einschlafen die beiden bildhübschen Neubrandenburgerinnen vor und fragte die beiden Schemen, ob sie ihm zustimmen würden. Das war keine Frage. Sie waren begeistert von seinem mannhaften Entschluss. Schon eindämmernd stellte Ernst sich das Bild vor, wie sie mit ihm auf der Palais-Straße spazieren gingen, Neid weckend. Wenige Tage später war es soweit. Ernst junior schritt hochaufgerichtet und in blitzenden Lederstiefeln als forscher SS-Mann über den Hof. Alle, außer Schlämann, sagten, keinem stünde die schwarze Uniform so gut zu Gesicht wie ihm. Ernst glaubte es. Er wusste es. Und dieses Wissen veränderte ihn.
Die Schlagzeilen in der Presse schienen auf ihn plötzlich nicht mehr abschreckend zu wirken. Jedenfalls beteiligte Ernst junior sich nicht mehr an den Spötteleien. Er sehe die Dinge mit neuen Augen.
So bestätigte sich für seinen Freund Fritz Biederstaedt, dass wahrscheinlich jedermann plötzlich kurz- und schiefsichtig werden kann. Jan Schlämann sagte Ähnliches, allerdings sehr leise. Der Junior zeige bereits die ersten Symptome einer speziellen Sehschwäche, die in ganz Deutschland grassierte. Einige Äußerungen des jungen Ernst ließen tatsächlich den Schluss zu, dass er krank war. Er ging, als hätte er einen Stock verschluckt. Neuerdings übersah und überhörte er auch, dass die Leute “Guten Morgen” sagten und wie üblich grüßten.
„Heil Hitler!”, erwiderte Ernst wohl zehn mal am Tag. Auch andere Zeichen des Wandels fielen auf.
Plötzlich wurden auf dem Petershof statt der kleinen Hakenkreuzfähnchen, große Flaggen gehisst. Die Zivilisten, solange in der Überzahl, wurden durch Uniformierte verdrängt. Nichts schien mehr wie zuvor zu sein. Noch vor wenigen Wochen hatte Ernst junior mit Fritz darüber gelästert, dass seine ehemaligen Klassenkameraden sich in ihrer albernen Kledasche und mit diesen unnatürlichen Bewegungen abfanden. Es war noch gar nicht so lange her, als sie mit dem Fischereiwagen an den draußen im Blumenborn exerzierenden SSlern vorbeigefahren waren und herzlich über die paradierenden Bengel mit ihren ungelenken Beinen gelacht hatten. Freiwillig mitmachen? Niemals!
Ernst junior hatte noch vor drei Wochen nichts dagegen gehabt, dass Jan Schlämann Hitler für einen Popanz hielt und das auch sagte. Doch all das, galt plötzlich für ihn nicht mehr. Dass die Nazis primitiv seien, war nicht mehr wahr.
Jetzt argumentierte Ernst: „Unser Führer hat allen Brot und Arbeit gegeben. Guckt euch an, was Adolf Hitler aufgebaut hat! Deutschlands Aufstieg hat begonnen. Die Reichsautobahn, die Siedlungen...“, „und die Rüstung”, setzte Schlämann leise hinzu.
Beide, der Junior und Biederstaedt bekamen es wohl mit. Doch Ernst entwertete auch diesmal Schlämanns kritische Anmerkung.
Deutschland sei auf Friedensmission.
Er gab wirklich eine hervorragende Figur ab. Sein leuchtend blondes Haar kontrastierte zu dem Schwarz seiner nagelneuen Uniform. Er lachte wie früher, schaute wie früher harmlos in den Tag hinein, aber er war nicht mehr derselbe.
Krieg möt dat gäben! ("Krieg muss es geben")
Vergeblich fischten in jenen Wochen und Tagen die Volksgenossen und Herren Arbeiter. (Hitler hatte tatsächlich alle offizielle Knechterei abgeschafft.) Das tat dem Großpächter zunächst nicht weh. Er verfügte zwar über beträchtliche finanzielle Reserven, doch allmählich nervte es ihn, zuschauen zu müssen, dass die Kette der Misserfolge immer länger wurde. Denn er verärgerte seine Stammkunden mit der ständigen Wiederholung seiner für faule Ausreden gehaltenen Beteuerungen: „Miene Lued fängen in Oogenblick nix.“("Im Augenblik fangen meine Leute nichts.") Er musste im Umkreis Fische aufkaufen. In solchem Umfange war das noch nie nötig gewesen. Da entstanden allmählich die sonderbarsten Mutmaßungen. Aberglauben, der wieder einmal nahrhaften Boden fand, machte sich breit und trieb seine seltsamen Blüten. Nur Fritz Biederstaedt brachte noch in nennenswerten Mengen Fische heim. Große Hechte, die er mit der Hechtschnur, quer über den See ausgefahren, gefangen hatte. In Abständen von fünf Metern zweigte eine halb meterlange Mundschnur ab, an der jeweils an einem Haken des kräftigen Drillings Plötzen als Köder gesteckt worden waren. Der Fänger genoss natürlich das Vergnügen, jeden Morgen zehn, zwölf stattliche und um ihre Freiheit kämpfenden Fische in den Kahn hineinzuhieven. Doch wer kaufte schon diese Riesenraubfische? Die Situation war für den Fischereipächter Peters sehr unangenehm. Da gäbe es in einem der Wieckhäuser eine Pusterin und Wahrsagerin. Die müsste man mal befragen. Ein Kind, das mit vierzig Fieber im Kinderwagen zu ihr hingeschoben wurde, verließ sie, wie erzählt wurde, fünf Minuten später fieberfrei. Gewusst, wie man Schmerzen und permanente Misserfolge wegbläst. Jedenfalls war es nicht einfach für Ernst sen., sogar seine besten Kunden unbefriedigt wegzuschicken und achselzuckend zu wiederholen: „Deet mi leed, wie fäng‘n momenton nix.“36 So erwog er alle Möglichkeiten, auch die der Wahrsagerei.
Die geheimnisvolle Frau fand, dass sich Karobube und Pikdame kreuzten, machte ein sehr nachdenkliches Gesicht und sagte schließlich, es stünde ihm noch großes Geld ins Haus. Dass über ihm der Himmel einstürzen würde, sah sie nicht voraus. Ernst senior dachte und sagte: Hauptsache Geld! Denn viel länger durfte sich die Serie seiner Misserfolge nicht fortsetzen. Die Länge hatte die Last. Kein Fachmann verstand, weshalb sich in den riesigen Umfassungsnetzen, trotz aller Raffinesse monatelang nichts Nennenswertes finden ließ. So begierig und intensiv sich auch die Blicke der Fänger nach jedem neuen und vergeblichen Zug in den tiefen und geräumigen Wadensack bohrten. Der farbigste aller norddeutschen Seen lag nicht nur wie leblos, er schien wirklich leblos zu sein, bar jeden Fischschwarmes. Des schönen Sees Außen- wie sein Innenleben schienen gleichermaßen erstorben zu sein. Tag und Nacht spiegelte das unnatürlich glatte Wasser den gewölbten Himmel wieder, tags das wolkenlose Blau und die Silhouetten der blinkenden und brummenden Trollenhagener Flugzeuge, nachts das Sternenlicht.
Doch die Fänger erwarteten viel mehr von ihrem See, als sich wie ein erstarrtes, wenn auch schönes Bild zu präsentieren. Von der Schönheit bissen sie nichts Nahrhaftes ab. Sie verstanden die Welt nicht mehr. Nicht war mehr wie ehedem. Sogar der Optimist Schlämann wusste keine Argumente mehr, wenn sie sagten: „De Olle het denn See utplündert. Kein Wunner, hei het jeden Schwanz mitnohmen.“ ("Der Alte hat den See aisgeplündert... er hat jeden Schwanz mitgenommen.") Sogar jene, die es besser wissen sollten, lästerten insgeheim: „Hochmut kümmt vör den Fall!“
Nun sei er gefallen. Zu lange war der Großpächter mit stolzem, steifen Genick gegangen.
Selbst Schlämann winkte nur noch matt ab. Seine Behauptung, sie hätten die Fischbestände keineswegs überfischt, klang nicht mehr
überzeugend. Wann und wie hätte er das Gegenteil beweisen können, angesichts dieser katastrophalen Fangresultate?
Es gab die sonderbarsten, unsinnigsten Erklärungsversuche. Schlämann schüttelte nur den Kopf. Überhaupt wunderte er sich im Stillen, wie leichtgläubig die Menschen geworden waren. Ernst junior war dafür das beste Beispiel. Sich kritisch zu äußern wagte Schlämann schließlich nur noch gegenüber Fritz Biederstaedt und dessen neuen Freund Kurt Willig, der seit einigen Monaten in der Fischerei Peters Beschäftigung gefunden hatte. Willig widersprach dem alten Wadenmeister nicht. Auch nicht als Schlämann die Katze aus dem Sack ließ: er sei der Überzeugung, dass in der bisherigen Weltgeschichte dem Politikergeschreie immer nur, statt des versprochenen Glücks, die Verheerung folgte. Noch nie haben Schreihälse die Welt verbessert. Noch nie, außer unmittelbar vor
Kriegen, hätte man soviel Prahlerei vernommen und so viele Uniformen in den Straßen der Stadt gesehen. Wer weiß, was das noch werden wollte, was da herauskam, wenn die Illusion erst platzte. Der kinderreiche Fischer Kurt Willig lud Fritz und Jan Schlämann gelegentlich samstags abends zum Skat ein. Willig der sich einen Volksempfänger geleistet hatte, liebte Volksmusik, Biederstaedt nicht weniger und Schlämann empfand die Untermalung ebenfalls als angenehm, weil, der schlafenden Kinder wegen, die Geräusche etwas gedämpft herüber kamen. Eines Abends unterbrach der Nachrichtensprecher die Musik. Eine Ankündigung folgte.
Der Führer würde sprechen. Fünf Minuten lang ertrug Schlämann die Rede, der Fritz Biederstaedt und Kurt Willig wie gebannt lauschten. Die suggestive Redegewalt Hitlers ließ sie eine Weile vergessen, dass sie eine neue Runde ausspielen wollten. Das war Schlämann zuviel, er erhob sich abrupt, er müsse jetzt gehen. Da Willig gerade einen Grand ohne Vieren gewonnen hatte, vermutete der neue Mann, Schlämann sei geizig. „Wir spielen doch bloß up nen teichtel Penning.” ("Wir spielen doch nur um einen zehntel Pfennig.")
„Das ist es nicht!”, sagte der erregte Wadenmeister und ging.
Einige Tage später, als sie auf dem Tollensesee wieder Tagesfischerei betrieben, nachdem sie eine Woche lang mit geringem Erfolg nachts hinausgefahren waren, unkte Schlämann den Führer nach: „Mich hat die Vorsehung bestimmt, euch in eine lichte Zukunft zu führen.” Fritz Biederstaedt drehte sich um, ob Ernst junior das gehört haben mochte. Das war nicht der Fall. Kurt Willig lachte auf. Es war ein befreiendes Lachen, nach der Verkrampfung die sich eingestellt hatte. Denn er hasste die Disharmonie und er hasste es, sich in der Finsternis auf dem gespenstisch wirkenden See herumzutreiben. Jawohl, die lichte Zukunft lebe hoch. Nachts gehörte ein richtiger Mann eben an die Seite seiner Eheliebsten.
Das Umspuren auf Tagesarbeit sollte sich als richtige Entscheidung erweisen. Ein stiller Novembertag kam und sollte ihnen eine große Überraschung bescheren. Es war ungewöhnlich warm. Das Wetter wäre noch für September schmeichelhaft gewesen. Sie fischten vor Tollenseheim. Wie immer in jenen Wochen gingen sie den Tag mutlos an. Legten wie seit je die Flügel des Zugnetzes zweihundert Meter von der Simsenkante entfernt über dem zwanzig Meter tiefen Wasser aus. Innerlich unbeteiligt taten sie, was sie seit Jahrzehnten ausübten. Ruderten „zu Land“, das Drahtseil hinter sich von den Knüppelwinden abrollend. Ankerten mit Pfählen und starken Leinen im Schilfgürtel, wanden das Netz heran, fuhren langsam „zu Loch“. Zogen und hoben die Wade Stück um Stück herein in die Kähne, missmutig und einander veralbernd. Sie beendeten den Zug, indem sie den Unterspann des großen Wadensackes entmutigt herein zogen. Die Männer nickten einander zu. Sie hätten sich lieber ins Schilf schieben sollen und, statt hier vergeblich zu schuften, zwei Stunden lang den Kummer ausschlafen sollen. Das sei es gewesen. Nämlich nichts, wie immer in den letzten Wochen. Da aber schäumte, völlig überraschend der See vor ihnen auf, als wollte er überkochen. „Brassen!“ schrie einer. „Brassen!“
Normalerweise zeigten sich bei offenem Wasser hunderte Quadratmeter wandernde Blasenflächen, wenn solcher Massenfang bevorstand. Die verängstigten Fische stießen aus den sich heftig schließenden und sich wieder öffnenden Mäulern Luftblasen, die aufstiegen, um im Nu zu zerplatzen. An diesem grauen auf der Wasseroberfläche sich fortbewegenden Blasenteppich konnte man üblicherweise den Umfang und damit ungefähr die Größe des Fischschwarmes einschätzen. Nicht die Spur eines Anzeichens hatte sie diesmal vorbereitet. Die Überraschung war perfekt Nun standen die Fischer händeringend und erstaunt da, jeder dem anderen auf die Schulter klopfend: „Bli! Bli!“
Nur, Peters konnte sie diesmal nicht günstig verkaufen. Erstens war es zu warm, zweitens stellte Berlin so gut wie unerfüllbare Bedingungen. Die Fische sollten lebend transportiert werden.
Wie das? Bei diesen Temperaturen? Das wusste doch ein Kind, dass proportional mit den Wassertemperaturen der Sauerstoffbedarf der Fische anwuchs. Wie sollte er die Massen lebend nach Berlin schaffen lassen? In wie vielen Fässern? Jedes Literchen Wasser verursachte zusätzliche Frachtkosten. Und dann dieser lächerlich niedrige Preis. „Herr Grüneberg! Sie waren doch früher großzügig!“
„Früher, Herr Peters. Die Zeit ist anders geworden, die Menschen haben mehr Geld denn je in den Fingern.“
„Na also!“
„Nix na also, wer hat, hält es zusammen, nicht wahr, Herr Peters. Das Geld ändert die Menschen.“ Er müsse den Käufern heutzutage die Fische billigst nachwerfen, und das habe eben Folgen bis hinauf nach Neubrandenburg. Es klickte. Da wandte Ernst senior sich vom Telefonapparat in der guten Stube weg an Fritz Biederstaedt der mitgehört hatte, und sagte leise, mit belegter Stimme „Krieg möt dat wedder gäben, Fritz. Krieg!“ Dann würden sie ihm jeden Fischschwanz mit Dank und Kusshand wegkaufen. „Krieg möt dat gäben.“
Dieser Satz hallte nach. Teilweise musste Ernst senior Kompensationsgeschäfte abschließen und statt Bargeld seine Fische gegen Karpfen für die Weihnachts- und Silvesterversorgung eintauschen. Schließlich jedoch vermochte er es die über dreihundert Zentner, wenn auch zu einem nicht ganz befriedigenden Preis, bis auf einen kleineren Restposten umzusetzen.
Peters machte soviel Geld, dass er sich außer dem „Adler“ einen schönen dunkelblauen BMW leisten konnte. „Ewer dat har uk miehr Geld warn künnt!“ ("Aber das hätte auch mehr Geld einbringen können.") meinte er, halb mit sich und der Welt versöhnt. Von da an nahm er sich vor, seinen Mitmenschen in Fragen Geldausgeben eine Lektion zu erteilen. Er würde ihnen zeigen, dass Geld wie Blut in den Adern rollen muss, kräftig und frei. Pulsen muss es, am Hals und im Handel, quer durch die Sparkassen hindurch. Das war das Gesetz des Lebens: freier Fluss.
Fritz Biederstaedt avancierte zum Cheffahrer. Herr Peters kam eines Morgens unrasiert und aufgeregt auf Biederstaedt zu, der gerade den BMW gewaschen und abgeledert hatte. Er verlangte, sofort in die Stadt gefahren zu werden. Fritz hatte zu gehorchen. Obwohl der Chef nicht gerade gepflegt aussah. Die wenigen Haare hingen wirr herum. Sein Unterhemd stand offen, und er ging in Holzpantoffeln. Fritz öffnete ihm vorschriftsmäßig die Wagentür. Der Chef ließ sich ächzend in die roten Lederbezüge fallen und streckte, als sei er der Dirigent eines Orchesters die Rechte aus. Geradeaus Fritz, immer geradeaus. Sie ließen das Stargarder Tor hinter sich, und Peters zeigte immer noch geradeaus. Blumenborn kam in Sicht. Der steife Arm des Großpächters wiederholte die Geste. Fritz glaubte, es ginge nach Heidehof, wohin ihn gelegentlich die Gedanken und die Schritte zogen, weil dort ein Mädchen namens Irmgard wohnte, die inzwischen eine junge Frau an der Seite eines Mannes geworden war, der bloß ans Geldverdienen dachte. Doch unmittelbar vor dem Wegekreuz wies der Finger des Fischermeisters nach Süden. Immer geradeaus Fritz. Immer der Nase nach. Der Turm der Neustrelitzer Garnisonskirche tauchte auf und damit der Geruch der bekannten Gaststätte am Markt. Geradeaus! Immer geradeaus!
Fritz nahm sich vor, nicht mehr zu fragen. Es war ohnehin sinnlos geworden, mit dem Manne vernünftig zu reden. Er hatte sich seit einigen Wochen damit abgefunden, dass jegliche, auch haarsträubende Absichten des vermögenden Pächters von ihm widerspruchslos realisiert werden mussten. Er ahnte, dass eine Verrücktheit in der Luft lag.
Hinter Oranienburg schien Herr Peters wieder bei klarem Verstand zu sein, denn gähnend strich er sich über den Schnurrbart. „Wi führn jetz no Berlin ton Hoorschnieden, Fritz!“
„Nach Berlin! Zum Haareschneiden! Meister! Wie Sie wünschen!“ Dabei verstellte er den Rückspiegel, um das Gesicht des Mannes zu betrachten. Sehr wohl, wir fahren einhundertundfünfzig Kilometer in die Reichshauptstadt zum Kämmen und zum Haareschneiden.
In Pankow angekommen, fühlte Herr Peters sich gutgelaunt. Vor dem nächsten Friseurladen möchte er aussteigen. Das nächste Friseurgeschäft befand sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite und war ein Nobelladen. Breite, blitzende Fenster und blaue Übergardinen fielen ins Auge. Seitlich von der Eingangstür hing an einer dünnen Kette ein großes Silberbecken herab. Das Kennzeichen der Zunft der Barbiere, die früher auch den Aderlass ausübten. In makelloser Schrift stand geschrieben: Damen- und Herrensalon. „Meister, se willn doch dor nich rinnergohn?“("Meister, sie wollen doch da nicht hineingehen?") warnte Fritz ehrlich besorgt, fuhr rechts heran und trat mit leichtem Unbehagen zaghaft auf die Bremse. Peters tippte ihm auf die Schulter. Chauffeur Fritz wandte sich um und schaute in die stahlgrauen Kugelaugen eines Mannes, der ihm wortlos und mit starkem Nachdruck bedeutete, wer hier das Sagen hatte und wer der Befehlsempfänger war.
Diese Blicke schienen ihn mit der Frage zu durchdringen: „Oder glaubst du etwa, dass ich ein bisschen verrückt bin?“
Fritz musste sich zusammennehmen, sonst wäre ihm herausgeplatzt: Meister, bloß ein bisschen? Beherrscht, wie er es in dieser Stadt gelernt hatte, dachte er schließlich: Verrückt sind wir allesamt. Was wären wir sonst wohl? Automaten, seelenlose. Das gab Fritz Biederstaedt vor sich selbst zu.
Innerlich aufstöhnend stellte er den Motor ab, stieß mit einem Ruck seine Tür auf, stieg aus, um seinem Herrn und Meister höflich die Autotür zu öffnen, als sollte ein Generaldirektor zum Vorschein kommen. Ihm war schrecklich zumute, als spotteten von allen Seiten höhnisch lachende Gesichter. Denn statt eines Mannes im Frack verließ ein verschwitzter Pferdeknecht den Fond. Mühsam richtete sich der Pächter auf. Fritz hätte vor Scham in den Erdboden sinken können, als Ernst senior in seinen abgelatschten Holzpantinen über das Berliner Pflaster schlurfte. Die Liderlichkeit des Menschen schrie zum Himmel. Anfangs schien ihm, dass alle Uhren stockten. Schließlich nach nicht endenwollender Zeit, nahm Fischer Peters die letzte Stufe zum Friseursalon. Er drehte sich zu seinem Bediensteten um, legte langsam die Hand auf die Türklinke, hob den Kopf wie ein Grandseigneur und verschwand hinter der ominös erscheinden Tür. Fritz erwartete das Schlimmste. Wahrscheinlich hatten hinter den Vorhängen des attraktiven Geschäftes ganze Heerscharen von Angestellten und Lehrlingen gestanden und sich neugierig gefragt, ob der unmögliche Kerl es wagen würde. Er hatte es gewagt! Fritz schielte hinüber. Er konnte den Blick nicht wenden. Gleich werden sie die Tür aufreißen, ihn mit sanfter Gewalt hinausbefördern, wie damals in Gransee, im Cafe, das Peters ebenfalls in ziemlich verwahrlostem Zustand nach einem anstrengenden Arbeitstag betreten hatte. Damals allerdings begleiteten ihn seine ebenso verwildert aussehenden Leute, die jemandem mit zarten Nerven schon durch ihren bloßen Anblick Angst machen konnten. Fritz wusste, was geschehen musste. Die Cafehausbesitzerin, empört über diese Zumutung, hatte ihn aufgefordert, die Gastsstube zu verlassen. In seinen Dreckstiefeln hatte sich Ernst senior breitbeinig hingestellt und unverschämt gekräht: „Wissen Sie nicht, dat ick Fischermeister Peters ut Niebrandenborch bün. Ick hew dat Geld un kann alles köpen!“ Er wünsche sowieso, die ganze käufliche Welt auf den Kopf zu stellen. In das sonst wahrscheinlich unerschütterliche Gemüt der guten Dame hinein schrie Peters damals, er verlange, schnell und höflich bedient zu werden, sonst zerschlage er ihr sämtliches Glas.
Sie würde die Polizei rufen. „Tun sie das, meine Dame. Aber die und die Torte ist meine!“ Dabei stieß er mit seinem Knotenstock, den er bei sich hatte, mitten in die rote Creme erst der einen, dann in den weißen Schaum der anderen. Was ihr sein Spaß wert sei. Unter Zeugen erkläre er, er würde jeden Pfennig berappen, den sie von ihm fordere. Möge sie nur ihren Aufstand machen, seiner wäre sowieso der größere.
Schließlich halfen seine eigenen Leute nach und er fand sich unversehens auf der Straße wieder. „Meisting, dat güng to wiet. Wi hem drunken, un dat bekümmt se nich.“ ("Meister, das ging zu weit. Wir haben getrunken und das bekam ihnen nicht.") Fritz wienerte die Karosse, um seine Nerven zu beruhigen. Mit stockendem Atem erwartete er immer noch den Augenblick des peinlichen Hinauswurfes, bereit, seinen Herrn zu retten, ihn in den Wagen zu zerren und schnellstens die Flucht anzutreten.
Es verging die Zeit. Wer weiß, was er ihnen da drinnen wieder einmal erzählte. Erstaunlicherweise hüllte sich der Salon lange, lange in tiefstes, fast andächtiges Schweigen. Dann ging sie auf die schöne, braune Ladentür. Herr Peters verließ das Geschäft freudestrahlend. Geschniegelt und gebürstet, bestens rasiert und wohlgelaunt, sehr zufrieden mit der deutschen Hauptstadt und mit sich selbst klapperte Peters zurück mit einem Gesichtsausdruck, der besagte, das Pflaster Berlins empfange die Ehre, von exquisiten Neubrandenburger Holzpantoffelsohlen berührt zu werden. Denn hinter ihm herdienernd bedankte sich der Cheffriseur: Der Herr Großfischereipächter möge ihm baldigst wieder die Ehre geben und seinen ihm allezeit zur Verfügung stehenden Salon aufsuchen.
Daraufhin riss Fritz dem Fischereipächter mit geweiteten Augen den Verschlag dermaßen respektvoll auf, dass selbst den kleinen Lehrmädchen, die verstohlen hinter den Gardinen dem einmaligen Schauspiel zusahen, schließlich der einzig mögliche Gedanke kommen musste: Hier fährt ein verkappter, freigebiger Prinz wohlbehütet wieder heim zu seiner königlichen Fee. Frau Anna Peters hätte seine Glücksfee sein können, wenn sie von ihm dementsprechend zuvorkommend behandelt worden wäre, wenn er nicht ständig an eine andere in Möllenhagen gedacht und ihr die Geschenke zugesteckt hätte, die ihr nicht zustanden. Wenn er Anna nicht so oft in den Zorn hinein gejagt hätte.
Wie oft hatte sie, hilflos auf ihn wartend, dagestanden, weil wieder einmal jemand auf unverzügliche Bezahlung einer offenen Rechnung bestand, die sie nicht begleichen konnte, während ihr Mann irgendwo in der Weltgeschichte genau die Summen verschleuderte, um die er zu Hause feilschte. Vielleicht war sie in der Tat immer noch seine gute Fee und er müsste es nur erkennen und sie bloß wachküssen.
Nur, war es dazu nicht bereits zu spät? Es war viel zu spät. In den Herzen der Pächtersleute nagte seit langem der unüberwindliche Vorwurf gegenseitiger Untreue.
Nach einem langen durchfeierten Abend, es war Anfang Juni 37, im Hause der Peters, warf Fritz sich, der seine unentbehrlichen Dienste wieder einmal zur Verfügung gestellt hatte, gegen ein Uhr nachts todmüde ins Heu der Stallung. Gegen fünf Uhr weckten ihn laute Stimmen. Da er neugierig war, kam er aus dem Versteck heraus und wurde sogleich von dem sich ausnahmsweise liebenswürdig gebenden Großpächter angesprochen und genötigt, ihn und die beiden Kaufleute, Bendschneider aus Neubrandenburg und Schober aus Berlin zum Fischfang zu begleiten.
Fritz Biederstaedt wurde vor Schreck nüchtern. Ob der Meister etwa mit den offensichtlich mehr als angeheiterten Gästen aufs unsichere Wasser hinausfahren und selbst die Reusen heben wolle. „Selbstverständlich, Fritz.“ Fritz sollte bereits seit einigen Wochen alles für „selbstverständlich“ halten. Doch das ging ihm zu weit. Falls er mit den Männern in diesem Zustand auf den See hinausfahren würde und einer von ihnen fiele über Bord, würde jedes Gericht der Welt ihm die Schuld für diesen möglicherweise folgenschweren Unfall geben. Zu seinem Glück trafen die Wadenfischer ein, die ausnahmsweise zu Tage fischen wollten. Sofort wies der alte Peters an, dass Schlämann den kleinen Motorheuer am Bollwerk festmachen solle. Mit schrägem Blick auf die drei wankenden Gestalten äußerte Wadenmeister Schlämann seine Bedenken: „Herr Peters, ich mache Sie darauf aufmerksam...“ Peters schnitt ihm aus rauer Kehle das Wort ab: „Ück bün die Verantwortung!“ ("Ich bin...) Die mit fünf Köpfen eigentlich unterbesetzte Fangmannschaft nahm, scharf und leise spottend, in den Arbeitskähnen Platz. Geübt sprangen die Fänger in den schaukelnden, noch leeren Booten umher und legten Pätschen und Ankerpfähle zurecht. Dagegen kletterten und stolperten die drei Herren mehr als sie stiegen, einander umständlich an den Händen haltend, in das Heckteil des von schwarzem, halbverbrannten Öl besudelten Bootes. Ohne Unterstützung des Dieners Fritz wäre das gleich schief gegangen. Fritz hoffte nur, sie würden ihn in Ruhe und an Land lassen. „Nö, Fritz Biederstaedt, du kümmst mit uns mit!“, kommandierte der Chef. Der sechste Mann sei nicht zur Arbeit erschienen. Das also hatte er doch noch bemerkt. Biederstaedt gehorchte, obwohl er sich mehr als elend und außerdem hungrig und durstig fühlte. Es gab noch einen guten Grund, widerspruchslos folgsam zu sein, Fritz hatte sich geschworen, unter allen Umständen seinen schwer erkämpften Rang vor Schlämann zu verteidigen. Er biss also auf die Zunge und plante während der hoffentlich recht langen Anfahrt zum Fangort sich ins allerdings erst einzuladende Garn zu kuscheln und bis zur letzten Minute zu schlafen. Schlämann ärgerte sich. Mehr als schlecht gelaunt wegen der drei Störenfriede, kurbelte er den Heuermotor an, schaute noch einmal fragend ins gerötete Gesicht des Pächters, fand aber keinen Gesinnungswandel und legte abrupt den Gang ein. Die Schraube quirlte das grünlichblaue Wasser des sich hinschlängelnden Oberbaches auf. Auf zu neuem Fang. Zu zehnt total überbesetzt, ging es hinaus. Das konnte nicht gut gehen! Peters meinte wohl, die Wellen würden seine Gäste gehörig nüchtern schaukeln und der frische Wind ihnen wieder das gekühlte Blut ins Gehirn treiben.
Soeben erschien die Sonne über den Hügeln der schönen Viertorestadt. Der Tag versprach, angenehm zu werden, - noch war er es nicht. Die Männer hängten, nach der ersten kurzen Fahrtstrecke am Ende des Oberbaches, die Kähne ab und schoben sich hin zum Zugnetz, das sich auf der Trockenhenkstelle befand. Mit schnellen, tausendmal trainierten Griffen hatten sie binnen zehn Minuten, in denen die beiden Kaufleute sitzend eingeschlafen waren, das schwarz schimmernde Netz in die Arbeitskähne eingeladen. Nun ging es endgültig in Richtung Südwest.
Wieder tuckerte der Motor laut aber gleichmäßig und beruhigend vor sich hin.
Kaum hatte die im Kielwasser schlingernde Fuhre die Linie Augustabad-Belvedere überfahren, hoben und senkten sich die Boote heftiger. Wasserspritzer weckten die beiden schlaftrunkenen Gäste. Das im Sonnenlicht blinkende Wellenspiel machte ihnen plötzlich bewusst, dass sie sich mitten auf dem See befanden, meilenweit entfernt von jeglicher Hoffnung auf Gemütlichkeit. Im Rhythmus der zunehmend härteren Wellenstöße hoben und senkten sich ihre Mägen. „Umkehren!“, schrie Schober.
„Wo denkt ihr hin!“, erwiderte Peters, in ihm waren gerade durch das Rauschen des Wassers die Urjägerinstinkte geweckt worden. Er hatte es im Gefühl, sie würden einen bedeutenden Zug machen.
Kaufmann Bendschneiders Kinn hing beeindruckend schräg herunter. Er kannte den See und den Starrsinn des Großfischers. Er klammerte sich an Schobers neues Jackett, das einen beträchtlichen
Ölklecks abbekommen hatte. „So schön! So schön!“, dröhnte Peters. Er besaß die seltene Gabe, markerschütternd zweistimmig singen zu können. Wenn er richtig losröhrte, schien es, dass die Natur verstummte. Wann immer seine Freunde sich die Ohren zuhielten, um nicht völlig die Kontrolle über ihre Nerven zu verlieren, fühlte er sich besonders ermutigt.
Je mehr es schaukelte und stampfte, umso fröhlicher wurde er.
Aufgestiegen aus der Tiefe in die Höhe!
Das war ihm immer gegenwärtig gewesen.
Grünlich von Angesicht, schickten die beiden Kaufleute sich längst noch nicht ins Unvermeidliche. Sie begehrten energisch, an Land gesetzt zu werden. Peters stieg aufs Schweff.
Wie Napoleon vor Austerlitz dirigierte er mit schwenkenden Armen: „Vorwärts Kameraden!“
Umzukehren vor einer Schlacht? Absolut ausgeschlossen!
Die illustre Fuhre rauschte durch die gischtenden Wellen. Schlämann war wütend. Wenn Peters ihm über Bord fiel, dann war der Teufel los. Zudem musste er auf die beiden Männer im Vorderteil des Heuers Rücksicht nehmen. Ohne sie hätte er Vollgas geben können. Aber das kopflastige Boot kam nicht voran. Immer wieder, wenn das Boot auf dem Wellenkamm ritt, schlug die Antriebsschraube nur Schaum.
Ernst Peters reckte schon wieder den langen rechten Arm, wies diesmal nach Westen auf den Punkt Meyershof. Schlämann krauste die Stirn. Er verwünschte den sich fortwährend einmischenden Pächter.
Indem er dem Befehl sofort nachkam, führte er ihn ad absurdum. Das Steuer herumreißend, brachte er die Kähne quer zur Windrichtung und damit augenblicklich übermäßig in Krängung. Sofort hagelte es aus den Arbeitskähnen laute Proteste. Denn ungemein hart schlugen die nebeneinander liegenden Bootswände aufeinander. Die Boote nahmen außerdem eine Menge Wasser über. Das war es ja, was er wollte.
Er wünschte im Überwind zu fischen und nicht auf der Strömung. Anders konnte er den Alten, der sich sonst ja auch nicht darum kümmerte, wo er das Netz auslegen ließ, nicht überzeugen, dass sein Entscheid widersinnig war. Jedenfalls würde er unter keinen Umständen sich und seine Leute auf der wellenschlagenden Seeseite quälen lassen. Peters, als er so die scheinbare Zunahme der Windkraft zur Kenntnis nehmen musste, lenkte ein. Er machte eine grobe Bemerkung und ließ seinen Oberfischer endlich gewähren, zumal der beteuerte, vor Meyershof sei die Scharkante bereits ab- und leergefischt worden.
Schlämann lachte sich eins ins Fäustchen, drehte vorsichtig zurück. Er schnitt die Wellen, die von achtern immer bedrohlicher heranrollten. Kurz vor „Dörpen“, wo der Tollensesee dreißig Meter tief ist, wogten sie in enormer Höhe. Zwanzig Minuten später, hinter dem großen Schmerberg angelangt, lag das Seewasser erstaunlich ruhig da. Sie waren im Windschatten der sich weit hinschwingenden Buchenwaldhänge angelangt. Die ihren Bauch haltenden Gäste dankten dem Himmel für das Wunder der Windstillung.
Dass er „Mümmelloch“ als Zug ausgewählt hatte, war bald zu erkennen. Peters sprang auf, wollte laut losschimpfen, sah aber die Warnsignale in den Mienen seines Wadenmeisters. „Dor givt dat nix!“("Da gibt es nichts."), reagierte Peters heiser, mit abnehmender Kraft. Auf dem Zug habe er, zu dieser Jahreszeit, noch nie gute Fische gesehen. Schlämann schaute ihn kalt an. Willst du hier auf dem See vor deinen Gästen und deinen Leuten einen handfesten Krach haben, bitte schön. Bei Ostsüdostwind wird im Spätfrühling „Mümmelloch“ oder die „Rill“ gezogen. So war das seit Urväterzeiten. Wenn du das nicht weißt, dann schere dich an deinen Biertisch.
Der Pächter schlug um. Er kommandierte: „Nu wat Mümmelloch treckt, wo ‘t nix gäben det!“ ("Nun wird das M. gezogen, wo es nichts (zu fangen) gibt.") Er wolle vor seinen Freunden den Beweis der Zuverlässigkeit seines intuitiven Wissens antreten. In lautem Plattdeutsch erklärte er, er könne auf zehn Kilo Fisch genau voraussagen, dass hier nichts zu holen sei. Dabei schnalzte er mit der Zunge. „Twintig Pund!“ ("Zwanzig Pfund.") Übermütig reckte Peters den Daumen seiner Rechten. Wer die Wette mit ihm halten wolle. Für zehn Mark verkaufe er im Voraus den zu erwartenden kläglichen Raub.
Bendschneider wollte zugreifen. Peters jedoch stieß den blau und grün aussehenden Schober an. Schober schüttelte den Kopf missmutig, er wolle nach Hause, nichts anderes als heim zu Muttern. Nach dieser unendlich langen Nacht bedurfte er nichts als des liebevollen Trostes. Ernst Peters wollte den Berliner nun erst recht reizen. Ob er Bange habe. Jedes der zu erwartenden zwanzig Pfund koste ihn eine halbe Mark, der Rest sei Gewinn. Eins zu X. Peters unkte, X könnte unter Umständen eine beträchtliche Größe sein und die könne Schober für zehn Mark kaufen. Er verlöre doch höchstens zehn Reichsmark, gewönne aber vielleicht, vielleicht etwas hinzu - egal wie viel. Nach oben sei alles offen. Dabei zwinkerte er noch spöttisch, so dass Schober nicht recht wusste, woran er mit seinem Duzfreund war. Vom Pächter herausgekitzelt, kam im Berliner der Spielerinstinkt zum Vorschein. Der Mann mit Schlips und Kragen griff in die Hosentasche nach dem Portemonnaie. Zwei silberne Hindenburgmünzen lagen obenauf. „Topp!“ Das Geld und die noch nicht gefangenen Fische wechselten den Besitzer. Fritz Biederstaedt, der zwar ununterbrochen gegähnt hatte, und in der Zwischenzeit in den linken Kahn übergestiegen war, wobei er alles beobachtete, konnte sich noch nicht zusammenreimen, was sich gerade zutrug. Denn es waren nur Wortfetzen gewesen, die er aufnehmen konnte. Vielleicht hatten sie gewettet, wann sie wieder daheim ankämen. Die Fischereiarbeiter lösten sich kurz darauf vom kleinen Motorboot und schoben ihre Wadenkähne vom ölverschmierten Heuer ab.
Die Wadenleute ruderten kraftvoll in Richtung Land. Die beiden Hinterfischer nahmen die Hökelsteine des Wadensackes, dann rafften sie ein paar Meter dieses Sackes zusammen und warfen alles zugleich mit Schwung über Bord hinter sich. Ein paar Meter voneinander entfernt patschten die Rundsteine gleichmäßig auf die bewegte Wasserfläche. Diese Gleichzeitigkeit des Aufklatschens galt allgemein als sehr gutes Vorzeichen. Die Fänger beeilten sich, den Sack des Umfassungsnetzes in voller Länge auszufahren. Dann trennten sie sich voneinander, schlugen jeweils einen Winkel von neunzig Grad und fuhren in entgegengesetzte Richtungen die Flügel aus. So trieben die vier Ruderer ihre Kähne voran, während die im Heck der Arbeitskähne stehend arbeitenden Fischer klafterweise die Wade über Bord beförderten. Allmählich nahm der Wind ab. Mehr und mehr glätteten sich die Wogen. Der Himmel blaute, es wurde wärmer. Die Tage der Schafskälte schienen endlich überwunden zu sein.
Kaufmann Schober stellte befriedigt fest, dass sich seine Magennerven beruhigt hatten. Er begann es zu genießen, dass die Männer in den nächsten zwei Stunden ausschließlich für ihn arbeiteten. Vergessen waren alle Übelkeiten, die Müdigkeit und Unlust des Morgens. Freundliche Gedanken tauchten aus der Tiefe seiner Seele auf. Sein Tag brach an. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er sich nach einer durchzechten Nacht nicht hundeelend.
Peters scherzte, sie sollten doch wenigstens einmal erleben, wie ihm in den frühen Jahren seiner großen Fangpleiten zumute gewesen sei und sich trösten mit dem wunderschönen Bild der Natur. Diese sich im Morgenwind wiegenden tiefgrünen Simsenfelder und das Widerspiegeln der Himmelsfarben auf der silbrigen, glattgewordenen Haut des Tollensesees. Bendschneider wunderte sich, denn er hatte gemeint, der Mann Peters sei stumpf geworden für die feineren Empfindungen.
Als Schlämann behutsam und in weitem Bogen um das ausgelegte Netz herumfuhr und in Landnähe kam, stellte er den Motor ab. Sie glitten kaum hörbar zischend am Gelegesaum entlang. Schober bemerkte, dass Schlämanns Blicke im Wasser etwas suchten. Er versuchte sich darin ebenfalls und sah in Metertiefe und immer nur wenige Meter voneinander entfernt verschieden große Hechte unmittelbar vor der Simsenkante. Sie flohen bei Annäherung des Bootsschattens nicht panikartig, sondern schwammen ruhig zur Seite. Ihre grünen pfeilartigen Leiber hoben sich deutlich vom gelblichen Sandgrund ab. Peters winkte ab. Das wusste er doch, dass hier, wo die Wade niemals entlang glitt, stets schöne Raubfische standen und sich sonnten. Im Herbst wird er in diesem
Bereich mit den Dreiwandnetzen staken lassen und sich für den Winterverkauf mit Mümmelloch-Hechten eindecken.
Aber Wadenmeister Schlämann nickte mit seinem schmalen, langen Kopf auf sonderbare Weise. Dann, wiederholt schüttelte er ihn. Ob etwas los sei, fragte der Pächter. „Ach iwo Meister!“, erwiderte er dem leichtfertigen Mann, der sich partout als Genie der Intuition erweisen wollte und nun höchstwahrscheinlich bis auf die Knochen blamieren würde.
Als nach dreißig Minuten, das Auf- und Einziehen des langen Netzes begann, wurde Peters bald blass. Denn kurz hintereinander erschienen zwei große Hechte auf dem Flügel. Wie elektrisiert wirkte er. Sofort war ihm klar, was das bedeutete. Neumann gelang es nicht, die beiden Fische ins lose Garn einzuschlagen.
Eiligst warfen sie sich herum und flohen zurück in den weithin sich ausdehnenden Umfassungsbereich.
Wäre der Vertrag nicht gewesen, hätte Pächter Peters, der alles aufmerksam verfolgte, seinen Hinterfischer heftig beschimpft. Man lässt Fische, die man im Netz vor sich hat, nicht einfach entkommen. So aber konnte er nur hoffen, dass sämtlichen Fischen die Flucht gelänge. Blank müsste der Zug herankommen als gezogene Niete. Da jedoch hob der immer noch ahnungslose Fritz Biederstaedt jubelnd einen anderen Hecht hoch, ein meterlanges Exemplar, als wollte er dem Pächter gratulieren: Sieh mal Chef, was wir für dich tun. Da das erwartete Freudenecho ausblieb, regten sich in Biederstaedt Gemüt unklare Fragen. Er spürte es als noch namenlose Unbehaglichkeit. Erst als im Maschenwerk stattliche Barsche mit ihren leuchtend roten Flossenenden auftauchten und er Ernst Peters Reaktionen der Unlust und sogar des Entsetzens bemerkte, schloss sich der Kreis unsanft. Aus Übermut hatte der Alte eine Riesenwette angezettelt und verloren! Jetzt war es heraus!
Schlämann kniff sich ins Fell um festzustellen, ob er träume oder wach sei. Es kamen immer mehr Fische zum Vorschein, sogar große Plötzen. Die anderen, noch ahnungslos ihr Netz ziehenden Männer schrieen sich gegenseitig zu, hier wären sie richtig. Noch war ihnen nicht zu Bewusstsein gekommen, dass auch der Wadenmeister Schlämann so merkwürdig stupide reagierte.
Übrigens, der Fischzug war längst nicht zu Ende. In diesem Typ des Wadensackes hatten bereits zweimal mehrere hundert Zentner Großbrassen Platz gefunden. Herrn Schobers Gesicht rötete sich. Er starrte entgeistert seinen unerwarteten Gewinn an, der sich auf wunderbare Weise unentwegt mehrte. Pure Goldfische zappelten für ihn. Pächter Ernst hockte sich mit grauem Gesicht auf die ölgetränkte Heuerbord und grub selbstquälerisch in den Windungen seines Verstandes. Reuig suchend fragte er sich, ob ein gnädiges Schicksal ihn einen Winkelzug finden ließe, um sich doch noch aus dem Dilemma zu ziehen. Bendschneider lästerte, ob Ernst Peters sich nun vor Wut in den Hintern beißen könnte?
So erfuhren endlich auch die gleichgültigen unter den Arbeitern, was sich gerade vor ihren Augen ereignete. So also war das. Der Alte bekam Dresche. Schlämann steckte es ihnen dann definitiv. Der Pächter hätte restlos alles für ein Butterbrot versetzt.
Kurt Willig war der Einzige, der gelassen schmunzelte. Dass sie selbst am Ende die eigentlichen Verlierer sein würden, verdrängte er. Auch er gönnte Peters von Herzen eine schmerzhafte Niederlage. Strafe musste sein, weil er sie betrog, indem er ihre Deputate kürzte, weil er ihnen argwöhnisch hinterherspionierte, weil er Jan Schlämann mit dem Fahrrad zuvorgekommen war und ihn mit einer Waffe gestellt hatte. Bloß weil der sich seine früher übliche Sonntagsration illegal zusammengestellt und in einem Fischbeutel verwahrt im Buchort unter einem Weidengebüsch versteckt hatte, verstecken musste, wie sie selbst auch. Weil es anders kaum noch gute Gratisfische gab. Da hatte sich der argwöhnische und knickrige Großpächter auf der Oberbachbrücke mit dem Fernglas postiert und beobachtet, wie Schlämann und sie sich den Mundraub sicherten. Das müssen ihm die Spatzen aus den Dachrinnen zugepiepst haben: Ernst, deine Leute haben einen neuen Dreh gefunden, mit dem sie dich hintergehen. Aber er hatte nie gefragt, warum sie ihn hintergingen. Den Tesching schulternd, war er in seinem roten Zorn hingeradelt nach Buchort und hatte sich da
rechtzeitig auf die Lauer gelegt. Als endlich der Wadenmeister am Ort ankam und die Beute suchte und fand, hob Peters die Waffe, richtete sie auf den Übeltäter mit den schockierenden Worten: „Jan! Klaut ward nich!“ ("Jan, geklaut wird nicht!") Sogar Fritz Biederstaedt freute sich, den übermächtig gewordenen Mann leiden zu sehen. Das war die Strafe für den sich zunehmend unerträglich auswirkenden Hochmut. Alle Hochmütigen der Welt müsste man einen Tag in der Woche mittels ähnlicher Kur behandeln. Inzwischen kamen die Passagiere, des von Herrn Bendschneider vorwärtsgeschobenen Heuers, noch näher an die schließlich den Wadensack ziehenden Fänger heran. Der Wind war völlig abgeflaut.
Der langgestreckte See lag in seiner ganzen Ausdehnung wie ein Riesenspiegel da. „Meisting!“, rief Fritz heimtückisch, „hem wi nich siehr schöne Fisch fungen?“ ("Meister, haben wir niht sehr schöne Fische gefangen?") Seine dunklen Knopfaugen funkelten listig. Er dachte an frühere Backpfeifen zurück, die er vom Alten zu Unrecht bekommen hatte. Mit schnellen Handgriffen deckte er das Oberteil des Sackzeuges auf. Erst jetzt sah man die ganze Bescherung.
Die große Anzahl grüner Hechtrücken erschreckte sie allesamt. Solch reicher Vorsommerzug gehörte seit je zu den Ausnahmen. Mit einem Ruck streifte Fritz Biederstaedt die Ärmel hoch und griff in seiner Erregung tief ins Wasser. Die Fingerspitzen und die Haut seiner bis über die Ellenbogen eingetauchten Rechten empfanden die Menge weicher, glatter Aalleiber wie ein ihn umgebendes Knäuel Schlangen, - nur angenehmer. Schnell packte er einen der Starkaale, riss ihn aus dem Wasser, hob ihn stellvertretend für die anderen ungefähr zweihundert Stück in die Höhe. Es dauerte nicht lange und der hochaktive Fisch vermochte sich aus dem geübten Griff seines Peinigers zu befreien. Hart auf die Wasserhaut klatschend, entkam der muskulöse Fisch zunächst noch einmal. Der griesgrämige Bendschneider zuckte nervös zusammen. Pächter Peters brummte. Das Schlimmste war, er hatte seinem Freund Schober in die Hand versprochen, ihn in bar auszuzahlen. So fiel außerdem noch die Qual des Verkaufs auf ihn. Jede einzelne Reichsmark, die er aus dem Verkauf dieser Fische, die ihm nicht gehörten, erlösen wird, wird sein Herz mit Kummer belasten. Wie ein Lauffeuer würde die Rede von seiner Dummheit durch die Straßen der Viertorestadt sausen.
Aribert Schober legte seinem lieben Freund Ernst Peters die beringte Hand auf die hängende Schulter und sagte heuchlerisch weich: „Kondoliere Ernst!“ Und im selben Atemzug: Jetzt könne er sich das ja leisten. Er lade alle Anwesenden zu einem Umtrunk im nahen „Heidehof“ ein.
Schlämann ignorierte des Chefs Gefühle. Gern nehme er mit seinen Männern die freundliche Einladung an. Der Herr wird diesmal nicht darauf bestehen, dass sie die Fische erst nach Neubrandenburg schaffen müssten um sie dort in die sicheren Hälterkästen zu setzen. Denn falls sich ein Loch im Sack befände, käme es diesmal - welch’ verkehrte Welt - seinen Wünschen nur entgegen. „Kumm Ernst“, spöttelte nun auch Herr Bendschneider, „dat helpt ja allens nich, Spoß möt sin.“ ("Komm Ernst, es hilft ja alles nicht. Spaß muss sein.")
Ernst Peters versuchte ein Lächeln aufzusetzen. Das misslang ihm. Als sie an der kleinen, nach dem letzten Eisabgang verschobenen und unsicheren Heidehofer Brücke angelangt waren und die fünfzig Stufen fast hinter sich gelassen hatten, wandte er den trostlosen Blick. Der herrliche See lag wie ein kostbares Gemälde zu seinen Füßen und verhöhnte ihn. Ich bin dein, aber nicht dein allein. Das satte Grün und die dunklen Konturen malten sich auf der blinkenden Fläche wieder. „Nicht dein allein.“
Wenn er jetzt einen Wunsch frei hätte!
Schwerfällig stakend nahm Pächter Peters die letzten Stufen der steilen Holztreppe. „Achthunnert Mark!“, jammerte er. Fritz hörte es. Jede Stufe musste ihm den Betrag den er so schmählich verloren hatte, schmerzhaft ins Gehirn hineingebohrt haben. Achthunnert Mark, achthunnert Mark! Für das Geld bekam man ... Fritz, der die junge Frau des Gastwirtes wieder zu sehen hoffte, wollte und konnte mit den Männern nicht lange mithalten. Kurz nach zwei ging er hinaus. Er suchte nicht lange, obwohl er ahnte, sie müsste in der Nähe sein. Die Müdigkeit übermannte ihn. Da es warm war, legte Fritz sich auf der Sonnenseite des Grundstückes ins Gras unter einen abgeblühten Forsythienstrauch. Da würden sie ihn schon entdecken, wenn sie heimzukehren wünschten. Biederstaedt schlief sofort ein, umschmeichelt vom sanften Wehen der erwärmten Mittagsluft. Um vier Uhr begaben sich die Fänger zu den Booten, füllten die Fische aus dem sprudelnden Wasser im Wadensack hinüber in den Heuer, mussten sich beeilen, denn bei diesen Mengen Barschen, Aalen und Hechten wurde das Schweffwasser knapp, obwohl sie mit ihrer Körperlast für zusätzlichen Tiefgang des Motorheuers sorgten. Sie rauschten davon in Richtung Neubrandenburg. Doch ihr Blick und Verstand waren sehr getrübt.
Obwohl es noch heller Tag war, vermochte es Jan Schlämann, der die Steuerpinne umklammert hielt, nicht, die ihn heimtückisch anschleichende Schläfrigkeit zu beherrschen. Auch der Selbstvorwurf, soviel hätte er nicht trinken dürfen, machte ihn nicht munterer. Gegen diese Art von Körperschwere half wenig, die selbstgestellten Denkaufgaben zu lösen, die ihn normalerweise wachhalten konnten. Wiederholt nickte er am Steuer ein, riss sich allerdings immer wieder energisch hoch, sah, dass auch Herr Peters abgeschaltet hatte und seinen Kummer ausschlief. Belustigt nahm er noch wahr, wie Schober und Bendschneider, diesmal im Heckteil, auf der schwarzen Bank vor ihm, eng aneinandergerückt, dahockten. Ihre Köpfe und Schultern sanken unentwegt herunter und eben so oft richteten sie sich mit halber Willenskraft auf. Die unbequeme Haltung und die lauten Motorgeräusche sowie das wiederholte Aufstauchen des wasserschneidenden Stevens auf die Wellenkämme, die der sich plötzlich neu erhebende Nordost verursachte, ließ die beiden offensichtlich nicht richtig zur Ruhe kommen. Andererseits drückte sie die Last traumschwerer Lider nieder. Auch die fünf Männer in den Wadenkähnen schliefen.
Jan Schlämann fühlte mit ihnen, bis auch ihn, unglaublich sanft, aber mit süßer Macht, die schwarze Nacht umarmte.
Plötzlich schrammte es hart. Die beiden Herren wurden nach vorne auf die Schweffdeckel geschleudert. Schlämann stieß sich die Knie und stürzte mit unwillkürlich gespreizten Armen auf die beiden Kaufleute.
Sofort krachte es zum zweiten Mal. Die im Schlepp befindlichen, noch frei schwimmenden Arbeitskähne waren aufgefahren. Dieser Ruck schob den Heuer noch höher hinauf auf das unsichtbare Hindernis, wobei, mit peitschenknallendem Geräusch, eins der starken Sisalseile platzte. Es wirbelte noch etwas herum. Das waren die netztragenden Wadenkähne. Sie schwenkten augenblicklich ein, stießen gefährlich gegen andere Steine. Der Heuermotor lief weiter, die Schraube rotierte noch. Schlämann machte dem Spuk ein Ende. Sekundenlang herrschte das Schweigen des Entsetzens. Außer den beiden Gästen war jedem klar, wie schlimm das war, was sich zugetragen hatte. Nur, das Wissen darum änderte noch nichts an der Situation.
Da ragte er hervor, der „Große Stein“ an Land, der Vater der vielen Kleinen rings um ihn herum, am Steilufer vor Dörpen und Schopwasch.
Ernüchtert vernahmen die Männer Schlämanns Kommandos, der, ohne sich um die Anwesenheit des Chefs zu kümmern, anordnete, was sofort zu tun sei. „Leinen lösen!“ Seine ganze Art verriet seine Verachtung für den Pächter, dessen Leichtsinn sie das Pech des Tages zu verdanken hatten. „Dat geiht nich!“ ("Das geht nicht!") sagte Kurt Willig und zog das Taschenmesser. „Jawoll! Dörchschnieden!“ ("Durchschneiden!"), bestätigte Schlämann. Es gab einen Ruck der Entspannung.
Dann stellte Neumann als erster fest, dass Fritz Biederstaedt fehlte. Auch das noch! Fritz war während der Überfahrt unbemerkt über Bord gefallen! Wie Messerstiche fuhr ihnen der Schreck in den Leib. Ein Blick zurück zum schräg gegenüber liegenden Heidehof. Vier Kilometer weißblaue Wellen und sonst nichts. Sofort mussten sie das auf einem Felsbrocken gestrandete Motorboot flott ziehen. Höchste Eile war geboten. Zu sechst, einschließlich des immer noch kopflosen Pächters, bemühten sie sich mit Leibeskräften, vom Heuer aus und in den zwischen den Steinen wieder freischwimmenden Arbeitskähnen mit Pätschen und Stangen das Zugboot frei zu schieben, herunter von diesem dämlichen Stein. „Zugleich!“ Sie stemmten sich mit äußerster Anstrengung dagegen, um den Heuer auch nur um Daumenbreite zu bewegen. Es gelang nicht. Den vier Männern im aufgelaufenen Heuer war klar, dass ihr Eigengewicht sich zusätzlich nachteilig auswirkte. Doch aus dem Motorkahn in die anderen Kähne über zusteigen war der Tieflage der Arbeitsboote wegen und andererseits wegen der vielen weiteren knapp unter der Wasserlinie befindlichen Hindernisse unmöglich. Ein Anlegen nebeneinander verbot sich deshalb und wegen des heftigen Wellengangs ebenfalls. Außer der Sorge um Fritz, die alle vorwärts trieb witterte Peters bereits eine Minute nach dem Auflaufen höchste Gefahr für den Fang. Denn er hörte, wie die Hechte im fast leer gelaufenen Schweff nur noch matt umherpatschten. Durch die Wucht der Auffahrt hatte sich der Heuer um ein paar entscheidende Zentimeter höher aus der Wasserlinie gehoben. Das Schweffwasser rann durch die Löcher. Wenn nun noch die Fische verreckten, dann war für ihn das Maß voll. Karl Neumann schlug in seiner Aufregung vor, die Männer im Schleppboot sollten sich ausziehen und über Bord springen. Das musste ihnen doch einleuchten, denn Fritz Biederstaedt kämpfte im sturmbewegten See vielleicht nicht mehr lange. Das Seewasser war noch zu kalt.
Aber die Herren zögerten. Neumann schüttelte den gewaltigen Kopf. Mit diesen wasserscheuen, hirnlosen Kerlen sitzt er nun zusammen auf dem See fest, angebunden sozusagen wie ein Kalb an einer Kette. Statt sich die Siebensachen vom Leib zu reißen und ins Wasser zu springen, erwiderten sie ihm, er sei ein Klugscheißer, er solle ihnen das mal gefälligst vormachen. Karl Neumann fauchte sie an. Er würde es tun. Er hatte schon die blaue Bluse über die roten Ohren gerissen, da brüllte Schlämann, ob er verrückt geworden sei und kommandierte ebenso laut: „Zeug überziehen!“ Neumann trieb der Gedanke zur Hast, er läge an Biederstaedt Stelle im schäumenden See. Ob sie sich immer soviel Zeit ließen, das einzig Richtige zu tun?
Es war natürlich vernünftig, einen der beiden Arbeitskähne zu erleichtern. Mit dem leeren Boot kämen sie nahe genug heran um die Heuerbesatzung aufzunehmen. Peters schrie dazwischen, sie sollten sich endlich beeilen, ehe die Fische krepierten.
Neumann und Willig haspelten mit fliegenden Händen das Garn und die Leinen herüber. Beide in Wut. Die schönen Fische. Und Biederstaedt?
Sie hatten natürlich schon überlegt, die Wadenboote zu verankern und den Havaristen mit den vorhandenen Knüppelwinden und dem Drahtseil frei zu schleppen. Doch das verbot die Uferbeschaffenheit. Seeseitig fiel nach wenigen Metern das Gelege stark ab. Solchen langen Pfahl hatten sie nicht, einen entsprechend großen, tief genug greifenden Anker ebenfalls nicht.
Endlich gelang es, die vier Männer in den entleerten Wadenkahn einsteigen zu lassen. Alle dachten, nun würden sie das an einer kurzen Leine befestigte Motorboot schnell frei bekommen. Sie wollten es glauben. Sie zerrten und ruckten, sie stöhnten und fluchten. Es wollte nicht gelingen. In seiner Verzweiflung machte Ernst Peters Anstalten, sich zu entkleiden. Die Angst Schober würde auf Schadensersatz bestehen, brachte ihn fast um den Verstand. Das wäre effektiv eine Verdopplung der Schadenssumme. Karl ahnte, was sein Herr vorhatte. Der kräftige Pächter wollte sich unter das Heck des havarierten Heuers bücken und mit voller Manneskraft den letzten Versuch wagen, das Boot auch nur millimeterweise anzuheben.
„Ick mok dat, Meister!“ ("Ich mache das, Meister"), rief Neumann mehr als eifrig. Wenn einer über die erforderlichen Kräfte verfügte, dann war er das. Der Zorn seines Kindergemütes war umgeschlagen in kalte Entschlossenheit. Nun entkleidete er sich wirklich. Im Nu zog er sich Hemd und Hose vom Leib. Weiß leuchtete sein gewaltiger Hintern.
Er sprang schnell ab. Rauschte nackt durchs beißend kalte vom Sturm heraufgewirbelte Tiefenwasser, das ihm bis zur Herzgegend heraufschlug.
Rein gefühlsmäßig wusste er, was er tun müsste, wie tief er sich bücken, wie er sich hinstellen, wo die Schulter ansetzen und wann er seine kolossalen Muskeln strecken musste. Unmittelbar, bevor die nächste größere Woge heranrollte, schrie er laut: „Tau!“ ("Jetzt!") und straffte den gebräunten, aus dem Seewasser auftauchenden Oberkörper.
Kurz darauf war der Heuer befreit. Alle tatschten und klopften wenig später dem nackten Karl Neumann auf die Schulter und die Hüften und hielten, was er getan, im Übrigen für eine Selbstverständlichkeit über die niemand je wieder nachdenken wird. Peters sträubte sich zurückzufahren. „De Kierl is längst to Hus!“ ("Der Kerl - Biederstaedt - ist längst zuhause."), behauptete er. Seine Zähne knirschten.
Als erstes kümmerte er sich um das Wohlbefinden seiner, besser gesagt Schobers, Fische. Er hob den Schweffdeckel und stellte überrascht fest, dass sie die trockene Viertelstunde anscheinend schadlos überstanden hatten. „Meister“, sagte Schlämann ernst, „sünd Se sicher, dat wi Fritz nicht verloren häm?“ ("Sind sie sicher, das wir Fritz nicht verloren haben?")
Ernst Peters hob den eckigen Kopf und schüttelte ihn. Natürlich nicht! Er tippte gegen die eigene Stirn. Sein Hirn sage ihm, der Kerl läge hundertmal eher bei einem Weib im Bett oder sei längst daheim, als so blöde zu sein und mir nichts, dir nichts über Bord zu gehen. Insgeheim gab Schlämann ihm Recht. Anderes wäre ja nicht auszudenken.
Dennoch mussten sie die Suche aufnehmen. Nicht einer konnte sich erinnern, ob er denn mit ihnen gekommen sei. Das war ja das Sonderbare, das sie so beklommen machte.
Während der Rückfahrt zur Gaststätte Heidehof hielt sogar Ernst Peters Ausschau nach ihm oder nach Anzeichen seiner Kleidung. Manchmal hatte man einen schwimmenden Schuh oder Stiefel gefunden, den Ertrinkende sich vom Körper gerissen hatten. Nicht selten zogen sie sich in Panik gänzlich aus.
Sie fanden nichts, auch in der Gaststätte erhielten sie keine Gewissheit. Der aufhorchende Wirt reimte sich wahrscheinlich einiges zusammen. Er stotterte hilflos. Er starrte Peters sen. vorwurfsvoll und finster an. Der Pächter ballte die Fäuste und fluchte beim Herabsteigen der steilen Ufertreppe, seine schlimme Befürchtung nicht mehr verbergend. Schweigend fuhren sie heim. Was sollten sie Biederstaedts Frau sagen?
Eine Stunde später bog ihr Heuer in den Oberbach ein. Die Stimmung war unerträglich. Es würden mehrere Fischerfrauen dastehen, sie ärgerlich erwarten und unbequeme Fragen stellen. Die Sonne schien bereits von Nordwesten herein.
Da sahen sie jemanden, der winkte. Fritz Biederstaedt! Er stand wie ein Gespenst scheinbar in der Luft. Er war auf einen Baumstubben geklettert und rief, als sei nicht das Geringste passiert, mit seiner dunklen Stimme, wo sie denn um Himmels Willen solange gesteckt hätten. „Ick hew mi Sorgen mokt üm juch!“ ("Ich habe mir schwere Sorgenum euch gemacht.")
Da brach es laut und grob aus allen Mündern zugleich hervor. Was er sich einbilde, sie an der Nase herumzuführen? Ein Schwall von Worten ergoss sich über den insgeheim von jedem für verloren gehaltenen Fritz Biederstaedt. „Dämelack, alter!“, schimpfte Peters und tobte noch einmal los, den ganzen Kummer und die Spannung der vielen Aufregungen von der Seele reißend. An dem Tag als die Neubrandenburger Zeitung davon berichtete, dass in Hamburg der Stapellauf des ersten deutschen schweren Kreuzers stattfand, standen Fritz und Jan Schlämann arbeitend im Hof. Sie flickten das am Vortag zerrissene Zugnetz wieder zusammen. Plötzlich wandten sie die Köpfe gleichzeitig. Denn oben im Haus war geräuschvoll ein Fenster aufgestoßen worden. Ernst junior grüßte zackig herunter. Er winkte mit der Zeitung, rief übermütig: “Dat wat fiert!“ ("Das wird gefeiert.") Die beiden Männer schauten sich verdutzt an. Kurz darauf erschien der junge Chef auf dem stets aufgeräumten Fischereihof. Er trug zwei braunfarbene Bierflaschen in der Rechten, eine dritte unter dem Arm, während er mit der Linken immer noch das große Blatt schwenkte. Auch seine glänzenden Stiefel fielen ins Auge. „Dorup möten wie anstöten!“ ("Darauf müssen wir anstoßen."), rief er bewegt. Biederstaedt liebte des Juniors Herzlichkeit und griff zu, ehe er wusste, was er begrüßen und feiern sollte. Schlämann, als er hörte, worum es ging, kniff vorsichtshalber die Lippen zusammen. Dennoch brummte er vor sich hin. Die beiden jüngeren Männer hatten ihre Meinungen in einer, seiner Auffassung nach, sehr oberflächlichen Art und Weise gebildet. Was die Zeitung schrieb hielten sie für wahr und gut. Schlämanns Überzeugung nach schwärmten sie von Sachen, die ihnen selber schlecht bekommen würden. Nach den ersten geleerten Flaschen holte Ernst junior neue. Dem Griesgram zum Trotze tranken und freuten sie sich. Schließlich blies Fritz Biederstaedt, wenn auch nur aus Sympathie für Ernst, die dicken Backen auf und trompetete übermütig: „Deutschland, Deutschland, über alles...“ Dabei warf er aus der Stimmung heraus die kräftigen Beine im Paradeschritt. Sein Freund Peters junior machte sogleich mit. Während sie exerzierten, streckten beide die Arme aus, jeder seine Bierflasche wie eine senkrecht stehende Fahnenstange in der Hand, beide beschwipst. Durch die Erschütterungen und Schüttelei kam Schaum hoch und quoll über den Flaschenrand. Meister Schlämann ließ aus Empörung die Arbeit liegen und ging nach Hause. „Dummheit lässt grüßen!“ murmelte er grantig, konnte und wollte das nicht mit ansehen.
Damit spaßte niemand ungestraft. Dass Deutschland wieder Waffenfestung sei in der Welt und irgendwann „mehr“ als der Tommy sein wollte, hielt er für tödlich.
Als Monate später die beiden Peterssöhne Heinz und Ernst nach Nürnberg zum Reichsparteitag fuhren, knurrte Schlämann vor Biederstaedt unvorsichtig, dass der Hitlersche Größenwahn dem nächsten Katzenjammer bloß vorauseile.
Die Jungen seien dabei, verblendet wie jene bei der Begeisterungswelle 1914, sich in ihrer Beschränktheit das eigene Grab zu schaufeln. Dass er mit dieser Unkerei tatsächlich seine Verachtung zum Ausdruck gebracht hatte, bemerkte er jedoch erst, als Fritz ihn bösartig anfunkelte. Auf seinen Freund, Ernst junior, ließ ein Fritz Biederstaedt auch nicht den Schatten eines Makels fallen.
Fritz Biederstaedt hatte sich eine Illustrierte gekauft die vom Reichsparteitag berichtete. Ihm war die große Begeisterung der Reporter wie eine warme Woge entgegen geschlagen. Die herrlichen Bilder hielt er Meister Schlämann am Tage nach dessen unbesonnener Kritik vorwurfsvoll unter die spitze Nase. Doch Schlämann erwiderte fest: „Fritz mark di dat. Övermaut deit selten gaut.“ ("Fritz, merke dir das. Übermut tut selten gut.")
Eine ganze Woche lang, nachdem er wieder heimgekehrt war, schwärmte Ernst junior, während der nächtlichen Arbeit des Fischens, wie er den Reichsparteitag empfunden hatte. Unentwegt hätten sie jubeln können. Niemand fühlte mehr den Regen und die Kälte, als ihr Führer auftrat.
 |
| Bild Wikipedia: Reichsparteitag Nürnberg, 1938 |
Biederstaedt hörte gespannt zu, als Ernst schilderte, wie er und Heinz den großen Amtswalter-Appell der NSDAP aus gewisser Entfernung miterlebt hatten. Es war am Abend gewesen. Hunderte Scheinwerfer zauberten einen Lichtdom über den Häuptern von zweihunderttausend Menschen. Aus der Ferne dröhnte die Rede Adolf Hitlers: „Dass ihr mich gefunden habt, unter so vielen Millionen, ist ein Wunder! Dass ich euch gefunden habe ist Deutschlands Glück!“
Überwältigt vom Strom der Freude hätten er und Heinz schließlich nur noch geschluchzt: „Unser geliebter Führer!“
 |
| Bild Wikipedia: Leibstandarte Adolf Hitler. 1938 |
Fritz liebte die Petersjungen. Beides blonde Recken, beide mit hochfliegenden Plänen und hehren Idealen von der Größe ihres Volkes.
Es gab also doch eine Vorsehung.
„ Ein Volk, ein Reich, ein Führer!“ Das klang wie Musik. Doch bereits drei Wochen später bemerkte Fritz, dass Ernst bedrückt umherlief. Dass er Kummer hatte, stand ihm ins Gesicht geschrieben. Fritz fragte ihn schließlich, doch Ernst winkte ab. Noch möchte er darüber nicht reden.
Unfähig zunächst, sich auszusprechen, verbarg er andererseits nur schwach, dass sich etwas verändert hatte. Eines Nachts, nachdem Ernst und Fritz die Fische aus dem Wadensack gekeschert und sich eine Weile nebeneinander gesetzt hatten, um auszuruhen, gab Ernst junior zu, dass er schwer erschüttert und wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen wäre.
Sein SS-Führer Gau habe ihm auf den Kopf zugesagt: „Ernst, du hesst doch Juden in diene Verwandtschaft, nich?“ ("Ernst, du hast doch unter deinen Verwandten Juden, ncht wahr?")
Mit großer Beklemmung und bloß stotternd hätte er dem Grobian Gau auf die Frage nach dem Ariernachweis von Tante Ilse antworten können: „Deutsche Verwandtschaft, Deutsche!“
Er habe endgültig zur Kenntnis nehmen müssen, dass gewisse Theorien Hitlers ihn praktisch und persönlich nachteilig betrafen.
Danach ging es mit seiner SS-Gesinnung steil bergab.
An diesem Umschwung nahm Fritz betroffen Anteil.
Ernst erzählte plötzlich Einzelheiten über eine Stadt Guernica. Hitlers Göring hätte diese Stadt schon vor Monaten ausgelöscht. Der Begriff „auslöschen“ hatte nach der Frage des SS-Führers Gau,
weil sie in beängstigender Weise gegen Tante Ilse zielte, in seinem Innern wie eine Kolik gewühlt.
Solange sei ihm das Schicksal der baskischen Stadt Guernica gleichgültig gewesen, wie der Name irgendeines Unbekannten, der in einer fremden Stadt gestorben war. Doch nun sah er verbotene, aber wahre Fotografien mit unfreiwilliger Gedankenverbindung zu seiner nichtarischen Verwandtschaft. Da lagen Schulmädchen neben Pferdekadavern, alles in Stücke gerissen. Das haben Deutsche gemacht! Deutsche wie er.
Ernst fühlte sich verraten und verletzt.
Er sammelte immer mehr bittere Erfahrungen, bis er schließlich Biederstaedt und Schlämann gegenüber insgeheim bekannte, dass die allgemeine SS, der er angehörte, nur eine gemeine Bande sei. Diese unflätigen Redensarten und geistlosen Prahlereien der meisten Vorgesetzten regten ihn längst auf. Selbst die Anzüglichkeiten, wenn über Mädchen zweideutig gewitzelt wurde, mochte er nicht.
So leichtfertig, so miserabel von lieben Menschen zu reden, sei ihm ein Gräuel. Dieselben Halunken, die eine verheiratete Frau zu einem Abenteuer überredet hatten, stellten ihr hinterher ein miserables Zeugnis aus. Einerseits hieß es „Blut und Ehre!“, andererseits wühlten sie im Dreck der Unehre. Alles, was sie über die Juden sagten, sei zotig und verlogen. Wie begründet erschien Ernst Peters jetzt dagegen die damals noch unverständliche Angst der Tante Ilse. Bitte Ernst, verrate mich nie!
Die Organisation, der er zugehörte, sei ein Ungeheuer.
Ob Heinz, wenn er diesen seinen Gesinnungswandel erkannte, schweigen würde? Nun da er in Berchtesgaden Dienst leistete?
Es war beängstigend, den jüdischen Exodus mitzuerleben. Vor der Machtergreifung Hitlers wohnten über einhundert Juden in Neubrandenburg. Jetzt konnte man sie an zehn Fingern abzählen. Die Heines zu dritt, zu zweit Angehörige der Familie Rosenstein. Wer noch? Die Geschwister Wolff, das machte sieben. Die Schwestern Eliasowitz, Abraham Salomon, Paula Kallmann, Frau Jakob. Es mochten noch vierzehn verwegene, heimattreue Leute sein. Mehr nicht. Doch wie es schien, waren diese wenigen Harmlosen gewissen Bösewichtern dennoch ein Dorn im Auge. Jedenfalls hetzten sie, je mehr sich die Proportionen zu Ungunsten der heimischen deutschen Juden verschoben.
Weshalb, fragte Ernst junior sich? Keiner verkaufte so billig wie die Heines, wie die Wolffs. Ihre Verwandtschaft hatte zwischen 1914 und ’18 im Kriege höchste Lorbeeren geerntet. Eiserne Kreuze, sogar den „Pour le merite“.
„Was“, fragte Ernst Peters junior sich, „war der wahre Grund für den deutschen Rassenhass?“ Er konnte es sich nicht erklären. Denn denjenigen Juden, die Christen geworden waren, gestanden die Verfolger - wie es ihm schien - Sonderrechte zu. Diese Leute beschimpfte kaum jemand trotz ihres Judenblutes. Es ging also gar nicht um die angebliche Schädlichkeit des jüdischen Erbgutes. Ging es vielleicht um die Befriedigung eines Hasses aus Neid?
Ernst spürte natürlich, dass eine gewisse niederträchtige Stimmung gelegentlich auch ihn befiel, die er jedoch schnell überwand und der er nicht erlaubte, ihn zu verderben.
Wann immer er andere nach dem wahren Grund der anhaltenden Verwünschungen fragte, gab es lediglich ein trotziges „Darum!“
Die ihm namentlich und von Angesicht als freundliche Mitbürger bekannten Juden sprachen wie alle, dachten wahrscheinlich nicht schlechter und nicht besser. Nur der üble Atem ihres Fastens war da, und das Faszinierende ihrer geistigen Wendigkeit. Deshalb? Das verstehe, wer will. Noch nie hatte er einen einzelnen Neubrandenburger im Gespräch unter vier Augen reden hören, man müsse die Heines oder die Rosensteins wegjagen. Im Gegenteil, jeder lobte sie für ihre Großzügigkeit. Was, um alles in der Welt, war des Pudels Kern? Ernst junior täuschte sich nicht. Es lag etwas nie Dagewesenes in der Luft. Der Führer allein konnte diese Stimmung nicht über die Städte legen. Auch der Geist von ein paar tausend Fanatikern, die nie irgendwelcher Argumente bedürfen, konnte nicht diesen undurchdringlichen, flirrenden Nebel machen. Gnadenlos wird es den Harmlosen an den Kragen gehen. Warum? Warum wirklich? Das war ihm ein Rätsel. Daran würde er sich niemals beteiligen. Deshalb würde er nie wieder nach Nürnberg
fahren, so schön und gastlich die Stadt ihm auch erschienen war und so beeindruckend diese Massenaufmärsche auch auf ihn gewirkt hatten. Viel lieber fuhr er auf den See und genoss die Stille und die Schönheit der Natur.
f Da konnte er Heinz nicht verstehen, dass der immer noch mit Begeisterung Hitlers und seines Luftmarschall Görings Angriffe deutscher Sturzkampfbomber auf spanische Städte verteidigte. Diese furchtbar heulenden Ju 87 hatten ihre Bomben über wehrlose, schlafende Städter ausgeklinkt.
Sie könnten dem Falangistenführer Franco zwar zum Sieg verhelfen. Aber was, außer dem Ruf, Mörder zu sein, würden sie sonst noch dauerhaft erwerben?
In dieser Nacht brannten Ernsts Kameraden in Neubrandenburg die Synagoge nieder.
Obwohl sich der Feuerschein am Himmel widerspiegelte hatten er und seine Männer es nicht bemerkt, da sie in einer von hohen Buchen eingeschlossenen Bucht arbeiteten.
In dieser Nacht, einen Monat nach seinem sechsundzwanzigsten Geburtstag, brannten reichsweit zweihundertundfünfzig Synagogen.In London und Paris, sogar in New York hörten die Menschen den Schrei und sahen später entsetzt die heimlich aufgenommenen Bilder.
 |
| Bild Wikipedia, 1938 Synagoge zu München |
Einundneunzig deutsche Bürger jüdischen Glaubens wurden in dieser Nacht, vom 9. zum 10. November ermordet und ihr Blut verlangte nach Rache.
Doch der deutsche Alltag schien wie gewohnt seinen Fortgang zu nehmen.
Ernst wusste nun was er tun musste. Er würde versuchen sich zurückzuziehen von diesen Unmenschen. Hätte er sich seine ersten heimlichen Bedenken nur eher zu Herzen genommen.
Einmal hatte einer von der höheren SS-Charge die Katze aus dem Sack gelassen: “Was wir Ausbilder des Führernachwuchses wollen, ist ein modernes Staatswesen nach dem Muster der hellenischen Stadtstaaten. Fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung, ihre beste Auslese soll herrschen, der Rest hat zu arbeiten und zu gehorchen! Innerhalb von zehn Jahren wird uns auf diese Weise möglich sein, Europa das Gesetz Adolf Hitlers zu diktieren und die wahre Völkergemeinschaft mit Deutschland als führender Ordnungsmacht an der Spitze aufzubauen... ihr Mitglieder der SS seid des Führers Elite!“
Diese Elite steckte nun Häuser an und verprügelte wehrlose Grauköpfe! Jeder Satz den er je zugunsten Hitlers gesprochen peinigte ihn. Wie hatte er sich je freiwillig unter den „Führereid“ stellen können? Wort für Wort des Gelübdes kam ihm in den verstörten Sinn: „Ich schwöre dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Reiches Treue und Tapferkeit. Ich gelobe dir und den von dir bestimmten Vorgesetzten Gehorsam bis in den Tod, so wahr mir Gott helfe!“
Jawohl, er, Ernst Peters junior, war so töricht gewesen, diesen Eid des SS-Mannes auf sich zu nehmen, - doch er wird ihn brechen, gemäß seinem Gewissen, das für ihn über jedem Gelöbnis stehen wird, solange er atmet.
Der stete Aufstieg und der schnell vermehrte Reichtum kombiniert mit den Symptomen der ersten Stadien von Delirium tremens führte zunehmend zur Schlaflosigkeit des Großpächters Peters. Eines Nachts ging Ernst senior in den Stall und nestelte eine der langen Kuhketten ab, welche die Rinder auf der Viehweide trugen. Die schleppte er treppauf, treppab über die Metallschienen der Stufen.
Unsanft aus den Träumen gerissen, fuhren die im Hause wohnenden Mieter und seine eigene Frau hoch. Auch Sohn Ernst schüttelte den Kopf und wollte wissen, was das bedeuten solle.
„Wenn ick nich schlopen kann, bruken annern Lüd dat uk nich!“ ("Wenn ich nicht schlafen kann, brauchen andere Lute das auch nicht.")
Juni 39 und was danach kam
Ernst senior zog mit seiner Leibmannschaft in Richtung Volkshaus. Er krähte Kommandos und sie gehorchten. Peters verstummte allerdings, als aus der Großen Wollweberstraße plötzlich ein Leichenwagen einbog. Seine Männer nahmen ehrfürchtig die Mützen ab und blieben stehen. Ernst starrte einen Augenblick lang auf die schwarzen Decken und die rabenschwarzen Federbüsche am Zaumzeug der Rappen. Im Trauergefolge sah er Franz Meltz. Ihm schien, als hätte er das runzlige Gesicht gesucht. Der kleine Mann mit dem großen schwarzen Zylinder schaute ihn durchdringend an. Es war, als wollte der Mann Ernst erneut warnen. Ernst spürte,dass sich eine kalte Hand auf sein Herz legte. Nur selten war er abergläubisch. Doch diesmal hatte das unerwartete Auftauchen des dunklen Gefolges etwas Drohendes. Unwillkürlich nickte Ernst Peter dem von ihm verdrängten Fischereipächter einen Gruß zu.
Ohne die Geste zu erwidern, schritt Meltz davon.
„Ach was!“, sagte Peters laut und schob seine düsteren Gedanken beiseite.
Kaum war der Zug aus seinem Blickfeld gewichen, fing er wieder an, sich wie gewohnt aufzuführen. Das war doch ganz normal. Man musste sich eben hochkämpfen, wenn es erforderlich war auch auf Kosten anderer. Und wenn man schließlich oben war, dann hatte man das Recht, es auch zu genießen.
Das ganze Volkshaus gehörte ihm und seinem Geld. Zu seiner Clique zählte neuerdings auch der kleine, stuckige Wilhelm Bartel, sein bester Aalfänger, der später in seine Rolle hineinsteigen sollte, auch Hermann Müller, ein absolutes Leichtgewicht von knapp 50 Kilogramm Haut und Knochen, der ständig von Asthmaanfällen geplagt wurde, sowie Jan Schlämann, der Philosoph und Fritz Biederstaedt waren an jenem Frühlingsabend dabei. Wobei sie zunächst noch unlustig nur an den Gläsern nippten. Schließlich jedoch tranken und sangen sie und betranken sich erheblich. Aus Versehen stieß der sonst kultivierte Jan Schlämann gegen einen Blumentopf, der polternd hinunterfiel. Er entschuldigte sich sofort und war, wenn auch vergeblich, bemüht, den Schaden zu reparieren. Aufgeschreckt vom Krach erschien der Gastwirt Max Reimer. Die unvermeidliche Zigarre zwischen den gelben Zähnen rollend schüttelte der drahtige, nicht sehr große Mann den kahlen Kopf und fragte verärgert, ob das habe sein müssen. Wie von der Tarantel gestochen sprang Ernst senior in die Höhe. Er sei der Fischermeister Peters und könne Blumentöpfe herunterstoßen lassen, so viele und so lange es sein Herz begehre. Er hatte die Stirn gefaltet und die Rechte geballt. Die drückte er energisch auf den Gästetisch.
(Wenn er sich selbst als Momentaufnahme hätte sehen können, wäre ihm der Mund vor Ehrfurcht aufgegangen.) Jedes Wörtlein mit Nachdruck aussprechend, gab er eine Grundsatzerklärung ab: „Wenn miene Lüd sich up den See rümmerdriven wenn du noch mit dienen Mors int worme Bett liggen dest, denn dörben se uk eis nen lütten Bloomenpott doolschmieten." (" Wenn meine Leute sich auf dem See herumtreiben, zu einer Zeit wenn du noch mit deinem Hintern im Bett liegst, dann dürfen sie auch einen kleinen Blumentopf umschmeissen,")
„Das können sie tun! So viele und so oft wie sie wollen, bei sich zu Hause!“, entgegnete der Gastwirt scharf akzentuiert auf Hochdeutsch. Die Erwiderung kam prompt: „Dunnersdach un Friedach, weker betolt hier den Kromt, du orer ick?“ ("Donnerstag und Freitag, wer bezahlt hier den Kram, du oder ich?") Mehr wollte der zigarrenpaffende Wirt nicht hören. Dann mögen sie tun und lassen, was sie für richtig hielten. Er wandte sich von der Szenerie ab.
Ernst senior, weil ihm der Gastwirt den Rücken zukehrte, meinte wahrscheinlich, er würde nicht für voll genommen. Aber er irrte sich. Solange jemand die Münzen tanzen lässt, wird er auch ernst genommen. Peters regte sich auf, verlangte von seinen Männern, sie sollten dem unverschämten Kerl auch noch die anderen Blumentöpfe hinterher schmeißen.
Fritz Biederstaedt erhob sich aus anderem Grund und riss dabei, infolge Verlustes seines Gleichgewichtsgefühls den linken Stellagenteil mit den rotleuchtenden, Pelargonien zu Boden. Das machte ein Heidenspektakel. Die Besucher des Hauses liefen zusammen. Ernst Peters freute sich. „Dat hesst du good mokt!“ ("Das hast du gut gemacht."), lobte er seinen getreuen Fritz, der sich für sein Missgeschick schämte. Aber auf solchen Radau kam es Peters ja gerade an. Wie ein Mime im Theater wünschte er im vollen Rampenlicht und im Mittelpunkt der Ereignisse zu stehen. Bewundernd sollten sie zu ihm aufschauen. Seht Leute, so sieht ein Mann aus, der sich mit eigener Kraft aus dem Elend hochgezogen hat. Ich trage den größten Orden im Knopfloch. Auch wenn ihr blind seid. „So wat dat mokt!“ ("So wird das gemacht"), anerkannte er und ordnete an: „Fritz, riet den Rest uk noch dool!“ ("Fritz, reiss des Rest auch noch runter!") Der Rest bestand aus einer Topfgalerie, längst der Balustrade. Peters war seit seinen Tagen als Spieß und Rekrutenausbilder gewohnt, dass man ihm aufs Wort gehorchte. Darauf bestand er und bemerkte doch nicht mehr, dass sie ihn betrogen und nur so taten, als würden sie ihm zu Willen sein. Häufig hintergingen sie seine dämlichen Weisungen, die er oft schon eine Minute später nicht mehr zu wiederholen gewusst hätte.
Er glaubte, wenn er auf dem See geschrieen hätte: „Springt alle Mann över Buurd!“("... über Bord"), dann würden sie das auch tun.
„Die schönen Blumen!“, jammerte der zartfühlende, ebenfalls hochdeutsche Netzmacher Müller ehrlich bedauernd, als Ernst die braunen Töpfe von den Brettern fegte. „Ach wat! De Blomen vertroogen dat!“ ("Ach was, di Blumen vertragen das."), erwiderte der Pächter. Damit war für ihn das Thema Blumen erschöpfend behandelt. „So, nun wat no Usadel führt!“ ("So, nun fahren wir nach Usadel.")
Gewohnt, ihm wenigstens nicht laut zu widersprechen, nickten Bartel, Müller und Biederstaedt ihre Zustimmung mit verdecktem Spott. Insgeheim übereinstimmend erklärten sie ihn für übergeschnappt. Diesen Ausflug ins 15 Kilometer entfernte Restaurant würden sie verhüten. Peters würde die Idee vielleicht ohnehin schnell wieder vergessen. Sorgenvoll dachten sie an ihre Ehefrauen. Denn es war spät geworden. Doch Ernst Peters verlangte dröhnend: „Fritz, führ den BMW vör!“ Biederstaedt erschrak bei der Vorstellung, er solle die Männer kutschieren.
In diesem Zustand sollte er Auto fahren? „Man tau!“("Nur zu!"), raunzte der Alte. Fritz stolperte die Treppe herunter. Sein Schädel wog schwer und Nacht umfing ihn. Die Sterne am Himmelszelt umkreisten ihn eine Weile wie ein Feuerrad. Das überwand er mannhaft und machte sich auf den Weg zum Petersschen Gehöft. Ihm war elend zumute. Er fürchtete sich vor der Ehefrau des Pächters. Ihr in die Arme zu laufen wäre schrecklich. „Man tau, man tau!“, höhnte er. Dabei richtete er sich immer wieder auf. Da drüben, da drüben. Da drüben lag das Petershaus, in dem sie ihn schon erwartete. Anna Peters würde es ihm verbieten und ihm die Autoschlüssel entwenden. Wie sollte er sich dagegen wehren? Mit ziemlichem Unbehagen dachte er an die letzte Szene zurück. Die Arme in die Hüften gestemmt, hatte sie ihn abgekanzelt. „ De leve Gott hett uns den Verstand gäben, dat wi em gebruken, Fritz!“ ("Der liebe Gott hat uns den Verstand gegebn, damit wir ihn gebrauchen, Fritz!") Er hätte den Meister zurückzuhalten.
Fritz Biederstaedt kämpfte mit Büschen, Sträuchern und riesigen Baumstämmen, die da, wo er entlangtaumelte, nicht hingehörten. „Ne, Fru Meistern!“, rief er ein ums andere Mal. „Se ehren Mann kann man nich uphollen, de löppt as ‘n Pierd.“("Nein Frau Meisterin, ihren Mann kann man nicht aufhalten, der galoppiert wie ein Pferd.") Fritz klammerte sich krampfhaft, während er das Selbstgespräch führte, an einen im Walldickicht stehenden Baum. Seinen Meister mit einem Pferd zu vergleichen, machte ihn heiter. Unwillkürlich kam eine gewisse Erinnerung herauf. Fritz fiel ein, wie Ernst Peters senior seinen Schimmel am Halfter durchs ganze Haus in Annas gute Stube geführt hatte. Trab, trab! Sie war aufgeschreckt von den lauten und ungewöhnlichen Geräuschen hereingekommen, hatte um die Ecke geschaut und laut und entsetzt aufgeschrieen. Herr im Himmel!
Fritz schüttelte sich vor Lachen. Mit ihm war die halbe Fischermannschaft zusammen gerannt. Und so hatten sie denn staunend und schadenfroh dagestanden an der Brüstung vor den weit geöffneten Verandafenstern und sich allesamt riesig gefreut, einen ausgewachsenen Gaul neben dem Klavier in der noblen Petersschen Wohnung zu sehen.
Pferdenarr Ernst hatte sich wieder einmal von einem Rosstäuscher den Weissen andrehen lassen. Gehorsam war der Vierbeiner die Stufen zur Veranda heraufgeklettert und seinem neuen Herrn getreu durch den Wintergarten bis ins Zimmer gefolgt. „Ick froch di Anna, is dat en Zossen?“ ("Ich frage dich Anna, ist das ein Zosse?" Zosse hatte sie seinen Schimmel geschimpft. Vor Schreck muss es ihr für ein paar Sekunden lang die Sprache verschlagen haben. Erstarrt wie Lots Frau war die energische Hausherrin mit hoch erhobenen Händen stehen geblieben. Mitten auf ihrem guten Teppich stand das riesige Tier und glotzte sie gleichgültig an, während ihr dickfelliger Ehemann ihrer Antwort harrte. „Nich, dat du mi den Prachtgaul wedder mies moken deest.“("Nicht, dass du mir diesen Prachtgaul wieder mies redest.") Er wünsche nur zu wissen, inwiefern sie Veranlassung sehe, ihm das schöne Ross nicht zu gönnen. Oder ob sie kurzsichtig sei. Ob sie diese Fesseln gesehen und diese Kruppe schon betatscht habe. Dabei drosch Ernst senior dem gewöhnlichen Zossen eins auf die hell schimmernden Hinterbacken, wobei der große Wallach zum Glück stille hielt, statt unwillig mit dem langen Schwanz zwischen den Notenblättern herumzufegen.
Fritz riss sich zusammen. Er kam wieder voran. Wasser rauschte, wie er es nie rauschen gehört. Er konnte und konnte es sich nicht erklären. Dann erhob er sich vom Boden und sah die bekannte Silhouette. Scheppernd lachte er auf. An der Vierrademühle war er angekommen. Fast richtig. Welch ein Trost.
Da es dauerte, sprachen die Männer im Volkshaus den klaren Getränken weiterhin kräftig zu. Kurz bevor der Gastwirt die Polizeistunde hätte anmahnen müssen, betraten neue Gäste den unteren Raum. Ein Herr Uniformierter und eine schöne Dame waren das, wie Herr Peters sehr wohl aus den Augenwinkeln bemerkte. War es sein allgemeiner Zustand oder reizte ihn das neue Publikum? Jedenfalls legte er sich plötzlich mit seinem Wadenmeister an, dass der ihn damals bestohlen hätte! Schlämann, der leicht zu beleidigen war, verwahrte sich vor dem unmotivierten Angriff. Das gehöre hier nicht her. Doch ein Wort gab das andere.
Schlämann wehrte sich noch gesittet. Es sei längst vergessen und Ernst senior möge bitte nicht in alten Wunden herumrühren.
Unbeherrscht fuhr der Pächter ihn an: „Wat wohr is, blivt wohr!“("Was wahr ist„das bleibt wahr!") "Ernst Peters juckt wull (wohl) dat Fell!“, erwiderte Jan Schlämann schroffer, als er wahrscheinlich beabsichtigte, und sagte auch: „Wenn der Herr wieder einmal Streit wünscht, bitte sehr.“ Hermann Müller rutschte unruhig auf dem Stuhl umher. Die Vorzeichen standen auf Sturm. Deshalb warf er ein: „Wir sind hier, um lustig zu sein.“ Sofort stimmte er mit seiner schwachen, asthmatischen Kehle ein Lied an. „Lustig ist das Zigeunerleben!“ Schiefer konnten die Töne kaum liegen. Müllers Gesang ertrank umgehend im Wortschwall des Wadenmeisters. „Du!“ presste Jan Schlämann schließlich heraus, obwohl er Peters sonst siezte, „Du drückst unsern Lohn, damit du hier den großen Krösus markieren kannst!“ Und Samstags nachmittags bewiese er ihnen seit Jahren immer nur dasselbe, nämlich, dass er nichts weiter als ein elender Kleinkrämer und Ausbeuter sei.
„Wat bün ick?“, empörte Ernst sen. sich.
„Ein Utbeuter! Jawoll!“ Unverantwortlich schmisse er zum Fenster raus, was sie ihm, mit diesen Händen, mühsam zusammengekratzt haben. Er selbst mache doch selten einen Finger krumm, außer um die schönen Talerchen einzufordern und um sie wieder zum Fenster hinauszuwerfen.
Peters sprang jäh in die Höhe. Er beugte sich. Man sah ihm an, dass es ihm in den Fäusten zuckte. Hass flackerte über sein Gesicht. Die Augen rollten. Vielleicht sah er vor sich, wie Schlämann vor Jahren seine Fische in den Oberbach zurückgeschüttet hatte. Der Skandale gab es viele. Netzmacher Müller fürchtete sich. Diesmal wollte es bitterer Ernst werden. Falls Schlämann auch nur sekundenlang die Nerven verlor, wenn er sich erheben sollte, dann war es passiert. „Jan! Nicht aufstehen, nicht aufstehen, Jan!“, bettelte Müller flüsternd dem neben ihm sitzenden, sehnigen Wadenmeister ins Ohr. „Um Gottes Willen!“ Der Wadenmeister jedoch überhörte Müllers viel zu schwache Bitte, weil Peters ihn reizte. „Worm!“, hatte Peters ihn genannt. Er, Jan Schlämann, ein Wurm von Fischerknecht? Das wagte der Nichtswisser, dieser Saufaus? Der Venus nicht von Mars unterscheiden konnte, geschweige denn Sirius von Alpha Centauris. Jetzt riss es ihn endgültig hoch. Er brüllte.
Aufgeregt erschien der zigarrerauchende Gastwirt und schielte herüber. Jeden Augenblick würden die Stühle fliegen. Soviel verstand er von der Psyche trunkener Männer, an denen alter Ärger fraß. Sich einzumischen wäre sinnlos, sie zur Vernunft zu bringen unmöglich, sie hinauszuwerfen, wäre ein Fehler. Das würde bedeuten, wichtige Kundschaft zu verlieren. Nichts zu sagen, ging auch nicht an. Es verprellte die anderen Gäste. Es war immer wieder dasselbe. Wahnsinnig könnte er werden in diesem Beruf.
Da richtete sich der enorm dürre und kleine Müller zwischen den Hünen auf. Er breitete seine schwachen Arme aus und legte den kernigen Recken je eine gespreizte Hand auf die Brust und hauchte: „Das hat er doch nicht so gemeint! Bitte setzt euch nieder.“ Er sagte nicht einmal, auf wen er sich bezog. Wie weiche Mutterhand glitt sein dürftiges Wort über die rauen Kerle. Verdutzt und aufmerksam schauten sie herunter auf den Kleinen, der in ihren Augen immer eine große Autorität gewesen war, weil er die Kunst des Netzschneidens wie kein zweiter beherrschte. Auch Wilhelm Bartel starrte auf den dünnen Mund und den bemerkenswert mageren Kopf des um Atem ringenden Mannes.
Wie ein Beschwörer wirkte der Netzmacher. Mit einer handvoll Silben brachte er die Hitzköpfe unerwartet zur Besinnung.
Gehorsam nahmen sie Platz. Die Gäste schauten hoch, weil die Ruhe fast noch mehr als der Lärm auffiel.
In diesem Augenblick, da die beiden hochverärgerten Fischersleute nach innen lauschten, meldete sich mit durchdringend quäkender Stimme der stadtbekannte SA-Müller zu Wort. Offensichtlich nicht völlig Herr seiner Sinne, äußerte er sich anmaßend. Laut und vernehmlich rollte es durch den Raum: „Pack schlägt sich! Pack verträgt sich!“
Seine Erklärung war sicherlich nur an die in ihrem reizenden, feuerroten Kleid dasitzende Dame gerichtet.
Doch törichterweise setzte der Mann seinen Kommentar über das Thema Ehrenmänner fort. Seine schöne Begleiterin bemühte sich, ihn zu bremsen. Zu spät. Ernst Peters große Ohren waren bereits überreizt. „Herr!“, brauste er hitzig auf und lehnte sich über das Geländer und schaute von der Empore wie ein Volksredner herunter. „Wer hier ein Ehrenmann ist und wer nicht, das weiß ein Heini aus Braunau nicht!“
Wie eine scharfe Lanzenspitze stand das Ausrufezeichen. Ungewollt kam so, der, wie jedes Schulkind wusste, in Braunau am Inn geborene Herr Reichskanzler Adolf Hitler ins Spiel.
SA Müller, mit seinem dicken Parteiabzeichen auf dem braunen Schlips unter dem exakten schwarzen Kragen, zuckte zusammen. Brüsk schoss er hoch, wiederholte entgeistert: „Heini aus Braunau? ... blab, blab... ist jetzt und hier persönlich... angegriffen worden...“ Er war sichtlich, wenn auch vergeblich, bemüht militärisch straff dazustehen.
Seiner Würde als Uniformierter unter den Zivilisten war er allemal gewiss. Giftig zischte er: „Alle Gäste haben das gehört, mein Herr! Ich nehme sie als Zeugen.“ Der Herr Fischereipächter Peters habe den Führer beleidigt.
An den verschiedenen Tischen entstand Bewegung. Man ging, oder traf Anstalten zum Aufbruch. Reimann rief: „Polizeistunde, meine verehrten Damen und Herren!“
SA-Müller räusperte sich oberlehrerhaft: „Herr Wirt, ich verlange Klarheit wegen Führerbeleidigung!“
„Na, na!“, beschwichtigte Schlämann den Wichtigtuer, „Du wast doch woll nich schlicht schlopen hem?“("Na, na, beschwichtigte Schlähmann, du wirst doch wohl nicht schlecht geschlafen haben.") Im Hintergrund lachte jemand mit heller Stimme. Türen klappten. Reimann wiegelte erneut ab. „Polizeistunde!“ Er machte die Geste höflicher Aufforderung, das Feld endlich zu räumen, und zwar friedlich. „Was soll das heißen, mein Herr?“, regte sich der SA-Mann auf. „Dat du nen groten Doesbüddel büst!“ ("Das du ein großer Dummkopf bist."), vollendete Ernst senior kurz und bündig. Da er überhaupt keinen Anlass sah, irgendein unter gegebenen Umständen daher gestolpertes Wort für voll zu nehmen, drehte er dem Menschen da unten den Rücken zu. Seine Söhne waren Elite-SSler! Was wollte der Luftikus von ihm? Jeglicher Ahnung bar, welche Missachtung er damit gegenüber der deutschen SA zum Ausdruck brachte, wandte Peters sich wieder den Getränken zu. Für die Wolke der Beklemmung, die auf dem Hause lastete, hatte er kein Gespür. Jeder Deutsche wusste allerdings, eine Führerbeleidigung hatte immer Folgen. Die Gestapo musste in jedem Fall unterrichtet werden.
Sogar Schlämann fühlte sich allmählich unbehaglich in seiner Haut. Er machte Zeichen, sie sollten den ungemütlichen Ort baldigst verlassen. „Soll die Polizei doch kommen.“, widersetzte sich Peters. Es war ihm anscheinend nicht klar, was er damit sagte. Auch SA-Müller rief nach der Polizei.
„Lot em doch!“("Lass ihn doch!") , trotzte der sonst so bedächtige Schlämann
„Lot em doch!“, krähte Peters. Allerdings irgendwo in der Tiefe ihrer Hinterstübchen dämmerte beiden Männern etwas. Was sie im Rausch sagten, würden sie nüchtern zu verantworten haben. Trotzig gegen dieses innere Lichtlein setzten sie sich nochmals hin, reichten einander die Hand demonstrativ und bekundeten, was sie anginge, ginge keinen anderen Heini irgendetwas an. Gar nichts.
Das wolle er doch mal sehen, pustete sich Jan Schlämann verwegen gegen die eigene, schwache Mahnung auf, ob gewisse Herren Dunsel um Mitternacht bei Windstärke zehn im kleinen schaukligen Kahn auf dem bewegten Tollensesee gelassen neben ihm sitzen könnten. Ob sie mit ihm in die Gesänge, die er bei größten Gefahren in die Welt hinausbrüllte, einstimmen könnten. Oder ob ihnen die Angst um ihr bisschen Leben die Gurgel zuschnürte, wenn Urgewalten das tanzende Boot hoch auf den nächsten Wellenberg hinaufschmissen und dann wieder in sausender Fahrt hinabrissen ins tiefe Loch. Wahrscheinlich hatte dieser gestiefelte SA-Kater, obwohl er seit Jahrzehnten Neubrandenburger war, nicht einmal die Spur einer Ahnung, wie der höllisch tiefe, von Sturm und Orkan gepeitschte See sich darstellen kann, wenn einer sausenden Welle die nächste folgte, nachts, wenn die Macht der ungeheuren, weißschäumenden Brecher sich plötzlich steigerte und zum Kampf auf Tod und Leben herausforderte, eben weil dieser See dreißig Meter tief war und fast ozeanisch erregt sein konnte.
Hermann Müller und Wilhelm Bartel schauten einander an, sie zogen sich nach diesen peinlichen Prahlereien zurück. Das war eben ihr Beruf als Wellenreiter. Die beiden Meister hatten jedes Maß und jede Norm gebrochen. Augenwinkend mahnte Hermann Müller Jan Schlämann mitzukommen. Obwohl er nie einen Waffenrock getragen, wusste er, dass ein Uniformierter immer als der höherwertige Mensch galt.
Militärs mussten siegen oder sterben. Das war ihnen von Kriegstreibern eingebläut worden.
Fritz Biederstaedt indessen war nach einigen Umwegen doch noch in der Petersschen Garage angekommen. Er öffnete das Tor, fand auch den Autoschlüssel und stieg erleichtert ein. Auf ihn war Verlass. Als er sich auf den Fahrersitz hockte, verloren sich seine Gedanken.
Nach einer ungewissen Zeit schreckte er hoch. Er sah zunächst nichts, außer einem kreisrunden schwarzen Loch. Er war aufgeprallt. Den Autohimmel konnte er fühlen ebenso die heruntergekurbelte Fensterscheibe. Fritz schnupperte den Benzingeruch und erbebte. Im Dunkeln war er losgefahren und verunfallt. Lag im Straßengraben. In seiner Erinnerung sprangen ein paar Ortsnamen hin und her. Usadel, Klein Nemerow, Heidehof, Neubrandenburger Volkshaus. Er überlegte krampfhaft, kam jedoch zu keinem überzeugenden Ergebnis, außer der Befürchtung, dass er verbluten würde. Er vernahm Gebrüll von Kühen von einer fernen Viehkoppel her. Das Gewissen schlug ihn. Bei dem Versuch, den steinschweren Kopf anzuheben, um sich umzuschauen und zu tasten, wo sein Meister sich befand, fiel er wieder in Ohnmacht.
Nach langer Dunkelheit, sah er einen hellen Spalt, dann das Licht. „Biederstaedt! Fritz Biederstaedt!“, rief er nach einem Gedankenblitz, vor Freude erschrocken. „Alter Esel! In der Garage hast du geschlafen!“ Wie ein Kind lachte er auf. Es endete jedoch mit einem Krächzen, als er versuchte sich zu bewegen. Die Knochen! Mit Gewalt rückte Biederstaedt die Gelenke ein, um die Karosse zu verlassen.
Inge!
Er wird was erleben. Das war klar. Wieder einmal hatte sie vergeblich eine ganze Nacht hindurch auf ihn gewartet. Fritz weigerte sich vorläufig, die Konsequenzen auszudenken.
Frisch machen musst du dich, dachte er, und, irgendwo wird er ein paar Blumen aus einem Vorgarten klauen. An den Fingern seiner Hand konnte er nachrechnen, dass es Sonntag sein musste. Gute Inge. Schönste und Beste. Keine Sorge! Doch es war mehr Beschwichtigung seiner eigenen Sorgen.
Beim Hinuntergehen zum nahen Oberbach zog er Jacke und Hemd aus. Beides hängte er in das weiße Gerüst mit den blaublühenden Clematis. Einen Augenblick lang wollte die Vorfreude auf bislang Versäumtes Gutes in ihm aufkommen. Aber als Fritz sich über den Bollwerkbalken dem Wasser zuwandte, fuhr er jäh zurück. Der Gedanke und Wunsch, seine treue, liebe Frau müsse ihm noch einmal, ein allerletztes Mal, verzeihen, blieb ihm auf halbem Weg im dumpfen Summen und Sausen seines Kopfes stecken. Denn in dem sachte dahin fließenden blaugrün schimmernden Bach erblickte er eine widerliche Fratze. Die war verschrammt, geschwollen und schwarz. Ein blöder Kerl starrte ihn an, ein kantiges Landsknechtsgesicht mit einer riesigen Sattelnase. Solche derb heraus stoßenden Jochbeine hatte er noch nie gesehen. Die vollen Haare standen ihm zu Berge. Entsetzt griff er mit der Rechten ins Wasser und verwischte das Bild, das ihn erschütterte. Er stürzte das Nass über sich und rief pustend und prustend ein paar Male hintereinander. „Tun Dübel, Fritz Biederstaedt, wo kümmst du her?“ ("Zum Teufel, wo kommst du her?") Die ganze Wahrheit war dermaßen schrecklich, dass er vor ihr weglief.
Ernst Peters nahm zwei Tage später auf dem Hof dem Briefträger die Post ab. Einen der Briefe betrachtete er auffallend lange. Nachdem er ihn geöffnet hatte, verfinsterte sich sein graues Gesicht. Jäh äußerte der Pächter abfällig vor sich hinfluchend, ihn bestelle niemand irgendwo hin. Niemand! Biederstaedt schaute dem Davongehenden nach. Ernst senior schlug die Haustür hart ins Schloss.
Weiter fiel auf, dass der Wortgewaltige an den beiden folgenden Tagen sonderbar still und gedankenversunken über den Hof ging. Donnerstag früh kam Ernst Peters senior im neuen Oberhemd an. Er trug auch seine gute Hose und ging zu Fuß davon. Es musste also Schlimmes passiert sein. Der Ortsgruppenführer der NSDAP Herr N. hatte den Fischereipächter „in einer wichtigen persönlichen Angelegenheit“ zu sich beordert.
Bereits seit Tagen grübelnd, wie viel er verbrochen haben mochte, nagten an Vater Peters die geheimen Bedenken, er könnte seinen beiden Söhnen, vor allem seinem Heinz, Schaden zugefügt haben.
Das Flackern in seinem Innern wollte sich diesmal nicht unterdrücken lassen. Mancherlei Unbesonnenheiten standen in gewissem Zusammenhang. Ernst sah plötzlich ein, dass er sich in letzter Zeit im Rausch öfter unvorsichtig geäußert hatte. Vor allem das Bild von SA-Müller beschäftigte seinen Geist.
Er konnte es nicht leugnen, ihm war eine Beleidigung des Reichskanzlers Hitler unterlaufen. Auch wenn der geschniegelte und gescheitelte Kerl im Volkshaus ihn herausgefordert hatte und somit an dem Blödsinn schuld war. Alle möglichen Behauptungen könnten aufgestellt werden, an denen eventuell ein Körnchen Wahrheit hing. Am schlimmsten für Ernst Peters senior war die Befürchtung, dass er sich vielleicht nicht richtig verteidigen könnte. Es soll eine Menge Verhaftungen gegeben haben, weil einer bloß mal laut gedacht hatte.
Seine ganze Forschheit war wie weggeblasen. Ihm war zumute, als wäre ihm ein Stückchen seines Ichs abhanden gekommen. Selbst wenn er gewollt hätte, er sah sich außerstande, kräftig an die Bürotür des Ortsgewaltigen zu klopfen. Unmittelbar bevor er die Knöchel seiner Finger hob, sah Ernst Peters senior mit den Augen seines Sohnes Heinz, die Massenaufmärsche des Nürnberger Parteitages. Hunderttausende blitzende Stiefeln im Paradeschritt. Die Treuesten der Treuen defilierten an dem größten aller Führer vorbei, den zu verleumden er sich herausgenommen hatte.
Solche Allmacht provozierte niemand ungestraft! Der Würgegriff am Halse saß fest. Peters musste ein zweites Mal die Rechte heben, um anzuklopfen. Da saß, die Beine von sich gestreckt, von Kopf bis Fuß ein Flegel, der ehemalige Stellmachergeselle Willi B. hinter einem niedrigen Schreibtisch. „Ernst, kumm rin!“ ("Ernst, komm herein!"), sagte der nicht mehr ganz junge Mann, schnarrend. Der Mensch erhob sich nicht, rückte sich nicht zurecht, reichte ihm nicht die Hand, sondern schob die Stirn in Falten. Er machte nur eine knapp einladende Geste, wies auf einen Stuhl. Ernst bebte. Gegeneinander laufende Gefühle rissen ihn hin und her. Zudem musterte ihn der Stellmachergeselle, als sei er, der Fischermeister Peters, ein Stück Rindvieh auf dem Markt. Er saß kaum, da kroch ihm dieser rohe Holzwurm auch schon ohne Umweg auf den Leib: „Wat hest du di dorbie dacht, Ernst Peters?“("Was Ernst Peters, hast du dir dabei gedacht?")
Intelligent war der Kerl nie gewesen, aber sich nun sehr seiner Macht bewusst. Die schwarze SS-Uniform hatte aus dem mickrigen Hungerkünstler einen stattlichen Mann gemacht. „Zu dir bin ich nicht bestellt worden“, dachte Ernst Peters sich wehrend, brachte es auch, unsicher, zum Ausdruck. Sie wussten voneinander, kannten sich aber eigentlich nicht. Persönliche Beziehungen hatte es zwischen ihnen nie geben können. Da lagen doch Welten zwischen ihnen. Die kalten Augen des anderen glitzerten. Wahrscheinlich ahnte der, was er dachte. Für einen dünkelhaften Plötzenfischer hielt er ihn, der sich immer noch als der Größere vorkam.
„Volksgenosse Peters“, sagte der SSler auf Hochdeutsch in offensichtlich gewollt furchteinflößendem Ton: „bei mir bist du ganz richtig! Ich vertrete den Ortsgruppenführer.“
„Mien Heinz is bi de Leibstandarte Adolf Hitler...“ ("Mein Heinz ist bei der Leibstandarte Adolf Hitler...") , begann Ernst vorbeugend seine Verteidigung. Es war der untaugliche Versuch,
jemanden zu beeindrucken, der sich nicht beeindrucken lassen wollte. Ernst biss sich, kaum dass er so hilflos angefangen, auf die Zunge. Was wollte er damit sagen? Dummes Zeug. Er hörte im Geiste schon, wie sein Gegenüber spotten würde: „Üm so schlimmer, Ernst, üm so veel schlimmer!“("Umso schlimmer, Ernst um soviel schlimmer!) Außerdem war es eine Frechheit, dass der Kerl ihn duzte. Dem schaute der kleine Blödmann, der er war, doch klar aus den Augen. Aber auch sein Zorn machte Ernst Peters nicht wirklich mutig. Er fragte schließlich bescheiden: „Wat is der Grund, wat wollt ihr von mir?“
Keine Antwort.
Ernst Peters kniff die Lider zusammen. Denn von dem goldgerahmten Bild starrten die scharfen Hitleraugen feindselig auf ihn herunter. In diesen Räumen hatte noch kein Besucher gewagt einen Bogen zu überspannen. Dem Stellmachergesellen war die Blickrichtung des ihm ausgelieferten Mannes nicht entgangen. Ruhig sagte er: „Ernst, du hesst di in de Brennessln set‘t!“("Ernst, du hast dich in die Brennnesseln gesetzt,")
Sich in der Öffentlichkeit mit SA-Müller anzulegen, sei mehr als eine Unbedachtheit gewesen.
Ob er nicht wüsste, dass SA-Müller in Berlin große Verwandtschaft hat. Jedenfalls sei ein Anruf aus dem Reichssicherheitshauptamt gekommen. Die Ortsgruppenführung NSDAP solle prüfen, ob ein Fall von Führerbeleidigung vorliege. Ernst dachte einen Augenblick lang, so spricht man nicht mit jemandem, der stürzen soll. Er musste sich allerdings erinnern, dass er sich beim Verlassen der Gaststätte noch einmal an den SA-Mann gewandt hatte. Wer weiß, was er alles im Nebel getan und gesagt hatte, das er nun in Klarheit wird zu verantworten haben. Er schluckte. Was könnte er denn noch gesagt haben? „Gesagt? Gesagt, Ernst, hast du, Hitler sei ein Heini! Aber du bist dem SA-Mann an die Wäsche gegangen, oder etwa nicht?“ Soviel wusste Peters noch, absichtlich war er dem Kerl nicht zu nahe gekommen. Vielleicht hatte er ihn unbeabsichtigt gerammt. Das war seine Art nicht, fremden Menschen den Schlips gerade zu rücken. Das hätte er sich nicht einmal, als er noch Spieß gewesen war, so ohne weiteres herausgenommen. Ernst Peters sagte das. Es klang glaubwürdig.
„De Kierl mökt sich vör sien Liebchen grot un ick kom dorför in Düwels Köck. Ne!“("Der Kerl machte sich vor seinem Liebchen wichtig und ich komme dafür in des Teufels Küche? Nee.") Weiter sei nichts gewesen. Das kenne man doch. Willi B. kratzte sich am Kinn. Er dachte angestrengt nach. Steckte seinen kleinen Finger ins Ohr und schüttelte ihn unverschämt lange: „Dat helpt allens nix, Ernst; lech di nich an mit de SA-Lüd.“ ("Lege dich nicht mit den SA-Leuten an!") Wenn er könnte, würde er ihm ja gerne aus der Patsche heraushelfen. Aber das sei nicht so leicht.
Er ließ Ernst senior eine Weile schmoren. Dann beugte er sich vor:
Am Dienstagabend fände ein Kameradschaftsabend der SS im ehemaligen Logenhaus statt. Peters begriff nicht, was der schwarze Stellmacher von ihm wollte.
„Dien Bestes, Ernst, dien Bestes!“ ("Dein Bestes, Ernst, dein Bestes.") und da zwinkerten sie plötzlich, die dümmlich wirkenden Augen seines Gegenüber. Er halte, ehrlich gesagt, die ganze Vollfressigkeit der SA-Kameraden für bekloppt. „Ick pörsönlich holl von den Müller gor nix. Wenn dat no mi güng, wür ick den Fatzke wägen dat grote Mul nen Lütten utwischen.“ ("Ich persönlich halte von dem Müller gar nichts. Wenn es nach mir ginge, würde ich den Fatzke wegen seiner großen Fresse eins auswischen und für bekloppt halten.") Fischermeister Peters begriff gar nichts mehr. „Blot (bloß) keine Müssverständnisse, Ernst!“, schmunzelte der andere, jetzt offen und freundlich. „Wat is denn dien Bestes, Ernst?“ Er starrte auf den Mund des Fischermeisters und nickte erwartungsvoll.
„Rookool!“, entfuhr es dem Fischermunde. Räucheraale!
Aus den Augenwinkeln blitzte es Peters an: Na sühst du, Ernst, so einfach is dat. Es mache sich prima. Am Samstag käme aus der Zentralkanzlei ein direkt Unterstellter des Inspekteurs der SS-Reiterei. Der könnte, wenn er wollte und sich überzeugen ließe, die verfahrene Sache wieder ins rechte Lot rücken. Niemals aber dürfte er ein Sterbenswort verlauten lassen, welchen Weg er zur Behandlung der heiklen Angelegenheit zu begehen vorgeschlagen hatte. Obwohl er nun wieder frei atmete, ärgerte Ernst Peters sich auf dem Rückweg maßlos, dass sie ihn so überlisteten, Gratisaale zu spendieren. Die solle er, wenn er sie geräuchert habe, zu Herrn Willi B. bringen, nach Hause, sagte er zu Fritz Biederstaedt: „Betohlt hett hei schon!“ ("Bezahlt hat er schon!")
Fritz Biederstaedt zuckte und juckte es in der Seele. Es war nicht das erste Mal, dass Ernst senior etwas auszubügeln hatte. Wenn er nur dahinter käme, was der Alte diesmal wieder verbockt hatte. „Betohlen möt sind, Meister!“ ("Bezahlen muss sein, Meister!"), spöttelte der Exdiener Biederstaedt und rechnete sich indessen seinen Vorteil aus, dass er statt zwanzig, vierundzwanzig Aale in den Rauch des kleinen Ofens auf der Fischerinsel hängen könnte. Einen zur Probe, einen für die Flasche ‚Klaren’ und zwei für die Familie.
Nach dem Kameradschaftstreffen stand für den Berliner SS-Führer fest, wer solche auserlesenen Köstlichkeiten produzierte, der konnte nur ein guter Deutscher sein, und noch nie hätte seines Wissens ein guter Deutscher den Führer beleidigt.
Reichsweit herrschte Feindschaft zwischen der SA und der SS. Das war für Ernst senior gut. Der Berliner SSler winkte ab. Die Sache sei beigelegt. Da war niemals etwas gewesen, außer der krankhaften Einbildungskraft eines Möchtegerns. Er werde von der sehr erfolgreichen Untersuchung, einen kurzen Bericht schreiben. Herr Peters hätte nur zum Ausdruck bringen wollen, dass nicht jeder Heini den Führer aus Braunau beleidigen darf. Erledigt.
Ernst Peters ärgerte sich nicht lange. Ihm könnten sie nun erst recht den Buckel runterrutschen.
Aber er irrte gewaltig. Wäre er nicht der Vater dieser Prachtjungs gewesen, hätte ihn die ungewollte Beleidigung Hitlers möglicherweise die Freiheit gekostet. Ein scharfes Wort zur Unzeit reichte mitunter zur Einweisung in ein KZ aus. Zum Glück wussten seine beiden großen Söhne auch nicht alles von ihm. Zum Glück konnte niemand Gedanken lesen.
Noch klarer durchschaute sein alter Wadenmeister Schlämann das ganze Gehabe.
Doch nur auf dem großen See, wenn der Wind kräftig blies und die harten Wellen rauschten und niemand weiter zuhörte, dann ließ Schlämann sich manchmal gegenüber Fritz Biederstaedt über seine Ablehnung Hitlers aus. Schlämann lebte in der irrigen Annahme, der ehemalige Diener hasse wie er selbst den Nazizauber und überhaupt das ganze Überzackige. Es ginge den meisten Kerlen nur um die Weiber, lästerte der alternde Wadenmeister. Weshalb um alles in der Welt zwängten sich die dämlichen Bengel sonst in die eng anliegenden Jacken? Selbst die Breeches waren effektiv bloß ein Korsett. Als hätte ihnen das Leben weiter nichts zu bieten. Vielleicht ginge es den scharfen Burschen noch ein wenig um die Illusion von eigener Sicherheit. Was jedoch auf Platz Nummer Eins rangierte,
mache schließlich die ganze Menschheit blind vor ihrer düsteren Zukunft. Wie Wahnsinnige tanzten sie hinter ihrem höchsteigenen Henker her. „Wenn die Weiber“, schimpfte der lange Schlämann prophetisch, „das bunte Blech an der Heldenbrust“ nicht liebten, wären Krieg und Sieg vorüber, bevor alles begänne. Weil sie Gewisses nie genug von den auf ihren schlanken, hübschen Beinen stolzierenden jungen Damen bekommen konnten, setzten die blöden Hammel ihr Leben aufs Spiel.
Bloß die Herren SA-Müller und Co werden schlau genug sein, andere diesen Preis entrichten zu lassen. Selbst den Teufel in der Hölle werden sie am Schwanze packen lassen. Doch schließlich würde sie alle derselbe Leibhaftige holen, mit dem sie sich zu bösem Spiel eingelassen hatten.
Als Hitler seinen Krieg gegen Polen begann, wurde allen Mitgliedern der SS unter dem linken Arm die Blutgruppe eintätowiert. Das betraf auch die beiden älteren Petersöhne. Ernst junior, während er den Arm hochnehmen musste, spürte bei jedem Stich: Du hast einen Fehler gemacht. Der wird dir das Genick brechen. Die Eitelkeit hat dich geritten und das endet schlecht.
In einer Nacht auf dem See, äußerte er zu Fritz Biederstaedt, unter keinen Umständen würde er abwarten, bis er in einer der bewaffneten SS-Einheiten ins Feld einrücken müsste. Wer Gotteshäuser in Brand steckte und friedliche Menschen kaltblütig erschlug, der war zu allem fähig. Um der Gefahr zu entgehen, von solchen gottlosen Haufen assimiliert zu werden, melde er sich freiwillig zur Infanterie. Bloß nicht wie Heinz in einen dieser SS-Verbände gesteckt werden. „Ick verlot mi up di, dat du dat Muhl hölst!“ ("Ich verlasse mich darauf, dass du dein Maul hälst!")
„Ewer Ernst, glöwst du, dat ick nich dichthollen kann?“("Aber Ernst, glaubst du, dass ich nicht dichthalten kann?")
Doch gewogen hatte er seine Worte nicht. In seinem Herzen war die Ehrfurcht vor Adolf Hitler, wie Unkraut gewachsen.
Sie sprachen über Heinz.
Heinz mochte wohl immer noch gewisse Naziideale hegen, sagte Ernst junior vertrauensselig. Doch sicherlich nagten auch an ihm die ersten Zweifel. Jedenfalls wenn er auf Kurzurlaub käme, würde Heinz auffälligerweise nicht mehr darüber reden, sondern Unbekümmertheit vorspielen.
Für Ernst war die Vorstellung mit Hitlers Leibstandarte oder mit den gerade erst von Heinrich Himmler aufgestellten „Totenkopf-Standarten“ in den Krieg zu marschieren, unerträglich.
Die Wehrmacht nahm den Kriegsfreiwilligen Junior Ernst trotz seiner SS-Zugehörigkeit. Sie hätten ihn aber auch verweisen können, und er wäre in der falschen Ecke gelandet.
Die Kreisbauernschaft reklamierte ihn umgehend. Niemand außer ihm könne den großen Fischereibetrieb leiten.
Auch als die deutsche Wehrmacht in Frankreich einfiel, wurde Ernst junior nicht eingezogen. Er solle Fische fangen. So wandte sich sein Schicksal noch einmal zum Guten.
Unterscharführer Heinz Peters dagegen, Vaters Liebling, gehörte den Einheiten der deutschen Heeresgruppe C an, die ursprünglich zum Frontalangriff auf die von den Franzosen für unüberwindlich gehaltene Maginotlinie eingesetzt werden sollte. Die Heeresführung unter General Manstein erbat jedoch zusätzliche Unterstützung zur Ausführung seines berüchtigten „Sichelschnittes“. Hitler beorderte auf die Bitte Mansteins hin, mit „seiner“ Leibstandarte einen der schlagkräftigsten Truppenverbände an den nördlichen Rand der riesigen Festungsanlage.
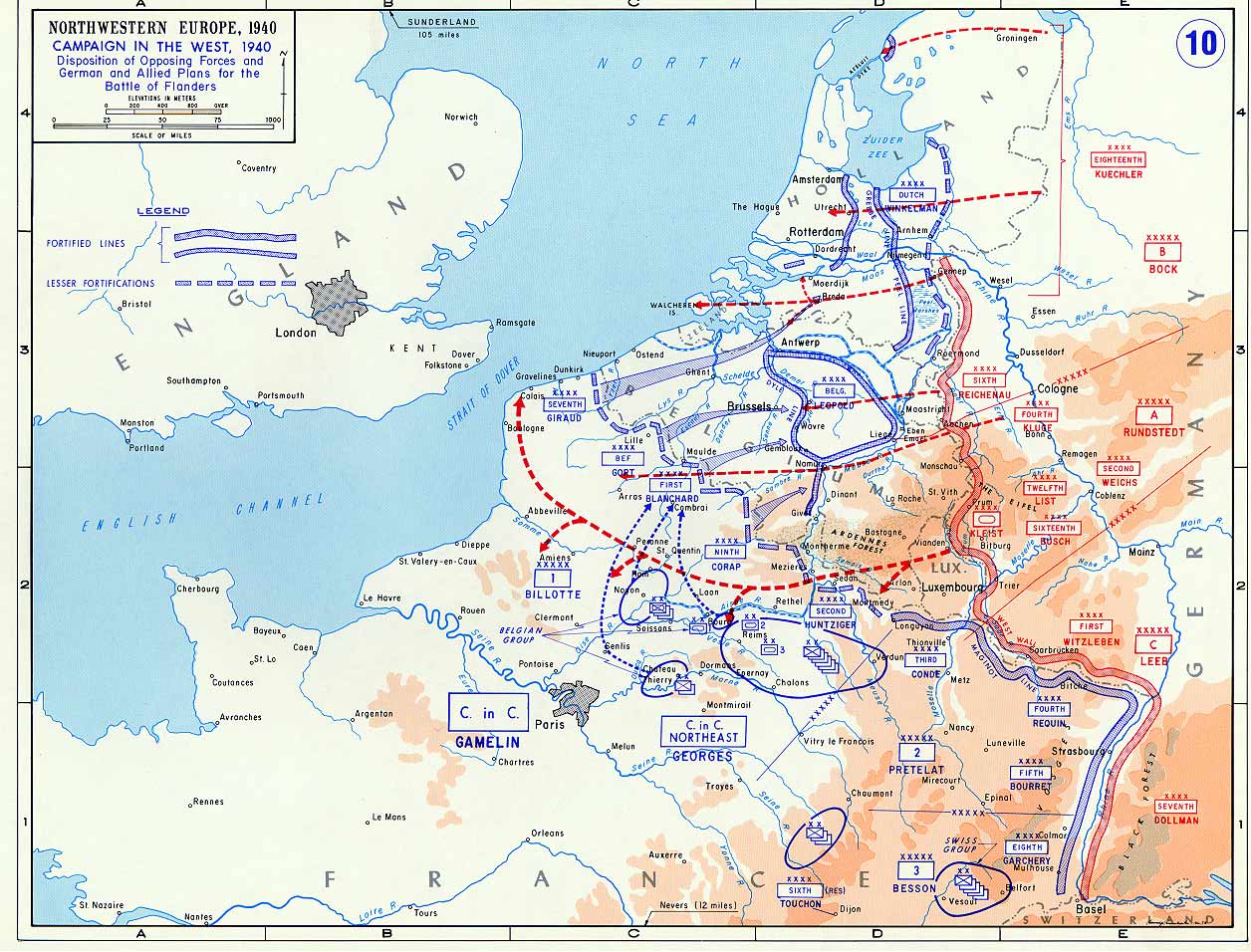 |
| Bild Wikipedia. Manstein umging die im Ostteil Frankreichs liegende Maginotlinie, indem er von Luxemburg aus bis an den Ärmelkanal vorstieß. |
Der ahnungslose Vater hatte gerade eine Sondermeldung gehört und in seiner Begeisterung herausgeschrieen, nun hätten sie es den Franzosen und den Tommys aber gezeigt. „Hitler hat sie zusammengemäht!“ Am liebsten wäre er jungenhaft jubelnd über den Hof gerannt.
Da traf die furchtbare Nachricht ein.
Wochenlang ging der geschlagene Mann gebückt und stumm. Seinen Herzenssohn hatten sie niedergemäht.
Der Älteste und der Jüngste bedeuteten ihm zusammen nicht so viel wie dieser.
Anna Peters ließ sich tagelang nicht blicken.
Die Neubrandenburger Zeitung brachte in der düstersten Woche der Pächterfamilie am 13. Juni 1940 die schwarzumrandete Anzeige: Für Führer, Volk und Vaterland. In tiefster, aber stolzer Trauer. Deine Eltern, deine Brüder.
Tags darauf erhielt der Vater die ebenfalls schwarz gerandete Beileidskarte von Franz Meltz. Ernst setzte sich tief in Gedanken versunken auf einen Netzballen. Er beachtete die Männer nicht, die in dem Raum Seile zusammenspleißten. Biederstaedt fühlte etwas von der Trauer des Alten. Fritz musste sich daran erinnern, wie sie vor gar nicht langer Zeit gemeinsam und übermütig ins Volkshaus gezogen waren. An ihm zog das Bild vorbei, wie der kleine Mann Franz Meltz mit dem hohen schwarzen Zylinder hinter dem Leichenwagen herging. Da war noch Friede gewesen, aber in Franz Meltz schon jene düstere Vorahnung vorhanden, die Verlierer mitunter haben.
Vielleicht hatte der tieftraurige Pächter an dasselbe Bild zurückgedacht. Denn als er sich erhoben hatte, legte Peters seinem treuen Knecht Fritz die schwere Hand auf die Schulter und bekannte leise: „Dat har ick nich seggen dürft.“ Er wandte sich um, ging vor sich hinmurmelnd hinaus: „Dat har ick nich seggen dürft, dat et Krieg gäben möt!“("Das hätte ich nicht sagen dürfen, dass es Krieg geben muss.") Wie früher sein Widersacher Meltz ging er fortan oft hinter den schwarzen Wagen her.
Somit erforderten die Umstände weiterhin die Anwesenheit des jungen Meisters daheim. Während dessen Kameraden im Osten vorwärts gehetzt und verheizt wurden, durfte der junge Ernst, nun auch noch von immer mehr Kriegsgefangenen unterstützt, dem harmlosen Abenteuer Fischfang nachgehen.
All das Böse hatte er nicht gewollt. Nie und nimmer. Verflucht das Morden. Verdammt die Judenverfolgungen und die Waffengänge. Immer hatte er nur gehofft, dass Deutschland über alles in der Welt bleiben könnte. Schön und groß. Ein bisschen reich. Zuerst kamen die schnellen Siege auch auf Kreta und dem Balkan - wo er seinen Gesinnungsidioten Mussolini aus dessen Niederlagen heraushauen wollte, musste - aus dem Überraschungseffekt heraus.
Doch urplötzlich und ohne Not griff Hitler Sowjetrussland an, obwohl er erst wenige Monate zuvor mit den Sowjets einen Nichtangriffspakt eingegangen war. Wieder war er erfolgreich. Seine Truppen stießen bis Moskau vor, weil er so den größten Landraub seit Jahrhunderten plante - auch weil er die Juden vom Erdball tilgen wollte. Hitlers "Wehrmacht" sollte den mörderischen Einheiten der SS nur den Weg ebnen.
 |
| Bild Wikipedia: blau der Herrschaftsbereich Nazideutschlands 1941-42 |
Dann überraschte General Winter die Deutschen an der Russlandfront.
Zum Trost verteilte Adolf der Schreckliche an die Überlebenden den „Gefrierfleischorden.“
Weder die Jahre 1942, noch 1943, brachten das ersehnte Ende des Krieges.
Im Sommer 1944 zog der Krieg unerwartet sogar die kleine romantisch gelegene Fischinsel auf dem Tollensesee in seinen Hexenkessel hinein. Fritz Biederstaedt hatte auf dem Barschberg seine Stellnetze ausgefahren, die zwar keine große Mengen, aber zuverlässig die wertvollen pfündigen Barsche einfingen. Deshalb übernachtete er da oben. Einmal, unmittelbar nach zwölf Uhr, krachte es neben seinem Bett. Fritz floh ins Freie und warf sich ins Gras. Das ist dein Tod! Eine Anzahl Bomben explodierten in seiner Nähe. Was wollten sie hier vernichten? Das armselige Domizil der Prozentfischer? Dazu hatten sie den langen, kostspieligen Ausflug nicht unternommen. Die angloamerikanischen Piloten hatten wahrscheinlich die Torpedoversuchsanstalt am anderen Seeende treffen wollen. Ihr Leitflugzeugführer musste die Karte von dem bis in die Höhe hinaufblinkenden Tollensesee seitenverkehrt auf seinen Knien gehalten haben. Offensichtlich hielt er den Schatten des Inselhauses für die militärische Anlage und gab deshalb Befehl an seine Begleiter, die vermeintliche Abschussbasis zu vernichten. Denn von Spezialisten der Neubrandenburger TVA wurden die Steuereinrichtungen der Torpedos auf Zuverlässigkeit getestet.
An manchen Tagen schossen die Marineoffiziere bis zu acht Stück in Richtung Nonnenhof, in zehn Kilometer Entfernung. Da fingen sie die noch nicht scharfen Waffen wieder auf und stellten sie definitiv ein. Die sollten über die Umwege Kiel und Le Havre, mittels deutscher U-Boote, britische Schiffe treffen.
Das alles half nicht. Der ausgewachsene Krieg kehrte wütend in das Nest zurück, in dem er geboren wurde.
Am fünfzehnten Oktober 1944 überrannten die Einheiten der dritten Belorussischen Front die Reichsgrenze bei Gumbinnen. Eine Woche danach fielen die Ruinen der ausgebomten Kaiserstadt
Aachen den Soldaten der ersten und der neunten amerikanischen Armee in die Hände. Zwischen der West- und der Ostfront lag zusammengepresst ein jammervoll demoliertes deutsches Heimatland.
Nicht nur das Oberkommando der Wehrmacht sah die Höllenpforten weit geöffnet. Die Herren Generale um Hitler und Keitel grübelten, wie sie den millionenfachen Männerverlust wettmachen könnten. Und so peitschten sie die Reserven aus den Hochschulen und Lazaretten zusammen, riefen die Hitlerjungen des Jahrganges achtundzwanzig komplett und teilweise den neunundzwanziger zur Hilfe. Auch die UK-(Unabkömmlichkeitsstellung) Stellung des immer noch jungen Ernst Peters wurde aufgehoben. Man beorderte ihn im November nach Süden an die inzwischen bis Budapest vorgerückte Front. Trotz seiner Infanterieuniform hatte er große Sorge, in russische Gefangenschaft zu geraten. Ein einziger dummer Zufall und man entdeckte die kleine Null unter der linken Achsel. Ernst rannte, wenn es ging, mehr als einmal um sein Leben in Richtung „Ami“ - Front. Kein Gedanke mehr an Glanz und Gloria ehemaliger großgermanischer Illusionen. Ein Hagel von MG Salven aus russischen Rohren streckte ihn nieder, er raffte sich auf - wie ein Wunder unverletzt- und schüttelte sieben Projektile aus dem untern Teil seines weiten neuen Wehrmachtsmantels.
Dass er letztlich den Amerikanern in die Arme lief, war sein Glück.
Jede Nacht träumte der Kriegsgefangene Ernst junior von daheim, währenddem er wochenlang hungernd und frierend auf nacktem Ackerboden kampierte. Ein „Hunne“ mehr unter so vielen Lebensunwerten, die nicht verdienten, verpflegt zu werden, wie nicht wenige Westalliiertenkommandeure allen Ernstes glaubten.
Dass die östlichen Machthaber ihre Gefangenen darben ließen, war wohl eher darauf zurück zu führen, dass alle Menschen des sowjetischen Imperiums bittere Not litten. Jedenfalls sagte Wilhelm Bartel das, der ehemalige, fleißige Aalfänger im Dienste der Petersfamilie.
Der nun fast dreißigjährige saß, fast zweitausend Kilometer vom Tollensesee entfernt, im Kriegsgefangenenlager Taganrog fest. Nach dem ungeheuren Desaster von Stalingrad, war er nur noch wenig mehr als eine Nummer.
Der Rest seines Wesens bestand, wie der Restteil seiner unglücklichen Kameraden, scheinbar nur aus Hunger.
Einmal, in seinem zweiten Gefangenschaftsjahr, wurde Fischer Bartel mit drei Kameraden abkommandiert, die für das Lager Taganrog bestimmten Brotmengen von der Großbäckerei abzuholen. Der erfahrene Wachhabende bemerkte natürlich die Differenz zwischen der am Tor der Brotfabrik entgegen genommenen Menge Brotlaibe und deren Anzahl beim Abladen an der Verpflegungsbaracke. Tschitirie, tschitirie. Ausgerechnet vier Brote fehlten. Eine furchtbare Lästerung folgte, ein viersilbiger, menschenverachtender Satz, der angeblich seit Katharina der Zweiten, in allen russisch sprechenden, bürgerlichen und sozialistischen Armeen gleichermaßen kursierte.
Wenn sie nicht vor seinen Augen jeder sofort ein ganzes Brot verzehrten, dann schieße er die vier Diebe über den Haufen. Wilhelm Bartel, der Einssechzigmann mit dem breiten Kreuz, nahm das Zweipfundbrot als Gnadengeschenk an und verschlang es, wie das erste, binnen weniger Minuten. Die andern drei Männer konnten ebenfalls wie die Wölfe fressen. Ob sie noch ein drittes Brot hinuntergeschluckt hätten?
Wilhelm berichtete, wie er in den Hochsommertagen des vorletzten Kriegsjahres auf einer trostlosen Baustelle Ziegelsteine schleppen musste.
Eine bissige Kasachin sei gerade ihre neue Aufpasserin geworden. Missgünstig sei sie gewesen, konnte wie ein Kerl fluchen. ‚Jihr Faschisten!’
Nicht ahnend, dass sie ihn verstehen konnte, riss Wilhelm Bartels Vordermann einen plumpen Witz auf ihre Kosten.
Das gab es hin und wieder, wenn der Galgenhumor sie packte. Sein Spott bezog sich auf ihren breiten Schoß und ihren übergroßen Busen.
Wilhelm konnte sein Grinsen geradeso verstecken. Sofort riss die Kasachin den Riemen ihrer “Spagin” von der Schulter herunter. Sie schwankte sekundenlang, ob sie schießen oder dem Beleidiger nur den Holzkolben ihrer Maschinenpistole um die Ohren schlagen sollte.
„Cherkommen!”
Ohne die Bürde abzusetzen, hielten beide Lastträger auf die beleidigte, wütende Bewacherin zu. „Jich värstehe Deitsch, du Schuft.” Sie hantierte noch mit der Waffe. Wilhelm zuckte nicht. Wenn sie schoss, dann war es eben aus mit diesem Hundeleben, das nun schon über anderthalb Jahre währte und dessen Ende nicht abzusehen war.
Aber sie schoss nicht, schlug nicht. Sie beruhigte sich wieder. Sie war keine Schönheit, aber sie war eine Frau. „Du hast deine Norm heite finfzig Prozente erfillt!”
Das hieß, der Beleidiger ginge an diesem Tag und vielleicht in den folgenden Tagen mit einer halben Portion Abendbrot zu Bett, auf die Pritsche. Das konnte der Tod sein, den sie über ihn verhängte.
Aber sie musste sich wehren.
Wilhelm taumelte. Mit schuldbewusst gesenktem Kopf und roten Ohren stand er unsicher wie ein lausiger Knirps da. Er wirkte noch kleiner, als er ohnehin war. Krampfhaft hielt er die Griffe der mit Steinen beladenen Trage. Inmitten des staubigen Bauplatzes übte sie die absolute Macht aus. In solcher Lage tut man nur, wozu man aufgefordert wird.
Mit ebenso rauer wie eiliger Stimme teilte sie dem überraschten Wilhelm Bartel mit, er erhalte eine Gutschrift über einhundertundfünfzig Prozent.
Wilhelms Kopf kam wieder höher.
Brüderlich vereint, wie sie seit Monaten gemeinsam Ziegelsteine schleppten, würden sie beide zusammen doch wieder über die übliche Tagesration von je einer Schüssel Kascha und vierhundert Gramm Brot verfügen. Das Überleben für die nächsten Nächte schien gesichert.
Wilhelm Bartel teilte auch an diesem Abend seine Ration in drei Teile. Ein Drittel tauschte er gegen Tabak, das zweite verzehrte er gleich. Das letzte Drittel nahm er zu sich, ehe er einschlief.
Der starke Machorkaqualm, den er gewohnheitsgemäß tief in sich saugte, übertäubte den Hunger.
Solche Lebensweise musste sich rächen. Starker Husten gesellte sich bald zur Erschöpfung.
Der Tag seines völligen Zusammenbruches stand vor der Tür. Im März ’45 war Fischer Bartel am Ende angelangt. Wilhelm sah plötzlich nichts, als das gähnende schwarze Loch. Kopfüber stürzte er da hinein. Aber die Körnchen der Sanduhr rannen weiter. Wie gern wäre er noch einmal hinausgefahren auf den schönen Tollensesee. Wie gern hätte er seine Frau Gertrud und Rita, die kleine Tochter, wieder gesehen, nach nunmehr zwei Jahren Gefangenschaft. Noch einmal, bevor er ausatmete, zogen die Bilder seines Schicksals in schneller Folge herauf.
Zu Zeiten des alten Ernst Peters waren ihm und seinem Kumpel gelungen zwei unbekümmerte Mädchen zu angeln. Er seufzte abgrundtief, denn das Abenteuer auf der Fischerinsel war schließlich Vergangenheit. Man musste jedoch immer wieder nach vorne denken, und da vorne war nur dieses Ungeheuer mit dem übel stinkenden, schwarzen Rachen.
Eins dieser Mädchen stach ihm, wie ihm schien, in den Arm. Für ihn ungezählte Tage später schlug Wilhelm Bartel wieder die Augen auf. Die Fieberträume wichen vor den Realitäten zurück.
Eine Ärztin! Ein schneeweißer Kittel. Die Dolmetscherin sagte, er bekäme noch eine Woche Urlaub im Lazarett. Aber ohne Machorka!
Den scharfen Vorwurf steckte er gelassen ein. Das hätten sie ihm nicht dolmetschen müssen. Denn die resolute, bebrillte Doktorin hatte seine rechte Hand ergriffen und in Höhe ihrer Augen gezerrt, sie gedreht und gewendet und dabei zornig auf seine gelbbraun eingebrannten Fingerkuppen verwiesen. Wilhelm krümmte sich zwar unter ihrem gestrengen Blick, doch er dachte: Du rede nur! Wenigstens ein Laster braucht der Mensch, um einen Grund zum Weiterleben zu haben. Sie schien zu ahnen, was er dachte. Das nahm sie ihm übel. Ihr langer Zeigefinger fuhr hart hin und her. In einem Ton, der verriet, wie gern sie ihm die Ohren lang ziehen würde, ließ sie ihm mitteilen: “Mit seiner Gesundheit spielt man nicht! Ja ihr Krieger! Alles kaputtmachen, das habt ihr schon gelernt, aber wie wäre es, wenn ihr etwas Besseres tun würdet?“
Am Entlassungstag stand - für ihn sehr verwunderlich - die blauäugige, ungeduldige Kasachin vor der Lazarettbaracke.
Es war ein warmer Frühlingsmorgen. Sie trug ihre braungraugrüne Wattejacke geöffnet. Wie immer stand sie mit der geschulterten ‘Spagin’, wie immer rauchend: “Dawei, dawei!”, drängte sie, als hätte sie es eilig, ihn wieder an die Arbeit zu treiben.
Warum war sie überhaupt da?
Ihm schien, dass sie aus den Augenwinkeln lächelte. Aber da hatte er sich wohl getäuscht. Verdeckter Hohn und Hass waren es, die ihn anfunkelten. Vielleicht war ihr Mann gefallen... durch jemanden wie ihn.
Sich selbst schnell in Bewegung setzen konnte Wilhelm wirklich nicht. Von wegen, dawei! Er ging langsam vor ihr her, etwas aufgepäppelt durch die Traubenzuckerspritzen. „Na lewo, … na prawo!” Wie ein orientalischer Sklave seiner Herrin gehorchte er ihr. Zornig geworden, wegen ihrer rüden Art, wünschte er ihr einen Fluch an den steifen Hals.
„Dawei, dawei!”
Blöde Ziege! Dich wollte ich nicht geschenkt haben!
Wilhelm schaute sich plötzlich um. Die Umgebung erschien ihm fremdartig. Wohin führte ihn die Aufseherin?
Wilhelm schnupperte Fisch- und Wassergeruch. Das erregte ihn. Als er dann die schwarzen und grünen Fangboote im nahen Hafen liegen sah, ging ihm das Herz auf. Er wandte sich zu ihr, studierte ihr breites, von einer blauen Dunstwolke umrahmtes Gesicht. Sie lächelte.
Jede Frau ist schön, wenn sie lächelt. “Hast du...?”
Sie nickte.
Die Augen wurden ihm feucht. “Du verfluchter Fritz!”, schimpfte sie, nur um ihre innere Bewegung und Rührung zu verstecken, die er besser spürte, als sie glaubte. „Chier wirrst du rabotten!”
Keine Steine mehr schleppen! Hinausfahren aufs Wasser! Fische fangen! Er sah die Heimat wieder! Wer Fische essen durfte, der kam auch wieder zu Kräften. Wie lieblich Tran doch duften konnte.
Mit Netzen aus Fäden so stark wie Bindfäden, wie ihm schien, fuhr er nun Tag um Tag aufs Asowsche Meer hinaus. “Otschen karascho!”
Im Asowschen Meer gab es mehr Fische als die kühnsten Planer ahnten. Wilhelm erfuhr, dass hier jährlich allein 85 000 t Feinfische, meist Zander, angelandet wurden. Eine schier unglaubliche Menge.
Noch hatte das sowjetische Politbüro ja nicht den weiteren Ausbau der Schwerindustrie im Bereich der Zuflüsse Don und Donez beschlossen, noch floss das Wasser reichlich und klar. Aber das Verhängnis drohte bereits. Die Entwürfe für die Entwicklung einer gigantischen Stahlproduktion gab es schon. Die Warner wurden beiseite geschoben. Sie mahnten, wenn zuviel Wasser der großen Ströme industriell verbraucht und als Dampf in die Luft gejagt würde, könnte es passieren, dass ein Umkehreffekt eintritt. Statt von Norden nach Süden Süßwasser ausfließen zu lassen, könnte das schwefelwasserstoffhaltige und deshalb giftige Wasser des Schwarzen Meeres durch die Meerenge von Kertsch eindringen und sämtlichen Fischen des Asowschen Wundermeeres den Garaus bereiten.
Die wenigen mutigen Kritiker sollten eines Tages leider Recht bekommen. An Stelle von Fischen befanden sich später in den Netzen nur Quallen.
Es nahte damit auch der Tag des Fehlurteils: Verfluchte Fischer! Ihr habt eure Pläne nicht erfüllt!
Aber dies traf erst später ein.
Die Taganroger Kollegen erkannten auf den ersten Blick, dass ihnen ein Mann half, der sein Fach verstand. Blitzschnell vermochte der untersetzte Deutsche mit einer selbst geschnitzten Stricknadel die während des Fangvorganges zerrissenen Netze fehlerfrei auszubessern.
Es ist nicht einfach sich im Maschenwirrwarr klafterweise zerfledderter Netzflächen zurechtzufinden. Da war von Wilhelms Hand weder eine Masche dazugemogelt noch eine unterschlagen worden. Das ist wichtig, weil solche Fehler sich fortsetzen und somit auf der Netzfläche Spannungen entstehen können, die seine Fangfähigkeit beeinträchtigen. Sie staunten über sein Arbeitstempo, wenn er neue Stellnetze anfertigte.
Bereits zu Ernst Peters Zeiten war Wilhelm Bartel stets der schnellste Anschläger gewesen. Ihm rannen die Maschen durch die Linke, als wäre sie handgerecht für ihn angefertigt. Mit der Rechten traf seine Stricknadel mit hundertprozentiger Sicherheit das erste Loch unter dem Fadenkreuz. Wilhelm lachte selten oder nie laut, sondern schmunzelte nur, wenn er sich freute. Bloß seine kräftigen Lippen wölbten sich dann.
So auch an jenem denkwürdigen 8. Mai 1945.
Ja, er war in der Seele froh, dass es wieder den guten alten Frieden gab. Frieden! Alles musste sich nun von Grund auf zum Guten ändern. Weihnachten würde er vielleicht wieder daheim sein.
Er stellte sich die Heimat herrlich vor. Er hatte sie zwei lange Jahre nicht mehr gesehen, - nur im Traum manchmal.
Neubrandenburg war jedoch, wie tausende andere schöne, deutsche Städte, in diesen beiden Jahren, in eine Trümmerwüste verwandelt worden.
In den Tagen der Siegesfeiern stahl er den in Alkoholorgien Schwelgenden zwei stattliche Zander. Wilhelm schmuggelte sie dreist aus dem Hafengelände. Er besaß, seitdem er fischen ging, einen Propusk, der ihm das erleichterte. Der kleine Ausweis gab ihm gewisse Bewegungsfreiheit.
Einen Fisch wollte er der Ärztin schenken, die ihm das Leben gerettet, den anderen hatte er der Kasachin zugedacht. Allerdings, wenn sie ihn schnappten, dann konnten ihm seine neuen Vorgesetzten das als Verbrechen ankreiden. Möglicherweise stand auf solchen Diebstahl der Hinauswurf aus der Fangbrigade. Dann wäre es aus mit den Vergünstigungen. Dessen war er sich wohl bewusst. Wenn sie zornig sein wollten, kannten sie kein Pardon. Hunger herrschte trotz des Sieges überall in der zerstörten Sowjetunion und das würde, nach Lage der Dinge, noch jahrelang so sein. Denn die Bauern und Ernährer hatte der Moloch Krieg ausgetilgt. Jedes Fischlein wurde streng ‚bewirtschaftet’.
Beide Edelfische versteckte er deshalb an sicherer Stelle. Wütend, als Wilhelm sie endlich gefunden hatte, fuhr ihn die Kasachin an. Er sei ein Hundesohn. Sie wüsste sowieso nicht, wo die Ärztin wohne und für sich selbst nehme sie nichts an.
Das sieht euch Fritzen ähnlich, Leute bestechen! Aber die Kinder verhungern.
Wenn er das je wiederholte, dann lasse sie ihm sämtliche Knochen brechen.
Wilhelms hageres Gesicht zuckte. Gewiss spielte sie ihm ihren Zorn nur vor. Sie würde annehmen!
Wilhelm spionierte ihr nach. Sie akzeptierte tatsächlich!
Je rechts und links unter dem Arm trug sie ihre kostbare Last. Das konnte für ihn nur gut sein. Hart die langen schwarzen Soldatenstiefel aufsetzend wirbelte sie Staub auf. Wilhelm beobachtete, wie seine Kasachin eins der Kinder auf der Straße packte und ihm mit eckigen Bewegungen einen der beiden Fische gab. Seinen mühsam geklauten Zander! Diesen Wunderfisch, der gut zubereitet und frisch verzehrt selbst Schwerkranke wieder auf die Beine bringen konnte. Als wäre der Teufel hinter ihm her, rannte das Kind mit dem Geschenk des Himmels davon. Es hielt geradewegs auf ihn zu. Verlegen kratzte Wilhelm Bartel den kahlgeschorenen Kopf. Er stand verdeckt und schaute. Irrtum ausgeschlossen. Es war ‚seine’ “Prawda”, in die er den Zander eingewickelt hatte. Das aus dem Deckblatt herausgerissene Viereck hatte ihm als Zigarettenpapier gedient. Weder die “Iswestija” noch die Gewerkschaftszeitung “Trud” eigneten sich so gut zum Papirossadrehen wie Stalins “Prawda”.
Vielleicht war der von ihr weitergeschenkte Fisch der, den sie der Ärztin bringen sollte. Neugierig geworden blieb Wilhelm ihr mit sicherem Abstand auf den Fersen. Sie hielt einige Male Leute an und sprach mit ihnen.
Der Weg, den sie entweder für ihn oder für sich selbst ging, war weit. Vor einem grünen Holzhaus blieb sie stehen. Ein Hund schlug an, eine alte Frau erschien. Anscheinend verstand die Babuschka nicht, dann jedoch bedankte sie sich mit Verneigungen, die nicht aufhören wollten. Die Kasachin wandte sich um.
Wihelm drückte sich in ein Gebüsch. Sein Herz klopfte stark, als sie dicht an ihm vorbeiging. Ihr Gesicht war gerötet, ihre dichten Augenbrauen gaben ihr einen überaus gewinnenden Ausdruck.
Er war klug genug sie nicht anzusprechen.
Die Kasachin sah er nie wieder.
Aus unerfindlichen Gründen wurde Wilhelm im Herbst ’45 gegen Ende der Fangsaison versetzt. Es war aus mit den lebensrettenden Zusatzmahlzeiten. Die Schwere der neuen Arbeit und der blaue Dunst warfen ihn bereits drei Monate später erneut auf die Bretter. Statt im Heimatzug befand er sich nun auf dem Weg in die Hölle. Niemand brachte ihm Fische. Es gab auch keine Traubenzuckerrationen mehr.
Wieder im Lazarett, siechte er dahin, statt sich zu erholen. Eine andere Ärztin behandelte ihn. Dysenterie dritten Grades wurde diagnostiziert. Über sechsunddreißig endlose Monate der Kriegsgefangenschaft lagen nun hinter ihm. Ein Sichtvermerk bezeichnete ihn als Todeskandidaten.
Das Kopfschütteln der sowjetischen Lagerärzte nahm kein Ende. Von den 100 000 deutschen Soldaten, die im Stalingrader Raum kapitulierten, waren zu diesem Zeitpunkt bereits weit über 50000 verstorben, die meisten verhungert. Eine Untersuchungskommission Moskauer Ärzte beriet sich mit den gefangenen deutschen Kollegen.
Einige wiesen bereits früher, aber vergeblich darauf hin, dass nur die überwiegend an Pflanzenkost Gewöhnten mit Kascha und Brot existieren könnten, weil der Vegetarier Verdauungstrakt einen halben Meter länger ist, als der eines Mischkost verzehrenden Fleischfressers. Das war der über Tod und Leben entscheidende Unterschied. Die einen erschlossen die in der kargen Nahrung steckenden essentiellen Aminosäuren vollständig, die andern nicht.
Das Sterben muss aufhören! verlangten die russischen Generalärzte gemeinsam mit ihren deutschen Fachkollegen. Sie beschlossen, wenn auch für die meisten Gefangenen zu spät: Erstens: Sofortige Entlassung aller an Dysenterie der Stufe drei erkrankten.
Zweitens: In den Schlachthöfen des Landes müsse man endlich das Blut auffangen und es konservieren, verarbeiten und als Nahrungsmittel den Gefangenen zukommen lassen.
Dem ersten Beschlusspunkt verdankte Fischer Wilhelm die vorzeitige Heimkehr. Er gehörte zu jenen sechs Prozent von den im Stalingrader Territorium gefangen genommenen deutschen Soldaten, die schließlich heimkehren durften.
Das geschah ihm, auch dank der Freundlichkeit einer unbekannten Kasachin.
Ausgehebelt
Diesseits der Elbe leuchteten die roten Sowjetsterne. Jenseits des westlichen Elbufers begann man fleißig Englisch zu lernen.
Auch Ernst Peters jun. saß fest. Selbst wenn er aus der Kriegsgefangenschaft entlassen würde, an Heimkehr war nicht zu denken. Denn falls ihm nur ein einziger Neubrandenburger nicht gut gesonnen war, konnte dies schlimmste Folgen für ihn haben. Entschiedener als die anderen Siegermächte hielten die Sowjets die SSler für die Hauptschuldigen.
Ernst musste mit dem Heimweh leben. Wäre er frei gewesen und zurückgekommen, er hätte seine Heimatstadt nicht wieder erkannt.
Von den beiden südlichen Straßenzügen abgesehen, bestand die Neubrandenburger Innenstadt im Wesentlichen aus rauchgeschwärzten bizarren Trümmerwänden.
Auch die berühmte Marienkirche stand nun zerstört da.
 |
| Bild Wikipedia |
Hunger und Typhus griffen um sich. Wohl dem der sich zusätzlich Nahrung verschaffen konnte.
Auch die Bezirks-Hebamme K. aus Prillwitz, bettelte bei Fritz Biederstaedt um einige Fische. Es war verboten, Fische unter der Hand zu verscherbeln. Er, der nun Schritt für Schritt an die Stelle des jungen Ernst Peters rücken sollte, hätte ihr ein paar Plieten schenken können. Nur, die große energische Dame, mit dem kleinen schwarzen Hut auf dem langen Kopf, glaubte sie sei etwas Besseres. Ihr herrisches Auftreten ärgerte ihn, er solle sich nicht so haben. Herrschsüchtige Weiber konnte Fritz auf den Tod nicht ausstehen. „Gnädige Frau!“ sagte er, „das kostet aber was!“ Sie verstand ihn falsch und schaute ihn unfreundlich an. Die harten Gesichtszüge der etwa gleichaltrigen Dame verrieten, dass sie von Männern wie ihn keine gute Meinung hegte. Als sie begriff, dass er meinte, was er sagte, händigte sie ihm das fast wertlose Nachkriegsgeld ohne Dank aus, drehte sich um und ging, dass die beiden Vogelfedern über ihren Ohren nur so wippten. “Alte Tunte!”, rief Biederstaedt ihr hinterher.
Das musste sie gehört haben. Denn sie hielt inne, während sie den kurzen Weg vom Holzsteg zum Land zurücklegte. Sie drehte sich zwar nicht um, doch die Art, wie sie stockte und weiterging und wie sie die Hacken aufsetzte, war der scharfe Ausdruck ihres Ärgers und ihrer Arroganz.
Das hatte sich im Dorf Wustrow zugetragen, wo er Ende Juli ’45 verbotenerweise ein paar Fische gegen Milch oder sogar gegen Butter eintauschte. Denn noch war die Rote Armee nicht allgegenwärtig und noch behandelten die Russen Übertretungen des Gesetzes nach Laune und eher großzügig. Ein ‚bisschen’ Klauen und ‚Schieben’ gehörten eben zur normalen Tagesordnung.
Einige Wochen später saß Fritz, nach getaner Arbeit nichtsahnend unter einer riesigen Weide im Gras und verzehrte sein Mittagsbrot, am Ufer des Nonnenbaches in Seenähe. Er liebte es gemütlich zu speisen. Die Lederschürze unter sich ausgebreitet, lag er mehr, als er saß, im Schatten. Er schaute, die noch gefüllte Bierflasche in der Hand, hinüber zur nahen Gaststätte und dem Wirtschaftshaus Nonnenhof. Viele seiner Erinnerungen hingen an dieser Umgebung.
Da kam sie plötzlich in sein Bild. Die resolute Bezirks-Hebamme stutzte kurz, als sie ihn liegen sah, stürzte, sich einen Ruck gebend, auf ihn zu, grüßte nicht, sondern herrschte ihn abermals an: „Setzen Sie mich schnell nach Prillwitz über!” Fritz wischte verdutzt Krümel von seinen Lippen, richtete sich halb auf und ärgerte sich zugleich, dass er ganz ähnlich einem Rekruten auf dem Kasernenhof, ihr beinahe gehorsam gewesen wäre.
Trotzig streckte er sich wieder der Länge nach hin. Da könne ja jeder kommen! Wer sie sei, dass sie sich herausnähme ihn herumzukommandieren?
Sie wäre Hebamme im Dienst. Da sei ihr Ausweis.
Das war viel.
Ihre Miene drückte ihren Unmut aus. Er wollte gerade fragen, ob sie auch ‘bitte’ sagen könne, als ein Fenster des großen Hauses des Pächters Leo Siebold aufgestoßen wurde. Ein ihm unbekanntes hübsches Gesicht zeigte sich, ein heller Wuschelkopf, eine etwa dreißigjährige Frau. Im Tonfall großen Zornes rief die Erregte herunter: ”Lassen Sie sich hier nie wieder blicken!”
Augenblicklich drehte sich die Gescholtene von Fritz ab. Die Hebamme legte genau so wie er sie bereits vor kurzem gesehen, den Kopf in den Nacken und ging mit eckigen Bewegungen auf die kleine Nonnenbrücke zu. Sie entschwand hinter dem Gestrüpp von Holunderbüschen und niedrigen Eschen. Fritz rieb seine Sattelnase, schurrte über seinen Bartansatz und räumte seine Schürze sowie die Kleinigkeiten beiseite. Ihm war der Appetit vergangen.
Wenige Tage später bestellte Bürgermeister Schwarzer, Fritz Biederstaedt zu sich ins Amt. Er machte sich mit Bedenken auf den Weg. Hatte ihn jemand angezeigt? Etwa wegen der paar Fische, die er verscheuert hatte? Elende Neider! Sieben fadenscheinige Ausreden legte er sich zurecht. Manchmal war es zum Verrücktwerden. Er könnte vielen helfen und durfte es nicht. Jedermann hungerte und die Furcht vor noch schlimmerem Hunger trieb junge, hübsche Mütter manchmal zum Äußersten, nämlich sich selbst als Tauschware anzubieten. Oberbürgermeister Schwarzer behelligte ihn erstaunlicherweise nicht. Schwarzer musterte Fritz Biederstaedt, der zu den wenigen Leuten gehörte, die gut beleibt gingen. Es schien, dass der Bürgermeister zögerte, ob er den vierzigjährigen Biederstaedt siezen oder duzen sollte. Schwarzer vermied zunächst beides. Er benötige eine Auskunft. Fritz kenne doch den Pächter des Anwesens Nonnenhof, Herrn Leo Siebold. Zur Person des Pächters gäbe es einige Fragen.
Und ob Fritz ihn kannte. Was er ihm, Siebold betreffend, sagen könne.
Nur das Beste! Das zu Nonnenhof gehörende Land werde gut bewirtschaftet, der Mensch Siebold sei umgänglich und zu ihm stets offen und freundlich gewesen. Ein engagierter Mann und Vogelliebhaber, ein Naturfreund, möglicherweise ein Liebhaber hübscher Gesichter.
Aber das interessierte den Bürgermeister nicht. „Gehörte der Mann der NSDAP an?”
„Nicht, dass ich wüsste!”, erwiderte Biederstaedt, schielte jedoch vorsichtig ob da eine Falle war. Er war betroffen. Aufpassen, Fritz! Ihre Mitgliedschaft wurde den Exnazis sehr verübelt und denen, die Umgang mit ihnen gepflegt hatten, traute man nicht. - Nein. Er sei sicher.
„Jemand klagt den Pächter Leo Siebold an, er sei Parteigenosse Hitlers gewesen und SS-Sonderführer. Was halten Sie davon? Sie waren doch näher mit ihm bekannt.”
„Nix holl ick dovon!“ ("Davon halte ich nichts!"), erwiderte Fritz. Lediglich bekannt wäre er mit Leo Siebold gewesen, nicht befreundet. Schwarzer winkte ab und Fritz strich in seiner Aufregung hörbar mit dem Daumen seiner Rechten über die rasierten Wangen. Woher er die Sicherheit nehme. Biederstaedt zuckte die Achseln. Das wäre ihm gewiss aufgefallen. Schließlich sei er während des ganzen Krieges hellwach gewesen. Seines Wissens hätte Herr Siebold sich nicht verstrickt, selten wären bei ihm SS-Leute zu Gast gewesen.
Da rief man den Oberbürgermeister ans Telefon im Nebenraum.
Fritz Biederstaedt schielte zum Tisch. Er sah da das Schreiben liegen welches Schwarzer während der Fragerei wiederholt zur Hand genommen hatte. Er wusste sogleich, das war es. Es lag offen da. Solange der Herr Oberbürgermeister telefonierte, durfte er sich erlauben, neugierig zu sein. Fritz hörte und bemerkte, dass es dauerte. Er legte den Kopf schief.
Prillwitz 7. September 1945, entzifferte er mühelos, dann mit Erstaunen die Anschrift der Hebamme K., Prillwitz.
Fritz überlegte nicht lange. Ein innerer Zwang, es ganz und gar zu erfahren, trieb ihn an. Er las schnell: „Bei meinen Besuchen in Nonnenhof fielen mir stets die SS-Besucher und die Parteileute auf, die dort verkehrten. Es besteht die Möglichkeit, dass Siebold in der heutigen Zeit und bei der abgelegenen Lage des Grundstückes SS- und Parteifreunde dort versteckt unterbringt. So hat er z.B. den in Neubrandenburg bekannten SS-Mann Busse bei sich aufgenommen...”
Der Stuhl im Nebenzimmer ruckte.
Fritz Biederstaedt setzte sich kerzengerade hin, spielte Desinteresse vor. Aber er war doch mehr als vorher aufgeregt. Die Dame K. ist wohl von allen guten Geistern verlassen. Fritz erinnerte sich allzugut der Frau mit dem Wuschelkopf, die sie des Hauses verwiesen hatte. Eifersucht kann eine Frau durchaus zu gefährlicher Verleumdung verleiten. Leo Siebold war ein gutaussehender, sportlicher Typ. Mit beeindruckend hoher Stirn, mit einer geraden langen Nase, dunkel, schlank, fast elegant.
So ein Biest! Biederstaedt dachte über die K. ein noch schlimmeres Wort. Der Siebold hat sie bestimmt aus gutem Grund abblitzen lassen. Möglicherweise ist sie verrückt vor Habgier. Oder alles zusammen, - eine Megäre. Dieses Wort hatte Biederstaedt in Berlin aufgeschnappt, bei Freifrau von Stein. Nie verwandte diese Dame von Welt vor der Dienerschaft, der er jahrelang angehörte, ein Schimpfwort. Aber es gab im vornehmen Haus nicht wenige weibliche Bedienstete, die einander nicht immer mit Koseworten bedachten. Oberbürgermeister Schwarzer kehrte zurück und schaute Fritz Biederstaedt nachdenklich an. Sein Blick wanderte heimlich vom Brief auf seinem Schreibtisch zu dem großflächigen, ein wenig verlegen wirkenden Fischergesicht. Schwarzer verzog seine Miene kaum merklich. Bürgermeister Schwarzer fragte wie obenhin: „Bist du nun der Chef bei den Fischern?”.
“Nee. Chef ist der alte Peters. Na ja, man mökt, wat man kann!”
Biederstaedt fiel, wenn er plauderte, fast immer ins Plattdeutsche. Wahrscheinlich war es dem Sozialisten Schwarzer zu wenig, ein belangsloses Gespräch zu führen. Tausend Sorgen plagten ihn.
Er besaß kein Rathaus, dafür aber viele Ruinen. Er sollte verwalten, aber die alten Verwaltungsbeamten waren geflohen oder vor dem Einmarsch der Roten Armee mit ihren Familien steinbeschwert ins Wasser des Tollensesees gesprungen. Er musste der zahlenmäßig ums Doppelte gewachsenen Stadt das tägliche Brot zur Verfügung stellen, obwohl die Russen die Getreidelasten auf den Speicherböden bereits halbiert hatten.
Seine beiden Sekretärinnen sollten eine Menge Post erledigen, jedoch bei Einbruch der Dunkelheit mussten sie das Schreiben einstellen, weil es weit und breit keine Glühlampen gab, es sei denn, man fand eine in einem einsturzgefährdeten Keller der niedergebrannten Bürgerhäuser.
Vielleicht wollte er fragen, ob Biederstaedt ihm ein paar Kilo Plötzen überlassen könnte, um ein begehrtes Tauschmittel zu erlangen.
„Also halten wir fest. Sie kennen Herrn Siebold persönlich und stellen ihm ein gutes Zeugnis aus.”
Fritz nickte und kratzte seine Wange. Schwarzer stellte noch ein paar Fragen und entließ Biederstaedt mit dem Wunsch, allezeit viele Fische zu fangen, denn der Hungertod als wahres Schreckgespenst kündigte bereits sein unerbittliches Regiment an. Die Thyphusfälle im Notlazarett ‚Fischerhaus’, Pfaffenstraße, nahmen rasch zu. Schwindsucht und Avitaminosen herrschten. Es stellte sich heraus, dass Siebold bereits verhaftet worden war. Fritz erfuhr es, als er in Wustrow nachfragte. Das Weib hatte es mit ihrem diffamierenden Brief erreicht. Sollte Siebold Nonnenhof nie wiedersehen? Wen die Russen abholten, der war verloren. Nun fehlte nur noch, dass fortan die Bezirks-Hebamme an Stelle des Domänenpächters in Nonnenhof schalten und walten wird.
Eine Woche später, als Fritz seine Netze unmittelbar vor Nonnenhof stellen wollte, schien ihm, dass der langbeinige Pächter Siebold gleichmütig auf der kleinen Anlegebrücke stand. Biederstaedt fuhr näher heran. Er glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Es war Siebold. Der umgängliche Mann grüßte ihn. Fritz stellte den Motor ab. Er winkte zurück. Siebold ermutigte Fritz Biederstaedt näher zu kommen. Der Pächter Nonnenhofs schaute ihn eine Weile an. Während Biederstaedt den uralten Heuer mit einem Stakruder kurz vor dem Steg zum Halten brachte, mahnte er sich zur Zurückhaltung.
Auf beiden Seiten war das Bedürfnis vorhanden, Fragen zu stellen.
„Es gibt große Schweinehunde!”, bemerkte der etwa fünfzigjährige Siebold, „auch weibliche!“ Er krauste die kluge Stirn.
Biederstaedt nickte vorsichtig.
Ihn beunruhigte, dass die scharfe Hebamme die Anzeige nicht anonym verfasst hatte. Sie musste ihrer Sache sehr sicher gewesen sein. Wer weiß, welches Ränkespiel sie noch betrieb, das ihn, Biederstaedt, möglicherweise persönlich betraf.
Konnte sie wirklich glauben, dass es Menschen gibt, die Verräter belohnen?
„Kämmerer Schillo hat mich herausgehauen!”, ergänzte der Freigelassene und lächelte Biederstaedt an.
„Ich auch!”, wollte Biederstaedt hinzufügen, doch aus gewissen Bedenken unterließ er es. Domänenpächter Siebold nickte: „Jeder Punkt der Anklage hat sich als restlos unwahr erwiesen!”
“Gägen de Lögen is also doch een Krut wussen.” ("Gegen Lügen ist also doch ein Kraut gewachsen."), sagte Fritz. “Dat kümmt allens rut!” ("Es kommt alles heraus!"), bestätigte der Nonnenhofer und er lächelte geheimnisvoll.
Um viele Wohnungen verkleinert, war die kleine Provinzstadt Neubrandenburg durch den enormen Flüchtlingsstrom gewachsen. Unter den Menschen aus dem Osten befanden sich auch Binnenfischer, die nach neuen Möglichkeiten Ausschau hielten.
In die Fischerei neu aufgenommen wurde Fritz Milster, ein Pommernflüchtling. Auch er ein Mann, der den Heimatverlust nie verwand.
Der alte Ernst Peters kam nicht mehr zu sich. Für ihn war das Leben aus. Auch wenn seine Männer gut fingen und er anstelle wertlosen Alliertengeldes von den Verpflegungsoffizieren der Roten Armee Nahrungsmittel und Kleiderstoffe erhielt, für die man in jeder Tauschzentrale außer kitschigen Ölgemälden auch wertvolle oder Weltliteratur kistenweise erwerben konnte. Nachdem sein Heinz gefallen war und der Älteste nicht heimkehren durfte, wusste er nicht, für wen er noch schuften lassen sollte. (Denn den dritten Sohn obwohl er ihm ähnlich sah, konnte er, übrigens sehr zu Unrecht, wie alle Freunde der Familie wussten, nicht anerkennen.)
Die zuständigen Rotarmisten hatten schon lange bemerkt, wie es um ihn bestellt war. Sie hielten sich an Fritz Biederstaedt als den Natschalnik. Gern wollte er Chef sein. Es lag ihm sehr, im ungeordneten Geschehen mitzumischen.
Fritz fand nach der Übereinkunft, die er mit dem alten Ernst getroffen, in den ersten Nächten dieser, seiner persönlichen Machtübernahme vor Aufregung kaum richtigen Schlaf. Immer wieder schrak er in freudiger Erregung hoch und malte sich die mögliche Zukunft bunt aus. Aus dem dunklen Elend ging unerwartet sein Stern auf. Vierzig Jahre war er nun alt, einsichtiger geworden und doch noch jung genug, um seiner Frau Ingeborg ein schöneres Leben bieten zu können. Das wollte er, nach nicht wenigen schwerwiegenden Fehlern, die er begangen hatte.
Dann kam Egon, ein Frühheimkehrer, aus amerikanischer Gefangenschaft.
Fritz nahm den hochgewachsenen Mann auf, weil er Mitleid empfand. Das Hungergesicht beeindruckte ihn. Andererseits kam ihm der Kerl von Anfang an nicht geheuer vor. Es war jedoch nur ein vages Gefühl gewesen. Das Lachen und dieses Grinsen hatte er gleich als falsch empfunden, diese zusammengekniffenen Augen hatten ihm von Anfang an nicht gefallen. Aber sollte Egon doch Fische fangen. Falls er wirklich verschlagen und listig war, half ihm das im Beruf.
Der wird froh sein, einen nahrhaften Job gefunden zu haben und schon deshalb niemanden behelligen.
Diese Fehleinschätzung sollte sich für Fritz als verhängnisvoll erweisen. Im April 1946 ergab sich für ihn die erste Möglichkeit, den Berliner Schwarzmarkt zu testen. Die ATG (Autotransportgesellschaft) hatte für eine Berlinreise, von der er zufällig erfuhr, noch freie Transportkapazität zu vergeben. Herzklopfend bot Biederstaedt dem Fahrer zehn Pfund Fische an, für den Fall, dass er ihn und ein paar Kisten Fische mitnähme. Aber einen Rucksack voll Bleiplieten müsste auch der ATG-Chef abbekommen. Der würde vielleicht Krach schlagen, wenn er von der Schmuggelei erführe. Denn Fische, sowie alle Lebensmittel, wurden noch schärfer als zuvor bewirtschaftet. Andererseits reisten täglich zehntausende Großstädter mit Kleidung und geretteten Wertgegenständen von Süd nach Nord und mit Mohrrüben, Wruken, Kartoffeln und Zuckerrüben von Nord nach Süd. Sogar auf den Trittbrettern der Reichsbahnwagen dritter Klasse hockten sie wie Trauben an den Reben. Auch auf den Dächern der D-Züge saßen die Verwegenen dicht beieinander, solange es die Witterungsbedingungen zuließen.
 |
| Bild: Bundesarchiv |
Fritz und seine Kollegen benötigten unbedingt Nägel, Anderthalb- oder Zweizöller. Die Fischkisten fielen auseinander. Für Nägel bekäme er außerdem in Rostock auch Catechu, ein Konservierungsmittel, das wie schwarzes Kolophonium aussah, mit dem unbedingt alljährlich die Hanf- und Baumwollnetze bonitiert werden müssen. Sonst verfaulte das Sommerzeug unter der Hand. Die Rückfahrt müsste er allerdings mit dem Zug antreten. Kein Problem, meinte Biederstaedt. Wenn er mehr als einen Zentner Nägel auftreiben könnte, dann würde er sie als Expressgut aufgeben. Aber diesen Schacher perfekt zu machen, traute er nur sich selbst zu.
Fritz bekam einen Schreck, als er endlich in Berlin angekommen, die brodelnde Menschenmasse im Zentrum der riesigen Ruinenstadt sah. Im Schatten der gespenstisch wirkenden, schwarzgefärbten Mauerreste wogten sie richtungslos hin und her. Offensichtlich warteten zahllose Frauen und Kinder nur auf eine Gelegenheit wie die, welche er zu bieten hatte. Sofort als der lahme von Holzgas
getriebene ehemalige Wehrmachts-LKW anhielt, näherten sich Gruppen neugieriger Halbstarker.
 |
| Hunger tut weh. |
Die Polizei wäre ihm dazwischen gefahren. Sie mussten schnellstmöglich das Weite suchen. Auf dem Potsdamer Platz entdeckte Biederstaedt unschwer die Geübten, die hinter dem halbgeöffneten Mantel Zigaretten anpriesen.
Einem der Schieber bot Fritz die Bleiplieten im Block an. Sofort wurde er beiseite gezogen. Nägel? Keine Hürde! Fünf Kilo Fische ein Kilo Nägel. Kleine? Große! Top! Dass er unerfahren war, sahen die Großschacherer. Eröffnete sich ihnen eine Goldgrube? Wie oft er liefern könne und welche Mengen. Wo er herkomme. Er hätte voraussehen müssen, dass sie ihn nicht wieder aus den Augen ins Nichts entlassen würden. Biederstaedt hätte wissen müssen, dass alles Tun und Lassen Folgen hat. Leichtsinnig gab er bekannt, er komme vom Tollensesee. Dass ihm die Russen zumindest vorläufig nur wenig Spielraum ließen, interessierte die Spekulanten wenig. Wo ein Wille sei, fände sich der Weg. „Weißt Du nicht, dass Hunger weh tut?“ Sie schleppten ihn quer durch die Stadt, um ihn mit ihrem Großhändler bekannt zu machen. Er wurde als Herr über zwanzig Quadratkilometer Fischgewässer vorgestellt. Fritz bekam die Nägel und freute sich offenherzig wie ein Kind. Er war naiv genug zu glauben, sie würden ihn bewundern. Das Gefühl, einen schwerwiegenden Fehler begangen zu haben, wiegelte er ab. Da sich sein LKW- Fahrer auf einer anderen Ganoventour befand, halfen ihm seine neuen Freunde zur nächstgelegenen Station und das war Bahnhof Zoo. Im Vertrauen auf die Bahnbeamten gab er das wertvolle Expressgut auf. In der Auskunft erfuhr er von einem gleichgültigen uralten Beamten, dass sein Personenzug ab Stettiner Bahnhof ausgefallen sei und der nächste D-Zug zwölf Stunden Verspätung habe. Das grobe, mürrische Gesicht des Mannes ging ihm nicht aus dem Sinn. Meine Güte, kann man sich selbst hassen?
Fritz las, während er hungrig umherschlenderte: „Heiße Brühe“, ging der freundlichen Einladung folgend in den dunklen Wartesaal. Er bestellte und schlürfte sie in sich. Gedankenlos sah er die Fettaugen auf dem grünen Wasser schwimmen, sah um sich das Elend in den Gesichtszügen unendlich vieler grauer Menschen, sah in jener Nacht des Wartens immer wieder eine ungeheuer dicke, noch junge Schieberin inmitten der schweigenden Hungernden. Sie thronte in ihrem schwarzen Wollmantel auf einem Haufen gefüllter Kartoffelsäcke. Wie das Plusterkleid einer brütenden Henne bedeckte ihr Gewand den Besitz.
Fritz ließ sich von einem klapprigen Ober eine zweite Brühe bringen. Und wieder fragte er sich nicht, wie das Wunder der Fettaugen auf dem heißen Wasser in diesem ausgemergelten Berlin zustande gekommen sein mochte. Bis er zwei Frauen bemerkte, beide bedeckt mit einer breiten Stola aus Katzenfellen. Die Erleuchtung kam heftig wie ein Blitz. Er sprang sofort auf, schüttelte sich im ersten Schreck, dann stockte er, und lachte in sich hinein. Na und? Schließlich sind Katzen längst nicht die hässlichsten Viecher.
Schlafend und unverschämt schnarchend, hockte die junge Dicke immer noch da oben, wie eine böse Hexe auf einem Berg funkelnder Diamanten. Das mochten fünf oder sechs Zentner Kartoffeln sein. Und immer noch saß daneben das kleine blasse Mädchen mit ihrer Mutter. Reglos starrten beide mit stumpfen Mienen auf den bewachten Kartoffelberg.
Auf der Heimfahrt, eingekeilt zwischen Unmengen Reisenden stehend, erinnerte Fritz sich der müden Augen des blassen Mädchens im Wartesaal. Fritz Biederstaedt schwor sich, Mensch zu sein. Nie wieder würde er eine Mutter, wenn sie ihn anbettelte, von sich weisen.
Im Sommer ’46 weigerte der See sich plötzlich wieder, seinen Reichtum antasten zu lassen. Fritz bekam umgehend Ärger mit dem ersten Verpflegungsoffizier Kabanow. Der verstand ihn überhaupt nicht. Wenn man ernsthaft wolle, dann könne man jederzeit Fische fangen. Auch der Genosse Stalin habe im November 1942 seinen Armeekommandeuren empfohlen zu wählen. Entweder brächten sie an seine Stadt in die Wolga Nachschub, oder er ließe sie an die Wand stellen.
Kabanow tobte. Ob er sich deutlich genug ausgedrückt hätte? Fritz zuckte die Achseln. So schlimm werden sie doch nicht mit ihm umspringen. Schließlich war der Krieg zu Ende.
Kabanows Gesichtsausdruck verriet einen bevorstehenden Wutanfall.
Meine Güte! Kerl! Ich kann doch nicht zaubern. Mit Händen und Füßen versuchte Fritz zu erklären, warum man einen tiefen Rinnensee nicht kontinuierlich wie ein Mohrrübenbeet abernten kann. Fische sind hochsensible Geschöpfe. Es gibt Fischarten, die auf eine Veränderung des Luftdruckes von einem zehntel Millibar reagieren, obwohl sie in der Tiefe eines Sees eigentlich nichts vom „Draußen“ spüren dürften.
Das wünschte der Russe keineswegs zur Kenntnis nehmen zu wollen.
Jedes folgende Wort schrie er gesondert heraus: „Du musst dein Soll pinktlich erfillen!“ Unnachgiebig und radebrechend verlangte Kabanow die Belieferung seiner Einheiten. Vertragstreue zumindest innerhalb einer Woche! Seine Arbeiterfaust stieß geradlinig nach vorne, schlug jedes Gegenargument K.O. Die Sieger ließen sich von deutschen Faschisten nicht auf der Nase herumtanzen. Sowjets werden Feinde wie Feinde behandeln. Das möge er sich dick hinter die Ohren schreiben.
Fritz bemühte sich, wie er früh in schwierigen Situationen gelernt hatte, verbindlich zu sein und höflich zu lächeln. Der derbe Mann empfand es wahrscheinlich als widerliches Geziere und Getue, „Frauen lachen!“ Die rotumrandeten Augen des Russen verhießen nichts Gutes. Mit ihm spaße man nicht.
Fisch und Fisch und nochmals Fisch!
Das ging einige unerträglich lange, vom Fangpech belastete Wochen so. Mitte Juli stellte ihm Kabanow, der mittlerweile selbst Schrammen abbekommen haben mochte, ein Ultimatum. „Wenn du
bis Sonnabend nicht jeden Tag dreihundert Kilogramm Fische ablieferst, schieße ich dir Loch in deinen Kopf!“
Die alten Mitfischer Mildener und Neumann, die den bösartigen Auftritt des Russen miterlebten, runzelten die Stirn. Denn das Wetter sah nicht nach Fangverbesserung aus. Es war wie verhext.
Am Donnerstag kamen zum Überfluss zwei Besucher, deren Visagen Fritz in Berlin gesehen hatte. Die Männer vom ‚Kudamm‘ hielten schnurstracks auf ihn zu. Es war, als wollten sie sagen, gewartet haben wir lange genug, jetzt wollen wir Taten sehen. „Du hast uns Fische versprochen. Wir haben dir geholfen! Oder etwa nicht? Wo bleibt die Gegenleistung?“
Auf Platt erwidert Fritz, sie seien quitt.
„Mensch! Du hast uns dis Maul wässrig jemacht!“
„Du hast was unterschrieben!“
„Dat is nich wohr!“
„ sajen wir mal, du lüferst dat dreifache in eine Woche, oder wir fangen an, unjemütlich zu wern.“
„Mensch! Wir wolln doch bloß dein Bestet.“
Eine Sekunde lang kämpfte Fritz den Satz herunter: „Ick mok den Hund los.“ Stattdessen fluchte er: „Seid ihr des Teufels, Männer?“
„Ja!“ lautete die Antwort, „auch das. Du weißt doch, was wehtut!“
Die beiden hatten ihm gerade noch gefehlt. „Ich habe große Sorgen, kommt im September wieder, wenn es wieder fängt.“ Er hätte es bemerken müssen, dass sie die Abweisung scheinbar gelassen hinnahmen. Er hätte sich Gedanken machen müssen und sich gewisse Fragen stellen sollen. Vielleicht wäre ihm ein Licht aufgegangen, wenn er in diesem Zusammenhang auch an Egon gedacht hätte. Er wollte nicht ahnen, dass die beiden Halunken nicht gekommen waren, um sich mit leeren Worten abspeisen zu lassen. Sie hatten ihm vor allem ins Gedächtnis gerufen, dass es sie und ihre Interessen immer noch gab und dass sie mehr Macht besaßen, als er sich vorstellen konnte. Aber in dem Augenblick, als die beiden Männer scheinbar verständnisvoll nickten, betraten zwei energisch auf ihn zustürmende Russen das Fischereigelände. Sie nahmen seine Aufmerksamkeit voll in Anspruch. Plötzlich hatte er die Schieber aus den Augen verloren. Fritz plagten tausend unbeantwortbare Fragen. „Ja, wir fahren sofort auf den See!“ Aus Angst stieg er völlig unvorbereitet zu seinen Fängern in die Kähne. So wie er stand und ging. Froh, dass er sich die Blutsauger und die Russen auf diese Weise vom Halse halten konnte. In Schuhen, statt in Stiefeln befand er sich an Bord des Kutters. Ohne Schürze, ohne Verpflegung. Er bemerkte nicht, dass Egon sich mit Handschlag von den Berlinern verabschiedete. „Los Lüd, Motor anschmieten. Los! Wech, bloß wech hier!“103 Sie fingen so gut wie nichts mit dem Zugnetz. Auch der Freitag verging, und Fritz vermochte seinen Verbindlichkeiten nur zum Teil nachzukommen. Die Stellnetzfischer hatten sechzig Kilogramm gefangen. Doch das rettete ihn nicht. Mindestens das Zehnfache der Menge musste her. Er überraschte Kurt Willig, als der einen toten Hecht mit Steinen fütterte. Fritz sprang sofort an. Seine derbe, fliehende Stirn stieß nach vorne. „Glaubst du, dass mich dein Betrug vorm Galgen rettet? Kabanow schlägt mich tot.“ Er warf ihm ein paar ungeheure Schimpfworte an den Kopf...
Kabanow kam um die Ecke gebogen, als wäre er gerufen worden. Augenscheinlich war er betrunken.
Er nestelte an der Pistolentasche. Zitterte. Wo die Fische bleiben. Einen Tag gebe er ihm noch. „Morgen Towarischtschi!“ Fritz saß endgültig der Galgenvogel im Genick. Eine einzige Nacht blieb ihm. Er fuhr nach anstrengender Tagesarbeit mit auf den See hinaus. Sie legten den sichersten Zug, „de Wied“, vor Tollenseheim an. Alles vergeblich. Schon beim Aussetzen des Netzes zogen niedrighängende Sturmwolken auf. Noch lag zwar die Seehaut glatt wie ein Spiegel. Doch das schlechte Omen winkte schon.
Fritz hatte zwar den Wetterbericht gehört, aber nicht damit gerechnet, dass die Wetterfront so schnell heraufkam. Das fast dreihundert Meter lange Fangzeug trieb im See nach links, dann plötzlich ebenso rasant nach rechts, wie ein Fetzen Papier in einer winderfüllten Häuserschlucht.
Es gehörte zu den Geheimnissen, hinter welches kein Binnenfischer jemals gekommen war, warum die Wassermassen bereits mehrere Stunden vor einem Sturm in heftige Bewegung geraten. Ströme und Gegenströme toben sich dann aus. Es schien, zwei uneinige Titanenhände hätten ins Wasser der riesigen Wanne hineingegriffen und es machtvoll umhergewirbelt. Wenn das geschah, verlor jedes Zugnetz den Bodenkontakt und die verschreckten Fischschwärme suchten vermutlich das stillere Zentrum des Gewässers auf. Da waren sie sicher. Dahin war noch nie ein Netz gelangt. Da gab es keine Turbulenzen.
Das Wassertreiben mochten die Luftdruckunterschiede auf zehn Kilometer Seelänge verursachen oder die starken Temperaturgegensätze zwischen Oberflächenwasser und dem Seewasser des Hypolimnion. Gleichgültig was die physikalische Ursache sein mochte, die Tatsache der inneren Strömung an sich verdarb häufig die besten Fangabsichten. Fritz sah an diesem Schicksalstag die schnellen Richtungsänderungen an dem heranzuwindenden Drahtseil mit Schrecken. Es war aus. Das Wasser gluckste wie seine Seele. Außer, dass dieses seitliche Zeugtreiben den fischereilichen Misserfolg mehr als nur erahnen ließ, erschreckte Fritz zusätzlich die Angst, sein großes Netz könnte auf die scharfkantigen Steine des Nachbarzuges getrieben und zerrissen werden. Das wäre nicht zum ersten Mal so. Einmal hatten sie auf diese Weise ein Loch von über einhundert Meter Länge gerissen. Machtlos gegen die unsichtbar im Seeinnern tobenden Naturgewalten hielten die Fischer auf seinen Zuruf mit der Arbeit des Heranwindens inne. Fritz kapitulierte vor den Naturgewalten. Schnell mussten die Ankerleinen nun gelöst und dann das Garn aus dem wilden See geborgen werden, um größeren Schaden zu verhüten. Eine erste Windbö fegte dahin. Die sechs Wadenfischer rafften im Eiltempo ihr Geschirr zusammen. Achtzig Meter vom Schilfgürtel entfernt, trieben sie weiter, bis sich wahrscheinlich auf einer Flügelseite die Unterleine hinter einem auf dem Seeboden liegenden großen Stein verhakte. Ob das ein Glück- oder Unglücksfall war, musste sich noch zeigen. Es pfiff. Die Arbeitsboote schaukelten bereits bedenklich auf dem schwarzen Wasser. Im Westen lag nur noch ein sonderbarer heller Strich über dem Horizont. Er kündigte die eigentliche Gefahr an.
Biederstaedt, als siebenter, als freier Mann, wollte den Kutter schnell von der entfernten Ankerstelle holen. Er fuhr mit dem Beiboot hin. Musste gegen den stärker werdenden Wind und die Strömung ankämpfen. Er hätte heulen und toben können, doch das half ihm auch nicht weiter. Fisch musste her. Fisch! Aber wie?
Während er sich durch die Nacht schwer rudernd abmühte, haderte er wüst mit den Umständen und sich selbst. Denn er sah, was ihn erwartete: eine Zelle mit Gittern. Es sei denn, er ließ sie einen zweiten Zug anlegen. Er sah es deutlich. Es gab keine Wahl. Er musste unbedingt diesen zweiten Zug wagen und zwar auf der anderen, der windgeschützten, Seeseite. Aber wie sollte er das seinen Männern beibringen? Sie werden meutern. Dann musste er ihnen, zum ersten Mal in seinem Dasein als ihr Chef, ernsthaft Konsequenzen androhen. „Verrat! Verrat!“ schrie er sich aus. Dieses unbezähmbare Wogen in seinem Innern war unerträglich. Er musste es hinausbrüllen, ob sie ihn hörten oder nicht.
Mit bitterbösen Gedanken kam Biederstaedt am breiten, verankerten und deshalb auf den langen Wellen tanzenden Kutter an, rammte Holz auf Holz. Jäh vom Wunsch erfüllt am liebsten alles zerstören zu wollen, riss er die Lederschürze vom Leib. Schwang sich über und trat wütend gegen die kleine Tür, ging zornentbrannt in die Kabine, warf mit einem Fluch den Motor an, holte mit schlimmen Gefühlen die Halteleine mit dem Anker ein. „Nein!“, tobte er gegen sich selbst. Er wird nicht Hand an sich legen. Das wird kein Fritz Biederstaedt tun, solange Luft in ihm ist. Sich durchkämpfend, suchte er sich in der Schwärze der Nacht zu orientieren. Er sah nur einen dunklen Punkt in der Finsternis zur Rechten. Das mussten die anderen sein. Die Wellen schäumten. Dicke Regentropfen zerplatzten an der kleinen Sichtscheibe. Er tuckerte auf seine Männer zu.
Es wurde noch einmal ruhiger, vor dem eigentlichen Sturm, eine Minute lang. Der Augenblick des tiefen Einatmens war es. Fritz Biederstaedt kam nahe an sie heran und erkannte, dass sie das Zeug noch nicht restlos geborgen hatten. Ihn trieb die Verzweiflung zur Unvorsichtigkeit. Er schrie hinüber zu den schwarzen Schatten in den schwarzen, winzigen, schaukelnden Booten. Sie sollten sich beeilen, sie müssten noch einen zweiten Zug anlegen.
Wie ein Soldat mit Rang kam er sich vor, der seine Truppen besiegt sieht und wie von Sinnen verlangt, sie sollten vorwärts stürmen. Es war ihm gleichgültig, dass sie aufgebracht und zurückschreiend konterten, er sei wahnsinnig geworden. Fritz wischte sich den Angstschweiß von der Stirn. Er hätte schweigen müssen, solange sie das Garn hereinhaspelten. Der Wind trieb ihn schräg und schnell an ihnen vorbei. Die zunehmende Entfernung übertönend, fuhr er sie grober an, als er wollte. Das Letzte mochten sie nicht mehr gehört haben. Ob sie nicht wüssten, dass ihm das Messer an der Kehle stünde. Er gurgelte es wüst heraus. Nein, schrie er wiederholt sich selbst an und warf, mit der Handkurbel drehend, wieder den Motor an. Fritz bemerkte nicht, dass er sich bereits mitten im Gebiet der unterseeischen Findlingsbrocken von Kalbertoch befand. Der nächste Wellenberg konnte ihn machtvoll auf die Steine werfen. Dann war es nicht nur mit der Nachtfischerei aus. Er schaltete, indem er wütend den Vorwärtsgang einrückte. Sein Kutter kämpfte sich voran. Vielleicht hatten ihn nur wenige Meter von der Katastrophe getrennt.
Ungeschickt, steuerte er direkt auf die Männer zu. Wasser deckte seine Scheibe zu. Weiße Kämme wogten. Sie verfluchten ihn sicherlich. Da war er schon bei ihnen. Die Männer wirbelten jäh durcheinander. Denn die Kräfte der vorwärts schießenden Kuttermasse und der Widerstand der beiden zurücktreibenden Arbeitskähne bewirkten, dass die dünne Stevenleine zerriss, die sie hastig über den Kutterhaken geworfen. Dennoch hatte der heftige Ruck ausgereicht, die Kähne zu stoppen. Die Spitzenfischer drohten Fritz Biederstaedt wütend mit den Fäusten. In seiner Verwirrung machte er den Motor aus. Sein Manöver war mehr als ungeschickt gewesen. Pitschnass mussten sie geworden sein. Doch sie konnten die Ankerleinen einhängen und schließlich eiligst übersteigen. Fritz
kroch aus der Kabine hervor. Wenn er wenigstens gewartet hätte, bis sie alle hinter ihm auf der schwarzen Ducht Platz genommen, oder noch klüger, bis er sie aus der Windzone weg hinüber in den Windschatten gefahren hätte. Nein, noch bevor der erste Mann in die schützende Kabine flüchtete, kommandierte er herum: „Los Lued, de Storm luert nich, führn wi daohl un trecken noch Dörpen!“ ("Los Leute, der Sturm wartet nicht, fahren wir hinunter und ziehen noch Dörpen!")
Seine Stimme hatte sich selbständig gemacht, sein Tonfall war herab in Basstiefe gesunken. Zwingen konnte er sie nur schwerlich, aber den Fischern den Willen lassen schon gar nicht. Der Wind sauste. Sie umringten ihn, während er noch auf den morschen Schweffbrettern draußen stand. Diese Wand aus Ablehnung und Wut war beängstigend. Aber selbst wenn sie ihn in Stücke rissen. „Dörpen“ musste noch gezogen werden. In diesen Sekunden großen Schweigens nötigte Fritz sie, jeder für sich, zu entscheiden, ob sie ihm folgen sollten oder ob sie riskieren wollten, dass er sie wegen Befehlsverweigerung anzeigte. Sonst müssten sie ihn totschlagen und über Bord werfen. Die Zeiger der Uhren rückten auf die letzte Tagesstunde vor. Große, unwirklich helle Wolkenbatzen stürmten herüber. Sie mussten sich beeilen. Jetzt fehlte nur noch, dass der Motor nicht ansprang. Binnen weniger Augenblicke würde der volle Sturm losbrechen. Sie mussten unbedingt den Bereich von Alt Meyershof erreichen. Die Fischer zwängten sich und drängten an ihm vorbei unters Dach.
Der riesige Deutzmotor donnerte los. Fritz schaltete unüberhörbar. Breitbeinig stellte er sich vor das Steuer. „Du weißt selbst, dass es sinnlos ist!“ dröhnte der sonst besonnene Reiniger und klopfte die Wassertropfen von seiner Jacke. Als Letzter war er hereingekommen, nahm neben den anderen Männern in völliger Dunkelheit Platz. Er war ein Mann, der, wenn er nicht angesprochen wurde, selten den Mund auftat, immer hochdeutsch, immer freundlich. Umso erstaunter war Fritz, dass er ihm ins Ohr geschrieen hatte.
Das Schiff brach die Gewalt der meterhohen Wellen, indem es langsam und genau gegen die Windrichtung anfuhr. Das minderte auch die Gefahr für die im Schlepp befindlichen Arbeitsboote. Langsamer als im Schritttempo ging es vorwärts. Erst zweihundert Meter vor Rehser Ecken, nach einer knappen dreiviertel Fahrstunde, nahm die Kraft des aufgewühlten Wassers merklich ab. Plötzlich tauchten sie in den Windschatten, den das Steilufer und die hundertjährigen Buchenkronen boten. Eine weitere halbe Stunde später langten sie auf der Zughöhe von Dörpen an. Sie hatten Zeit genug gehabt, alles zu bedenken und der Höhepunkt vor der endgültigen Entscheidung war erreicht. Biederstaedt biss die Zähne zusammen, drosselte das Fahrtempo. Das war die Aufforderung: Ergebt euch!
Einer gehorchte. Kurt Willig, sein wahrer Freund. „Lued!“ ("Leute!") , rief Willig, aber nur dieses eine Wort. Stumm krochen die Männer einer nach dem anderen aus dem Dunkel hervor. Zuletzt Egon. Man hörte noch das gewaltige Rauschen, doch es war nicht unmöglich, den Zug anzulegen. Direkt unter dem Holz brachen die Höhen von Neuendorf jeden Sturm aus nordwestlichen Richtungen. Sie stiegen schließlich wortlos hinüber in die Kähne, nahmen die Pätschen, stießen sich vom Schleppboot ab, obwohl sie nur schwache Umrisse vom Schilfgürtel in zweihundert Metern Entfernung erkennen konnten.
Das Zeug trieb erstaunlicherweise wenig. Das Netz kam voller Fische und problemlos heran. „Mach’ dat man, Fritz!“, sagten sie, nachdem sie auf dem Fischereigehöft angekommen waren, in der Halbfinsternis die halbpfündigen Barsche und eine Menge Plötzen verwogen hatten und eine Batterie von vierzig gefüllten Fischkisten aufgestapelt dastand. Das war viel mehr, als ihre Fangschuld betrug. Sie hatten die Menge nach Arten sortiert und beim Schein einer kleinen Glühlampe verwogen, der letzten die sie durch Eintausch von zwei Kilo Aal hatten auftreiben können. Mildner und sogar Karl Neumann klopften Fritz Biederstaedt auf die Schulter, als sie sich verabschiedeten.
Die Russen lachten, als sie am Nachmittag ankamen und die Bescherung sahen. Unbekümmert darüber, dass die guten Fische in der Wärme des Tages ohne Eis dagestanden hatten, verluden sie
die gefüllten Kisten. Vielleicht ließen sie einen Teil der empfindlichen Ware noch einen weiteren Tag auf die Verarbeitung warten, das nahmen sie nicht so genau. Auch interessierte sie herzlich wenig, dass Fritz Biederstaedt auch weiterhin hätte Pech haben können. „Ti rebak, ti dolschen snatch. Karascho?“ - Gut. Du bist der Fischer!
Kabanow geizte nicht mit Lob und Prämien. Sechs Meter Anzugstoff warf er am folgenden Tag auf den Frühstückstisch. Seine grünlichen Augen leuchteten. Wenn er reichlich Fische verteilen konnte, sollten sich die Fänger mit ihm freuen dürfen. Er war doch kein Unmensch. Lediglich sein Glück fiel auf sie zurück, oder sein Unglück dreifach. Mehr war es nicht. Er stieß mit Biederstaedt, Willig und Mildener an. Druschba! Biederstaedt kniff die Lippen zusammen.
Ein unbekannter Mann schaute zur Tür herein, sah sich um und seufzte: „So sorgenlos wie ihr lebt, möchte ich es auch mal haben!“
Waldheim
Fritz zog den Fehlschluss, er hätte in Kabanow einen ständigen Freund gewonnen. Er glaubte allen Ernstes, es könne ihm nun nicht mehr viel passieren. Deshalb holte er heimlich aus dem Versteck des doppelstöckigen und maroden Inselhauses, endlich seine schöne Armeepistole heraus. In den letzten Kriegstagen hatte er das gefährliche Ding samt passender Munition auf der Straße gefunden. Mancherorts lagen damals herrenlose Waffen in Massen herum.
Wie oft hatte Fritz die griffige Waffe liebevoll in seiner Hand gewogen. Mit ihr war man Herr über Leben und Tod. Sie erschien ihm wertvoll wie Gold. Endlich konnte er sich leisten, mit einem bisschen Vorsicht seiner heimlichen Leidenschaft zu frönen und wildernd auf Jagd zu gehen.
Beim ersten Knall zuckte Fritz noch zusammen. Später sagte er sich selbst beruhigend, wer da im Nonnenhofer Bruch geschossen haben mochte, sei bei der Anzahl wildernder Russenoffiziere sowieso ungewiss. Ohnehin könnte er gar nicht gefasst werden, denn Boote hatten die Sowjets nicht. Außerdem würde ihm schlimmstenfalls schon eine gute Ausrede einfallen.
Rehe und sogar Wildschweine fielen ihm zum Opfer. Nicht dass er das Fleisch benötigte, sondern ihn stachelte der Genuss einer Illusion an. Welcher Triumph, mit einem Fingerdruck einen wehrhaften Keiler zur Strecke bringen zu können.
Fritz saß an seinem Unglückstag abends, wie in letzter Zeit schon häufiger, in der kleinen wohnlichen Küche und putzte hinter vorgezogenen Gardinen seinen Revolver. Inge ging zu Bett.
Da polterte es plötzlich, harte Geräusche. Fritz gelang es noch, die Waffe zu verstecken. Die Türen flogen krachend auf. Vier Russen mit den roten Armbinden der Armeepolizei umringten ihn. Vier Läufe von Maschinenpistolen starrten ihn an. Ein mongolisch aussehender Offizier drängte sich vor. Inge öffnete die Tür auf einen Spalt.
Sie schrie kurz und schrill auf.
Der kräftige Mongole schob Fritz beiseite, schaute unter den Küchentisch, zog einen Kochtopf hervor. Mit spitzen Fingern nahm er den Deckel herunter und fasste ebenso den grauen Wolllappen, hob ihn vorsichtig, als läge darunter eine Giftschlange. Da glänzte ihn der deutsche Armeerevolver an.
Ein Schwall russischer Worte ergoss sich über Fritz Biederstaedt. Einer packte ihn energisch beim Kragen. Fritz vermochte es nur noch, nach seinem Jackett zu greifen. Er kam nicht mehr dazu, es anzuziehen. Auch war er außerstande, ein Wort hervorzubringen. Er hörte Inge hinter sich herrufen. Die Türen fielen krachend ins Schloss. Während sie ihn vorwärts stießen, über den schwarzen Bürgersteig, hatte er eine Vision. Nur einmal, in weit zurückliegender Zeit, hatte er Inge so gesehen. Sie stand in diesen Augenblicken des Schreckens vor ihm auf dem Hügel vor Bökbarg. Ihr rotes Kleid leuchtete. Umgeben vom Gras und den gelben Blumen der Wiese, völlig umgoldet vom Sonnenschein, lehnte sie sich an den Stamm einer Birke und strahlte ihn an.
Sie rissen ihm die Jacke aus der Hand, warfen sie ihm über den Kopf und stießen ihn durch die schweigende Finsternis zu ihrem Fahrzeug. Hart und hastig ging es zu. Halb zerrten, halb warfen sie ihn unter Fluchreden brutal auf die Ladefläche des hochbordigen LKWs. Der schwere Laster fuhr ruckend los und schaukelte wild. Die vielen Kurven und Ecken, die sie schlugen, verwirrten Fritz noch mehr. Er kam in ein Haus, in dem es kalt und feucht war. Unverständliche Worte rings um ihn herum. Sie brachten ihn in einen Keller. Ein Ellenbogen rammte ihn. Fritz fiel hin. Die Tür knarrte und wieder umflatterten ihn Kommandos. Sein Herz schlug bis zum Hals. Es ist aus, Fritz Biederstaedt.
In die Pausen der unwirklichen Stille hinein schrie jemand aus der Tiefe des Grauens jammervoll. Woher das kam, war ihm zunächst unerklärlich. Einmal schien ihm, dass ein Kater mit menschlicher Stimme aufjaulte, dann, dass ein Mitgefangener irgendwo sich aufbäumte.
Fritz lag zwischen losen Brettern. Er fühlte das Jackett in seiner Hand. Alles dehnte sich, wie ihm schien. Ihm kam es so vor als würde sein Kopf sich unentwegt weiten.
Nichts denken! Grau in Grau war die Zeit. Sie bewegte sich nicht. Inge selbst war grau geworden und unendlich fern von ihm. Fritz begehrte nichts, als selbst in dieses ferne Grau hineinzusinken.
Sobald er in seinem Kummer hinüberfiel fuhr Fritz mit der jähen Erkenntnis hoch. „Wenn du dir Egon B. nicht zum Feind gemacht hättest, wärst du in Freiheit.“
Dass er unentwegt und heftig schlotterte, lag nicht nur an der Kälte.
„Wegen seiner großen Fresse! Du hast ihn falsch behandelt! Verraten aus Zorn! Egon wusste!“
Alles schien ihm plötzlich gegenwärtig zu sein. Doch vor allen anderen Empfindungen setzte sich die eine durch:
Du kommst hier nie wieder raus! Nie wieder.
Schwach aus unerforschlicher Tiefe hatte er kurz zuvor eine zaghafte Gegenstimme vernommen. Gern hätte er ihr gelauscht und sich ihr anvertraut. Die schwieg nun auch.
Als das Schlimmste empfand er, dass seine Gedanken nichts änderten. Weinend wandte Fritz den Kopf zur Wand. Es schüttelte ihn durch und durch. Er schluchzte nach seiner Inge. Nie wiedersehen!
Sein schwarzes Gedankenkarussel rotierte unaufhörlich mit ihm von bekannten in unbekannte Räume, nur unterbrochen von Sekundenschlaf.
Nur manchmal an diesen ersten beiden Tagen seiner Gefangenschaft konnte er klar denken. Fritz erinnerte sich nun auch daran, dass Neumann und sogar Milster ihm gelegentlich Hinweise gegeben hatten, vorsichtig zu sein, denn Egon B. schüre die Stimmung gegen ihn. Und er hatte immer wieder abgewinkt. Sogar gelacht hatte er, leichtfertig und überheblich, als sei ein Biederstaedt unverwundbar, bloß weil er bisher gut durchgekommen war. Als sei das bereits eine Garantie, als gäbe es überhaupt eine Art von Vertrag mit dem Leben. Du Narr! fuhr er sich selber an. Der Ring schloss sich definitiv. Wie Schuppen fiel es ihm von den Augen: Egon hatte während der ganzen Zeit der Frühjahrsfischerei die Berliner Schieber bedient! Daher die Amizigaretten. Deshalb waren die Schwarzhändler nicht wieder aufgetaucht. Und ich habe euch nicht glauben wollen.
Am sehr frühen Morgen nach wiederum durchzitterten Nachtstunden, mit kurzen ohnmachtsähnlichen Phasen, aus denen er immer erneut hochschreckte, holten sie ihn. Seit langem hatte er sein Wasser lassen müssen. Der Posten verzog keine Miene, als er auf seine Not aufmerksam machte.
„In dem Zimmer, in das sie ihn brachten, ruhten auf nicht aufgedeckten Ehebetten zwei Offiziere, in Uniform. Sie lagen mit ihren schwarzen, neuen Stiefeln und schliefen. Grelles Licht blendete ihn. Der Dolmetscher fragte, wem er die Pistole abgekauft und wie viel Fische er dafür bezahlt hat.
Seine Erklärungsversuche beantwortete der Mann in Zivil mit Fußtritten. Fritz schaute hilfesuchend nach den beiden Männern, die sich, gleichmäßig schniefend, auf den grünen Steppdecken räkelten.
Auf wen er habe schießen wollen.
Fußtritte.
Er solle die Fragen korrekt beantworten und nicht wie ein Weib lachen.
Schließlich bedeuteten sie ihm, er stünde vor einem sowjetischen Militärgericht und solle endlich die Wahrheit sagen.
Zum hundertsten Mal, wie ihm vorkam, antwortete Fritz: „Ich habe Wild gejagt!“
Diese Lügen würden sie ihm schon noch austreiben. Wer unter seiner Führung auf Sowjetoffiziere geschossen hätte. Fritz kniff die Augenlider zusammen. „Sagen sie die Wahrheit!“ Der Zehnerukas sei ihm ohnehin gewiss, so oder so.
Er sah ein, es war zwecklos, sich zu verteidigen. Am fünften oder sechsten Tag kamen ein paar andere Deutsche hinzu. Der Keller füllte sich. Unter den für ihn neuen Inhaftierten befand sich ein gewisser Rohloff, der Personalchef bei Rinker gewesen war. Der kräftige Mann mit dem großen zusammengefallenen Gesicht nickte bloß oder schwieg. Er stand stundenlang und starrte durch den winzigen Sehschlitz auf die Straße. Man sah aber nur die Beine der ahnungslos vorübergehenden Menschen. Einer sagte später, der dicke Rohloff sitze schon ein Jahr lang ein und habe Monate zuvor einmal die Beine seiner Frau gesehen. Fritz Biederstaedt drehte sich ab und legte die Hand auf die Augen.
Jemand meinte, sie würden gesammelt. Sie würden sie im Dunkeln verrecken lassen, sagte ein anderer.
Fritz kam nach Fünfeichen, dann nach Waldheim, wo er Bruno Roloff wieder sah. Stets stand Fritz die Summe von 3650 Hungertagen wie eine ihn ringsum einschließende, bis in den Himmel reichende Felsenwand vor Augen. Schon die ersten hundert Tage lehrten ihn, dass es auf Gottes Erdboden nichts Schlimmeres gibt als bösartige Deutsche. Es gab Menschen, wenn auch wenige, die in den schrecklichen Konzentrationslagern Hitlers und Heinrich Himmlers gelitten hatten und nun als widerliche Aufseher Rache nahmen.
Ihre heillose Wut, die besten Jahre ihres Lebens unter der Fuchtel von Sadisten verbracht zu haben, kehrte sich gegen die vermeintlichen Urheber ihres Elends. Zudem gab es Mitinsassen, denen nachgesagt wurde, sie hätten Leidensgefährten für eine Scheibe Brot verraten.
Am schlimmsten ging es den verhafteten Jungen. Fritz Biederstaedt sah sie onanierend. In geringer Entfernung seiner Baracke befand sich das Frauen- und Mädchenlager. Vielleicht war es Zufall, vielleicht Teil eines fluchwürdigen Planes. Beide Seiten fanden, wenn die Innenlampen leuchteten oder wenn die Fenster geöffnet wurden, freien Blick aufeinander. Verzweifelt suchten die Jungen und Mädchen einander vorzuweisen, dass ihr Liebestrieb lebte. Alle trugen mindestens die Last des Zehnerstrafmaßes, auch diejenigen, die nicht das Geringste verbrochen, sondern nur verleumdet worden waren.
Vierzig Lebensjahre in Freiheit, benötigte der unglückliche Fischer und Exdiener, um so etwas wie ein schwarzer Philosoph zu werden und vierzig weitere Wochen, um tiefer und besser zu sehen. Nie zuvor hatte er sich die Zeit genommen, kritisch darüber nachzudenken, wovon er wirklich überzeugt war und weshalb er eigentlich lebte. Erst jetzt, als er in der todsicheren Hölle saß, stellte sich seine bisherige Lebensweise von selbst in Frage. Was war wirklich wichtig gewesen?
Das Mädchen im Heidehof? Ihr blendender Teint und ihre weißen Knie? Ihre Umarmungen und ihr Flüstern? Mit bitterstem Nachgeschmack war er oft von ihr weg auf die Fischerinsel gefahren, nicht nur, um seine Netze zu stellen, wie er sich selbst zu überzeugen versuchte, sondern um nicht gleich danach Inge frech in die Augen hinein lügen zu müssen, es sei alles in bester Ordnung.
Noch vor wenigen Jahren meinte er, er wüsste das Wichtigste und worauf es ankam im Leben: nämlich, wie man Gewissensbisse ausschaltet. Man leugnete einfach, schuldig zu sein. Der verfluchte Alkohol! Die bösen Weiber hatten Schuld! Aber er wusste dennoch, wen er schlecht gemacht hatte. Dieses Wissen und das Unvermögen zu zeigen, er könnte ein besserer sein, plagte ihn.
Wenn er wenigstens eine sinnvolle Tätigkeit in diesem verfluchten Lager fände. Doch immer musste er nur dasitzen und sich kaputtgrübeln. Fritz versuchte zwar die Selbstvorwürfe von sich zu weisen, jedoch kehrten sie mit bestimmten Erinnerungen unaufhaltsam ins Bewusstsein zurück. Einmal hatte er Kurt Willig zu einem dieser folgenschweren Abenteuer verleiten wollen. Einfach weil es ihn reizte, das Verbotene zu tun. Das muss zwei Jahre vor dem Polenfeldzug gewesen sein. Inge ging nach langer Ehe endlich schwanger. Er würde eine Woche lang auf der Insel bleiben. Ganz fest hatte sie sich an ihn geklammert und leise gesagt, dass sie ein ungutes Gefühl quäle. Er möge bitte, wenn möglich, jeden Abend wenigstens für eine Stunde nach ihr sehen.
Da waren zwei Abende, an denen das auch möglich gewesen wäre. Doch schon am Ende des ersten Tages gab es zwei schöne junge Frauen in der Schenke am Nonnenbach. Waldheim-Häftling Fritz Biederstaedt sah die beiden schwarzhaarigen Mädchen deutlich vor sich, aber auch die volltrunkenen Ehemänner der beiden. Denn die lagen pustend mit ihren betäubten Schädeln auf den rohen Brettern eines Klapptisches.
Wahrscheinlich aus ihrer Enttäuschung heraus, schamlos von ihren starken Beschützern im Stich gelassen worden zu sein, gingen die beiden Damen sofort auf das Angebot ein, mit ihm und seinem Freund Willig auf der romantischen, mitternächtlichen Fischerinsel eine Aalsuppe zu kochen. In einer guten Stunde wären sie wieder zurück.
Doch die Uhr zeigte schon die Stunde vor Mitternacht an. Kurt und er hätten längst in den Federn liegen müssen. Der frühe Morgen verlangte stets, dass sie schnellstens ihre Aalschnüre heben müssten. Vielleicht reizte es die beiden Damen, ihren Männern eine harmlos gemeinte Lektion zu erteilen. Vielleicht fühlten sie wie er den Nervenkitzel vor dem Ungewöhnlichen. Als sie einstiegen in den Heuer, umfasste Fritz die kleinere mit Blicken und genoss die Stimmung und Vorfreude auf ein Erlebnis zu zweit. Wunderhübsch sah die fast knabenhaft zart wirkende junge Frau in ihrem enganliegenden Kleid aus. Das festzustellen hinderte ihn die Dunkelheit nicht. Kurt Willig kurbelte den kleinen Deutzmotor an und schon rauschte der Heuer los. Die beiden, wahrscheinlich wegen der harten Motorengeräusche, Verunsicherten klammerten sich fest aneinander. Fritz konnte sich genau seiner damaligen Aufregung erinnern. Sie lamentierten nicht, Angst vortäuschend, schrieen weder Zeter noch Mordio als es Ernst wurde, sondern machten mit. Der Jubel, den er damals spürte, war ihm sehr gegenwärtig. Auch allerdings die Wucht der Selbstanklage wie gemein es von ihm gewesen war, die Tatsache zu verdrängen, dass Inge auf ihn wartete.
Kurt wird sich mit der größeren begnügen müssen, hatte er gedacht. Es war schon erstaunlich für ihn zu erkennen, über welch großes Kapital der Mensch doch mit seinem Erinnerungsvermögen verfügt. Ein jahrzehntealter Gedanke, sogar ein Lustgefühl ließ sich wie ein handfestes Geldstück, aus der Tiefe des Sackes heraufholen.
Eine Stunde! Was tut man nicht alles für eine Stunde erwarteten Glücks. Aber lohnte es, dafür einen Teil des eigenen und das halbe Leben seiner Frau zu opfern? Schon Schlämann hatte immer behauptet, die alten Griechen hätten deswegen verheerende Kriege geführt. Deswegen!
Fritz Biederstaedt lauschte dem Klang des glucksenden Wassers, wie es schäumte und an den Bordwänden entlangrauschte. Nonnenhof blieb, wie die Gedanken, an Inge weit zurück. Nichts und niemand sollte ihn hindern.
Kurt Willig, Vater von fünf Kindern, dröhnte ihm allerdings ins Ohr, er würde nun umkehren. Er wolle sofort aus dem Spiel steigen.
„Kurt! Dat lot ick mi nich entgohn! Eine Stund‘, Kurt!“("Kurt, das lasse ich mir nicht entgehen...") Und das Bein gegen die Ruderpinne stemmend, hatte er Kurt schließlich überzeugt, es gäbe nun kein Zurück mehr. Biederstaedt seufzte auf. Er sah sie leibhaftig, die drohende Faust des Mannes, die er blitzschnell herunterziehen musste, aus Sorge, die jungen Frauen würden sich erschrecken.
„Fritz, seit Klock vür sünd wi unnerwägs.“ ("Fritz, seit vier Uhr sind wir unterwegs.") Das halbe Leben! Aber was ist die eine Hälfte ohne die andere? Vielleicht spürte der alte Familienvater es nicht wie er. Was waren dagegen die eintausendvierhundert Haken, die sie aufgenommen hatten. Was
waren fünf Kilometer Schnur gewesen gegen das? Wie wenig galt ihm der Erfolg von sechzig Kilo Aalen? Was war das schon? Mit einer Unterbrechung von gut zwei Stunden Mittagsschlaf hatten sie fast achtzehn Arbeitsstunden hinter sich. Wenn Kurt auch hundertmal hinterher gesagt und geschimpft hatte, er hätte von vorne herein auf das fragwürdige Vergnügen gepfiffen.
Wäre Kurt Willig nicht so hirnrissig gewesen, es wäre ein Riesenvergnügen geworden...
Nie wird er vergessen, wie die beiden Frauen auf der feuchten Ruderbank in kaum zu durchdringender Finsternis dagesessen hatten. Wie Küken kauerten sie und froren anscheinend jämmerlich. Unglaublich das ganze Bild, wie sich vor dem etwas heller erscheinenden Nachthimmel die riesigen Pappeln der Inselzone abzeichneten.
Leichter Westwind bewegte die mächtigen Baumkronen. Kurz bevor sie ankamen und ins total Finstere vor dem einsam aufragenden Inselhaus eintauchten, ging mit lautem Krachen der Motor aus.
„Uk dat noch!“, fluchte Kurt, „Hüt geiht alles scheif!“("Auch das noch, heute geht alles schief,") . Beängstigende Stille breitete sich danach aus. Unheimlich säuselten die Blätter der sich duckenden Weidenbüsche. Aufgeschreckte Schwäne gaben Laut.
Er möge sich bitte beherrschen, hatte er Kurt noch einmal eindringlich zugeraunt. Als die beiden Damen jedoch zu begreifen begannen, wo sie gelandet waren, bekamen sie den ersten größeren Angstanfall. Ob der Motor wirklich kaputt gegangen sei.
Kurt bestätigte es mit dem für ihn typischen Tonfall mürrisch. Das und sie hätten ihm gerade noch gefehlt.
Zu allem Unglück trat eine der beiden Schönheiten auch noch ins Wasser, statt auf den festen Steg. So gut wie ihm möglich war, hatte Fritz sie getröstet und ebenso beschwörend wie auch gegen besseres Wissen versprochen, ehe die Suppe fertig sei, hätte sein Freund Kurt den Schaden längst behoben. Ihrer Ehemänner wegen brauchten sie sich nicht zu sorgen. Aus Verlegenheit, in der er sich sah, hatte er noch zuversichtlich gelacht. Er kenne das, wie schwer weinmüde Köpfe wiegen könnten. So manche Nacht hätte er im nasskalten Kahn statt im Bett geschlafen.
Mit seiner väterlichen Art hatte er schon mehr als eine Frau betört.
Sie wünschten sofort zurückzukehren zu ihren Männern!
Unmöglich! Fritz könnte sie doch hinüberrudern.
Doch Kraft und Lebenslust waren schlagartig aus ihm gewichen. Eine Weile hatte er drinnen nach einer neuen Schachtel Streichhölzer suchen müssen. Die Petroleumlampe ließ sich eher finden. Er entzündete den vorbereiteten Kienspan im Herd, goss das abgestandene Seewasser in einen verrußten Kochtopf, taumelte mehr als er ging zum Wasser und kescherte ein paar Aale aus dem Schweff. Sagte: „Ierst de Supp!“ ("Erst die Suppe!")
Dann übergab er, mit letzter Willenskraft den sich sträubenden Frauen die lebhaften Fische und suchte für sie noch ein Messer. Den Aufschrei des Entsetzens beider, niemals könne er ihnen zumuten, die Schlangen zu töten, nahm er gerade noch wahr. Er sagte noch, er käme gleich wieder, kam aber nicht weit, fiel der Länge nach in sein weiches, immer weiß bezogenes Bett, das breit und ungeheuer einladend in einer der beiden Raumnischen stand. Mit knapper Mühe war ihm noch gelungen, wenigstens einen der beiden langschäftigen Lederstiefel abzustreifen, dann war es aus mit seiner Konzentrationsfähigkeit. Der Körper verlangte unabweisbares Recht. Wahrscheinlich werden ihn die beiden Damen heftig bestürmt und vergeblich gerüttelt haben.
Nach ungefähr vier Stunden ohnmachtsähnlichem Tiefschlaf muss er hochgeschreckt sein. Es war exakt die Stunde und Minute, in der sie aufzustehen gewohnt waren. Punkt vier Uhr.
Der neue Tag kam mit einem Summton herauf. Aus seinem von unangenehmen Geräuschen erfüllten Schädel tauchte die ebenso unangenehme Frage auf: Was war gestern Abend gewesen? Traum oder Wirklichkeit? Die plötzliche Bestürzung muss ihm die Erkenntnis heraufgerüttelt haben dass die hübschen schwarzhaarigen Damen noch irgendwo saßen und heulten. Mit eiserner Energie befahl Fritz sich aufzustehen. Im Halbtaumel irrte er durchs Haus. Er fand nur Kurt. Der ruhte auf dem anderen Lager. „Kurt! Höchste Tied!“ ("Kurt, höchste Zeit!")
Während er sich abmühte, seinen Mitfischer zu wecken, drehte der sich geräuschvoll herum, wandte ihm den breiten, verlängerten Rücken zu und schrie sich markerschütternd mit einem ungeheuer obszönen Ausdruck den angestauten Zorn von der Seele.
Das gewisse Wort hallte so intensiv und lange in der Vielzahl der Hirnwindungen des Sträflings Fritz Biederstaedt nach, bis er die Konsonanten und Vokale herauslachen musste.
Zwei dicke Tränentropfen fielen auf die spindeldürren Schenkel des Häftlings. Sie besiegelten ein für allemal die Zeit der Freiheit, Inges Zeit, die er ihr so oft zu flüchtigem Missbrauch gestohlen hatte.
Niemals wird er das große Tor des Zuchthauses verlassen.
Hundertmal davor und danach schaute er denselben Traum. Ohne auch nur einen einzigen Schritt vorwärts zu kommen, marschierte er mit zentnerschweren, kalten Füßen im tiefen Matsch des auftauenden Eises auf dem Tollensesee. Zehnmal wachte er in jeder Nacht auf. Starrte in ein von Ächzen, Stöhnen und Gestank erfülltes Loch und musste sich gewaltsam beruhigen. Die Eispampe, in der er stecken blieb, gab es im ehemaligen KZ und jetzigen NKWD-Lager Waldheim nicht. Hier gingen die Tage nicht vorwärts und der Hunger nahm nie ab.
Tags malte er sich aus lebhaft sprudelnder Erinnerung die Bilder vom wogenden Ried der Lieps, die niemand außer ihm privat befahren durfte. Er hielt mit seinem eigenen Segelboot in den weißgetupften Seerosenfeldern. Inge lag vor ihm im Badeanzug, in weichen Kissen.
Über den Wipfeln der Birken und Erlen, die unmittelbar am Ufer standen, taumelten die schwarzen, wie Rauch wehenden Zuckmückenschwärme ihre betörenden Massenhochzeitstänze, getragen nur vom warmen, aufsteigenden Atem der Baumkronen. Alles erschien ihm wie damals an jenem Junitag. Inges schönen, weichen Körper stellte er sich vor, und wie er ihn berührte. Erfreuen konnte er sich an diesem Bild nicht.
Zu sehr fraß an ihm die Sorge, was sie gerade tat. Hatte sie die Kraft, auf ihn zu warten? Wie lange noch? Wusste sie etwas? Hatte sie es herausgefunden, mit wem er einige Nächte auf der Fischerinsel zugebracht, wenn seine Mitfischer hinunter zu ihren Familien gefahren waren? Ahnte sie, was ihm jahrelang die kleine, schielende Heidehoferin bedeutet hatte? Konnte er es ungeschehen machen?
War es nicht sonderbar, dass ihn gerade die Kleinigkeiten verraten konnten?
Hatte sie ihm jede Ausrede geglaubt oder sich längst gerächt und Gleiches mit Gleichem vergolten?
Die Sehnsucht nach seinem wunderschönen Zuhause verzehrte ihn. Solange es alltägliche Wirklichkeit gewesen war, hatte er es nicht geschätzt. Erst der Verlust zeigte ihm, dass er glücklich gewesen war.
Nun wurde, was er in der Freiheit nie so klar gesehen hatte, zur unersetzlichen Kostbarkeit. Er war mit etwas gesegnet worden, das er manchmal wie Glimmer behandelt und missachtet hatte. Noch einmal von vorne anfangen zu können, dachte er, das wäre mein größter Wunsch! Es verblasst ja alles andere, und nur die Sehnsucht nach dir ist geblieben. Was sind mir jetzt die anderen Menschen wert, die an mir wie Nebelschwaden vorbeizogen und mir nur für Minuten vorgaukeln konnten, sie könnten mein Leben für immer versüßen.
Gerade dieser sich immer wieder einstellende Selbstvorwurf, viel zu oft die Illusionen hochgeschätzt und das eigentliche Leben darüber vernachlässigt zu haben, quälte ihn.
Im schier endlosen Winter von ’47 zu ’48 erkrankte Fritz lebensgefährlich. Parathyphus und Ruhr herrschten erbarmungslos. Vor seinem inneren Auge rollten Tag und Nacht nie zuvor geschaute Gemälde als endlose Kette herrlichster Visionen vorbei. Eine Farbenpracht ohnegleichen ergoss sich als Flut von Ideen und Szenen über ihn.
Manchmal während dieser Zeit befand er sich in seinen wirren Träumen und Gedanken im Berlin der zwanziger Jahre. Er sah sich wieder als Diener bei der bezaubernd schönen Freifrau von Stein.
Manchmal war alles sogar noch klarer als damals. Es waren die Szenen auf der im Halbdunkel liegenden Salontreppe, wo sich die Pärchen hastig zusammengeworfen hatten, im Spiegelbad, wo sich General a.D. Berg und die Gräfin von Schöne unbeobachtet glaubten. Es waren die Bilder von feierlichen Banketten und den Stunden danach. Unverwüstliches Toben war es. Aber er sehnte sich nicht mehr danach, sondern nach der Ruhe seines Heimes.
Später, als Fritz sich allmählich zu erholen begann, weil ihm jemand täglich einen Teelöffel Zucker in den Mund gesteckt hatte, dachte er darüber nach, wie sonderbar deutlich er im Traum die Freifrau und ihre Gäste vor sich gesehen hatte. Ganz klar war sein Urteilvermögen gewesen.
Ihr vornehmes Wesen hatte ihn unbewusst als Ideal begleitet. Diese Frau liebte er über alles. Weil sie eben nichts vortäuschte. Gleichmäßig war sie jedermann gegenüber freundlich.
Den kleinsten Diener im Hause hatte sie nicht seinem Stande gemäß behandelt und den größten General und Schauspieler nicht einem anderen Menschen vorgezogen. Sie sprach nie mit zwei Zungen. Sie sprach nicht, wie so viele ihresgleichen, geringschätzig von ihren Angestellten. Sie hielt ihre Diener nicht für eine Unterart der allgemeinen Menschen- und Herrenrasse. Ihr war nie gleichgültig gewesen, was er hörte und sah.
Die meisten anderen Herrschaften täuschten sich selbst und ihre Mitmenschen, was das Zeug hergab.
Exaktes Rollenspiel laut Drehbuch nach traditioneller Regie zu sämtlichen offiziellen Anlässen, ehe der Vorhang aufging und die Scheinwerferlichter jede Pose beleuchteten. Es hatte ihn immer belustigt zu sehen, wie sie an ihren Krawatten zogen, oder wie die Damen ihre Mienen zurechtsetzten, kurz bevor ihr Auftritt kam. Aber dann das Geschehen nach Herzenswut und -lust hinter der Bühne, vier, fünf Stunden später, nachdem reichlich Wein geflossen war. Erst hinter den Kulissen gaben sie sich, wie sie beschaffen waren. Nicht wenige der Großen hatte er bar jeder Kultur erlebt.
Schüsseln voll ätzenden Spottes könnte er über Männer wie General a.D. Berg ausgießen. Charmant gab sich der Mann in der Öffentlichkeit als makelloser Kavalier. Als wäre sein Gemüt rein wie frisch gefallener Schnee. Aber nach dem fünften Glas redete und prahlte er ungehemmt, als wäre er in vertrauter Kriegsgewinnlerrunde.
Ein ganz gewöhnlicher Waffenschieber war er.
Einmal hatte Fritz ihn ertappt, oben den Frack, mit der kleinen Blume am Revers, unten die nackten Knie und die entblößten Schenkel. Wo der a.D. erschien, ging nicht ein Mann, sondern eine randvoll gefüllte Chronik des Krieges und des Verderbens umher. Gerade zwischen seinem Schein und Sein klafften unüberbrückbare Abgründe. Erobern musste er, und sei es das jüngste Küchenmädchen. Das Verrückte war, dass außer der Freifrau viele dem neureichen General ins Gesicht hinein Komplimente machten, nachdem er aber weggegangen war, lästerten sie gnadenlos: Wussten sie schon, meine Liebste..., mit der Gräfin Schöne hat er es..., tun beide immer so als würden sie sich wieder einmal zufällig treffen..., ein Taugenichts, vom Scheitel bis zur Sohle.
1949
Am Vorabend des 7. Oktober 1949 verkündigte der kommunistische Präsident Wilhelm Pieck, anlässlich der Staatsgründung der Deutschen Demokratischen Republik, eine Generalamnestie für Verbrecher mit Urteilen aus SMAD-Zeiten bis zu zehn Jahren. (Sowjetische Militär-Administration)
Unerwartet kam auf diese Weise auch für Fritz Biederstaedt der Tag der Freiheit. Aber wie traf ihn diese gute Botschaft an? Ausgezehrt und kleinlaut trat er kurz darauf die Heimreise an. Mit allen Bedenken und Bangen sah er seiner ungewissen Zukunft entgegen. Erneut bedrängte ihn hinsichtlich seiner Frau große Sorge.
Im Zug von Berlin nach Neubrandenburg saß jemand, der ihm bekannt vorkam. Der Mann sprach ihn kurz vor Neustrelitz an, ob er der Fischer Fritz Biederstaedt sei. Scheu blickte der Bekannte, an dessen Namen er sich nicht erinnern konnte, und tuschelte Unbestimmtes.
Fritz fragte sich, was diese Andeutungen ausdrücken sollten.
Ihn interessierte nicht, was der eigenartige Mensch wollte. Er wünschte, dass man ihn in Ruhe ließ. Es fehlte noch, dass der Mann ihn fragte, wo er solange gewesen sei. „Die Russen saugen uns bis aufs Blut aus!“, flüsterte sein Gegenüber sonderbar unnatürlich. Die Schienenstöße ließen die rollenden Räder in jeder Sekunde hart aufschlagen. Fritz schaute nach draußen. Er öffnete das Abteilfenster auf einen kleinen Spalt und sog die heimatliche Luft tief in die Lungen. Neubrandenburg erwartete ihn schon, hoffentlich auch Inge, die im letzten Brief geschrieben hatte, in Neubrandenburg sei alles beim alten. Genau das erwartete er nicht. Gerade dieser Satz hatte ihn erregt, weil ihre wenigen Worte etwas völlig Neues versteckten. Das spürte er doch. Nichts war so geblieben, wie es einst gewesen war. Schließlich war er selbst sehr verändert worden. Diese drei langen Jahre hatten ihn gezeichnet.
Warum er umgezogen sei, fragte der unsympathische Bekannte. Wahrscheinlich wusste der neugierige Kerl, dass er gesessen hatte. Wer ist umgezogen? fragte Fritz sich. Die Frage war ein Signal. Es betraf Inge. Doch was ging das den an? Fritz schalt sich aus. Wie oft hatte er auf Gefühle geachtet und sich geirrt und verschätzt. Nervös schaute er, ob Burg Stargard in Sicht kam.
„Du kennst sie ja die lieben Mitmenschen, sie reden viel!“, sagte der andere. Als sein ungebetener Gesprächspartner das ausgesprochen hatte, konnte Fritz sich plötzlich erinnern. Der Mann mit der schiefen roten Nase war Schmiedegeselle und hatte gelegentlich Peters Pferde beschlagen. Hufschmied Marlows Geselle. Er hatte mit ihm nie näher zu tun gehabt. Der Mensch war ihm unheimlich. Mit unstetem Blick, wie ein böser Kobold, hockte er auf der harten Pritsche. Nur um ihn zu quälen, saß er ihm gegenüber. Übrigens, die Fischer seien jetzt ganz und gar selbstständig. Den alten Peters hätte die Stadtverwaltung völlig kaltgestellt. Es ginge den Männern aber eher schlecht als recht. Zu den hundert Fragen, die Fritz niederdrückten, packte der Gnom ein Dutzend neue. Fast noch schlimmer als in den Tagen seiner Gefangenschaft spürte Fritz, wie wund sein Inneres war. Grau von Angesicht und schmal stand er vor dem Abteilfenster hinter dem die herrliche Hügellandschaft vorbeirauschte. Was werden ihm die nächsten drei Stunden bescheren? Fritz strich sein angegrautes Haar zur Seite und versuchte, seiner Pergamenthaut ein Lächeln aufzusetzen. Wer Waldheim und Fünfeichen überlebt hat, den kann nichts mehr schrecken. Hast du es soweit geschafft, kommst du auch bis ans Ende durch.
Egal was es ist, die Welt wird ihn nicht erschüttern. Und wenn schon, ein Biederstaedt wird es nie zeigen.
Als der Personenzug die letzte Kurve vor der Einfahrt in den heimischen Bahnhof nahm, kreischten die sich am Schienenrand hart reibenden Räder. Es klang ihm als schrilles Hie! Hie Fritz, hie bist du hie! Es zirpte darüber auch ein sonderbares: „Di is nich‘ hie!“
Die war aber nicht die schielende, schöne Heidehöferin. Die war Inge. Schmerzhaft vernahm er, dass es nicht aufhören wollte. „Die ist nicht hie!“
Nein, verrückt war er nicht. Noch nicht. Noch lange nicht. „Die ist nicht hie.“
Bis der Zug hielt, schrillte es in ihm. Schroff drehte er dem Schmiedeknecht den Rücken zu, als der sich verabschieden wollte. Als ginge Fritz aufs Neueis, prüften seine Füße den Boden des Bahnsteiges.
Fritz Biederstaedt fragte sich, ob er sich nicht zuerst Mut antrinken sollte. Mit den fünfzig Mark Handgeld kam er ohnehin nicht weit. Es war spät geworden und begann zu dunkeln. Fritz verließ den Wartesaal und wischte sich über die Lippen. Er wählte den Weg zur Marienkirche hinunter. Schlich, nachdem er einen Teil der Trümmerwüste Neubrandenburg mit wehmütigen Gefühlen durchquert hatte, die Katharinenstraße hinauf. Sah beklommen das einstige Wohnhaus der Fischerfamilie Peters.
Er pochte an die Tür des kleinen Hauses, indem er mit seiner Inge gewohnt hatte. Eine große, alte Frau öffnete und gab ihm Bescheid. Frau Biederstaedt sei umgezogen. Sie nannte die Straße. Das war nicht weit. Fritz ging schnell. Noch bevor er anklopfte, hörte er ihre Stimme.
Jetzt bist du daheim, dachte er, bewegt bis auf den Seelengrund.
Die Tür öffnete sich und ein kleiner, um ein Geringes schief gewachsener Mann erschien, starrte ihn ausforschend an, fragte mit kalter Stimme, was er wolle. „Ich bin das!“, sagte Fritz.
„Bin ja nicht blind!“, entgegnete der andere. Möglicherweise hatte er mehr als nur ein Foto von ihm gesehen und ihn trotz des ihm ins Gesicht geschriebenen Elends erkannt.
„Wer ist denn da?“, fragte ihre Stimme.
„Besuch aus Waldheim!“ antwortete Fritz.
„Aus Wald...“, ihre Stimme brach zusammen.
Fritz horchte und lauschte, ob Inge wenigstens einen Zipfel von sich sehen lässt. Sekundenlang war nichts als Schweigen in diesem Grau des Hintergrundes. Des fremden Menschen kantiges Gesicht zuckte. Es schien, er genoss seine Überlegenheit, ehe er das kurze Gespräch beendete, indem er sagte: „Du siehst ja, der eine, der hier Platz hat, bin ich!“
Fritz Biederstaedt konnte sich nicht wenden. Wie oft hatte er den Angstschrei Inges gehört, nachts wenn er sich auf dem Fußboden umherwälzte, jedesmal wenn jemand das Kommando „Jetzt“ gab, weil sie so dicht nebeneinander schliefen, dass ein Einzelner kaum fähig gewesen wäre, seine Schlafhaltung unabhängig von seinen Leidensgenossen zu verändern. „Jetzt weißt du es! Jetzt!“ Das Kommando hatte Gewalt über ihn. Er drehte sich herum, wollte gehen, befahl sich das auch.
In Wahrheit lauschte Fritz Biederstaedt hinter sich. Sie war doch da. Könnte sie ihm nicht einen einzigen Augenblick schenken? „Bist du diesem Kerl hörig?“, fragte er sich wütend und gleich darauf wieder matt.
Er schlurfte die Külzstraße hinunter, vor sich hinmurmelnd und sich selbst wüst beschimpfend: „Was hast du dir eingebildet?“
Sollte sie zehn Jahre warten, bloß um es einfach fortzusetzen, das Hundeleben, wie es bisher in den vergangenen zwanzig Jahren gewesen war? Drei Abende von sieben hast du in der Kneipe gehockt und weitere drei auf der Fischerinsel verbracht. Wolltest du sie glauben machen, das Vagabundieren sei vorbei? Nichts ist vorbei, bloß weil du dir das versprichst. Die Vergangenheit hängt dir an, wie die Wurzel dem Baum.
Sie hat die Verbindung, mit einem scharfen Schnitt, ein für allemal beendet. Aus, mein Lieber, es ist ausgeträumt. Den Lebenskampf gewinnt nur, wer klar sieht.
Die Nacht verbrachte er in der Bahnhofsmission. Wen hätte er sonst noch mit seiner Anwesenheit belästigen sollen?
Fritz wagte es, am nächsten Tag, bescheiden und mit allem Mut, den er zusammenraffen musste, bei seinen ehemaligen Fischerkollegen anzuklopfen, vorgewarnt durch den Hufnagler G. Er hatte keine Wahl. Wohin sonst sollte er gehen? Auch sie waren umgezogen, zweihundert Meter den Oberbach hinauf. Sie hatten sich inzwischen eine schon einmal benutzte Baracke gekauft. Der Pommernflüchtling Fritz Milster, mit neuer grüner Jägerjoppe und mit neuem grünen Rucksack, gerade im Begriff, nach Hause zu gehen, weshalb er zufällig die breite Eingangstür des Holschuppens öffnete, schaute ihn erschrocken an. „ Fritz?“
Fritz nickte. Er wusste, wie sehr er sich verändert hatte. Dem Alten schien das Herz zu stocken. Offensichtlich war er sekundendenlang unsicher was er tun oder was er besser lassen sollte. „Kumm doch rinner!“ ("Komm doch herein!"), lud er Biederstaedt ein. So plötzlich einem Abgeschriebenen gegenüber zu stehen, war nicht leicht. Viel Gutes hatten sie ihm nicht nachgesagt. Der Name Fritz Biederstaedt stand für einen Mann, der sich stets das größere Stückchen vom kleinen Kuchen abgeschnitten und der sich immer mehr und besser vorgekommen war als die übrige Menschheit. Das war eben das Sonderbare. Ein gewisser Menschentyp fiel immer wieder auf die Beine, hatte einfach Glück. Während die einen im Dreck der Schützengräben verbluteten, spielten andere jahrelang den Hahn im Korbe. Die einen inmitten von endlosen Flüchtlingstrecks in tausend schmerzvollen Irrungen und Wirrungen, geplagt von Frost und Schneegestöber, bedroht von unberechenbaren Raketen und Granaten aus der Luft und vom Lande, die anderen indessen schauten bloß neugierig zu. Sie hatten sich allezeit in der sicheren Heimat in weichen, weißen Betten geräkelt. All zu vieles sei ihm in jenen wenigen Augenblicken des ersten Wiedersehens mit Biederstaedt durch den Kopf geschossen, erzählte später der stets ausgeglichene Milster.
Milster öffnete die zweite Tür. Biederstaedt wurden die Knie weich. Was werden sie ihm sagen? Wie wird Egon sich verhalten, wie Neumann? Da saßen sie. Sie drehten nach ihm die Köpfe. Es schien, jemand hatte die Zeit angehalten. Lauter Augen. Lauter Nein. Biederstaedt riss sich zusammen. Gewollt herzlich grüßte er sie. „Schönen Dach uk alltohop!“("Schön guten Tag alle zusammen!") Wie immer klang es, als hätte er bloß verschlafen. Ihm sausten die Ohren. Den Schnaps auf dem Tisch sah er. Die beiden bunten Flaschen, die geleerten Gläser. Ihn wunderte, dass es immer noch dieselben Gläser waren.
Dieselben! Als unangemessen empfand er es. Gegen das Gesetz des steten Wandels. Immer noch auch derselbe Tisch, dieselben Männer. Hatte nur er sich völlig geändert? Egon sah er nicht. War das ein gutes Zeichen?
Auch der asthmatische Netzmacher Müller schaute Fritz offen, neugierig und kühl an. Deutlicher als früher erkannte Biederstaedt das Harte in den Zügen seiner Männer. Er kam ihnen sicherlich wie ein Gespenst vor. Unwillkürlich hörte Fritz sich, wie er in früheren Tagen mit ihnen geredet hatte: „Los Lued! Wi trecken noch einen Toch!“ ("Los Leute, ziehen wir noch einen Fischzug!")
In diesem Augenblick musste er vor sich selber zugeben, dass er manchmal die Macht wie eine Peitsche gebraucht und dabei irrigerweise geglaubt hatte, er bliebe trotz alledem für immer „ihr Fritz“. Ihm wurden die Knie weich. Ihre Mienen brachten vor allem die eine Frage und Aussage zum Ausdruck: „Was willst du hier? Wir haben dich nicht gerufen!”
Egal welche Maske er sich überstülpte, er war nicht „ihr Fritz“. Das erste Staunen Milsters war es, nur vermehrfacht. Dass er sich hier hereintraute, fanden sie unerhört. Einhellig standen sie für ihre Überzeugung ein, dass sie ihm nicht gestatten würden, jemals wieder Einfluss über sie zu gewinnen. Fritz wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte, um ihre Herzen zu erweichen. Er spürte, wie sich die Frosthand um sein Herz spannte. Für sie war er tot, gleichgültig, dass sie einmal gehört hatten, er habe seiner Frau geschrieben. Möglicherweise war das ein Brief aus dem Jenseits gewesen, ein unglaubwürdiges Gerücht. Sie hatten ihn vergessen wollen. Der alte Fritz Biederstaedt lag für sie unter dem Rasen.
Der dürre Netzmacher Müller, der früher immer zu ihm gehalten hatte, kämpfte laut atmend seine Erregung nieder, brachte jedoch auch nicht viel mehr heraus als nur ein dürftiges „Na, Fritz wieder unter den Lebenden?“ Auch ihm musste überdeutlich vor Augen stehen, wer dieser Fritz Biederstaedt gewesen war. Kurt Willig, wenn er anwesend gewesen wäre, hätte ihm bestimmt Platz angeboten.
Nein! Wir sind ausgebucht. Noch einen Fresser ernährt die kleine Fischerei nicht. Das logen sie ihm vor? Ihm wurden die Augen feucht, ihm schien, er hätte diese Begründung schon zehnmal vorher gehört. Wortlos drehte er sich um. Hob die Hand wie früher grüßend. Er befahl sich die Beine fest aufzusetzen, auch die andere Tür nicht ins Schloss zu schmettern. In seinem Schädel drehte sich rasend schnell ein Riesenrad zu durcheinander dröhnender Rummelmusik. Fritz schlich mehr, als er schritt, den Weg an den vom Herbstwind bewegten Pyramidenpappeln entlang, zur Schillerstraße. Milster kam mit lang ausgreifenden Schritten hinter ihm her. „Jo! Wat moken wi mit di?“ ("Ja, was machen wir mit dir?"), fragte er pustend, denn er war nicht mehr der Jüngste. Es tröstete Biederstaedt nicht, dass der Alte Mitleid zeigte. Fritz biss in die vorgewölbten Lippen und strich mit dem Daumen, wie er das seit je tat, wenn er aufgeregt war, über den kräftigen Bartansatz. Bitte kein Mitleid! Das wäre ja wohl das Letzte.
Es sei alles gesagt worden. Seine Kollegen waren freie Männer geworden und zumindest einige von ihnen füllten diesen Anspruch auch aus, wie es schien. Sie wünschten ihn nicht als zusätzliche Bürde am Halse zu haben. In Waldheim hatten sie ihm versichert, sein ehemaliger Betrieb sei verpflichtet, ihn wieder einzustellen. Aber sollte er die Männer mit einem Dokument zum Nachgeben zwingen? Das würde er nie und nimmer tun. Lieber ginge er Steine karren oder weit weg.
Wie hatte Mildener es formuliert? Menschen wie er könnten sich nicht ändern. Lasst ihn bloß noch einmal hochkommen, dann walzt er wieder über den Hof wie ein Gutsbesitzer, der die Peitsche gegen die Lackstiefel klopft.
Stets hätte er dem Alten zu ihrem Nachteil zu Munde geredet. Wie gezielte Fausthiebe hatten ihn diese ungehobelten Behauptungen als endgültige Ablehnung getroffen. Wie ein Stück Franzosenkraut nach einer Frostnacht war er erstarrt. Verfärbt und lasch hatte er dagestanden in der Baracke, die trotz ihrer Armseligkeit der Ausdruck ihrer Unabhängigkeit war.
Das alles durchlebte er ein zweites Mal, während der wenigen Minuten, in denen der ruhige Milster neben ihm herging.
Unter diesen Umständen durfte er auch nicht dessen freundlich gemeinte Einladung zur Übernachtung annehmen. Ihm zu Dank irgendwelcher Art verpflichtet sein müssen, wollte er nicht. Auch das Andere nicht! Aus Händen seiner ehemaligen Kollegen ein Gnadengeschenk entgegennehmen?
Nein! Dreiundzwanzig wechselvolle, zumeist gute Arbeitsjahre lagen hinter ihm. Für immer. Mein Gott, wie schön war es gewesen!
Mit betäubten Schmerzgefühlen saß Fritz die Nacht über vor einem schon mehrmals geleerten Bierglas im Wartesaal seiner Heimatstadt. Sie hatten ihn ausgespieen wie ein Fisch ein wertloses Sandkorn. Rings um ihn herum saßen in dieser langen Nacht graue, fremde Menschen, die aneinander nicht interessiert sein konnten. Zwischen seinen Beinen eingeklemmt, stand der kleine, schäbige Holzkoffer, indem sich alles befand, was er noch besaß. Draußen pfiffen in Abständen die Lokomotiven. Ihr Tosen drang tief in sein Gemüt ein. Die schwarzen Eisenkolosse riefen ihm mehr als einmal zu: Komm mit! Was zögerst du? Für dich sind Neubrandenburg, deine Frau, dein schöner See und deine Zukunft verloren.
Zehn lange Stunden hatte er sich gegen die Endgültigkeit dieser Einsicht gestemmt. Aber wohin nur, dachte er verzweifelt? Wo willst du neu anfangen? Hast nichts, bist nichts, kannst nichts.
Gegen fünf Uhr früh stieß ein Besen gegen seinen Koffer, dann gegen sein Bein. Eine dunkel gekleidete Frau schaute ihn an. Sie reinigte das graue Parkett. Sie lächelte entschuldigend. Ein flüchtiger Blick nur. Ein abgehärmtes Gesicht mit sanftem Ausdruck, noch jung. Er sah diese unendlich trostlose Miene. Du auch, dachte er, mitfühlend. Er versuchte zu lächeln und spürte doch, dass auch seine Züge eingefroren waren. Fritz sah die kleine Strähne hellblonden Haares unter ihrem Kopftuch. Da schaute die Frau ihn noch einmal an und gab ihm einen längeren Blick.
Vielleicht lag in ihm nur eine Spur dessen, was er seit Jahren ersehnt und seither nicht mehr gesehen hatte.
Draußen raste ein Güterzug über die stählernen Schienen, laut auf die Stöße schlagend, hart wie die Schläge, die sein Kopf in den Sowjetlagern von Sadisten hatte hinnehmen müssen. „Dass du es nicht ausplauderst!“ Ratsch, batsch, flogen die Fäuste an den Schädel. „ Dass du dich erinnerst, dass wir da sind!“ Ratsch, batsch!
Aus dem schwarzen Schlund der Loks drangen gellende Schreie, die jede menschliche Seele erschauern ließen.
Dass die Frau in ihrer unansehnlichen Kleidung aber immer noch dastand und ihn mit diesen großen Augen anleuchtete, spürte Fritz wie eine wunderbare Wohltat. Es umfing ihn wie ein Sonnenstrahl, der sogar den tristen dunklen Herbstmorgen durchdrang. Sie ging wieder ihrer Arbeit nach. Doch die erste, wenn auch wortlose Freundlichkeit seit Jahren, die er für die Länge eines Atemzuges
erhalten hatte, war als wunderbares Geschenk zu ihm gekommen. Für ein paar unglaublich erfüllte Sekunden wusste er, dass er noch einmal glücklich sein würde. Blinzelnd rieb sich der vierundvierzigjährige Biederstaedt den Schlaf aus den Augen.
Mädchen, du bist mir vom Himmel geschickt worden. Ich bin noch lange nicht am Ende angelangt. Noch bin ich nicht am Boden zerstört. Ich werde noch gute Tage sehen. Noch habe ich Mut zu kämpfen. Zum ersten Mal seit langem dachte er Gutes. Das hatte sie bewirkt. Dass es das noch gibt! wunderte er sich. Seine Blicke umfassten sie. Er schaute sich nicht satt. Ihre Hüften, ihren Kopf berührte er in Gedanken. Unter ihrem Wolltuch war, wie er sich vorstellte, volles blondes Haar. Als Wunder der ersten Schöpfung betrachtete er sie, ließ sie nicht mehr aus den Augen, hängte sich an sie. Es war wie ein sich glücklich ankündigender Sonnenaufgang nach einer kalten Sturm- und Regennacht.
Eine Woche später, die sie ihm versüsst hatte, begegnete er auf der Straße dem Netzmacher Hermann Müller.
„Fritz! Um Gottes Willen! Ich habe mir deinetwegen die größten Sorgen gemacht. Es war unverantwortlich, was sie dir an den Kopf geworfen haben. Komm wieder zurück. Kurt Willig und Milster haben sich für dich eingesetzt und ich auch. Sie werden dich nicht umarmen, aber dein Platz ist an unserer Seite!“ Hermann zerrte einen roten Ball aus der Jacketttasche, knautschte ihn und sprühte den Balsam in seinen Mund. Dann fuhr er fort zu lösen, was ihm auf dem Gewissen lastete.
Es sei unverantwortlich gewesen. „Aber du kennst sie ja, wenn sie sich geärgert haben.“ Sie hätten nie gelernt, sich zu beherrschen. „Es geht bei ihnen nicht durch die Siebe. Was sie denken, sagen sie, unbereinigt.“ Keuchend stand der Asthmatiker vor ihm, klein und unscheinbar. Fritz Biederstaedt hätte den Alten umarmen können. „Danke Hermann. Ich komme!“ Das konnte er sich lebhaft vorstellen, wie der Zwerg die Hünen zusammengestaucht hatte: „Schämt ihr euch gar nicht? Alles im Leben, das man aussendet, kommt doppelt zurück auf den eigenen Kopf.“
Neue Zeiten, neue Gesichter
Einen neuen Anfang musste auch der spätere Tollense-Fischer Hermann Witte machen.
Der zweiunddreißigjährige Woldegker hatte glücklich den Krieg überlebt, kam in dieser Herbstnacht, des Gründungsjahres der DDR, vom Nachtfischen, war erschöpft, müde und hungrig. Der Fang war mager gewesen, die Klaulust seiner Helfer beträchtlich. Aber Hermann genoss es, wieder ein freier Mann zu sein. Niemand jagte ihn mehr ins Feuer dieser sinnlosen Schlachten auf Russlands Weiten. Gekrümmt wie er jahrelang in den Schützengräben gestanden hatte, blies er in die dürftigen Flammen des alten Küchenherdes die sein ohnehin rotes Gesicht gespenstisch aufleuchten ließen. Barfuß und bartstoppelig ging er. Sein rundliches Gesicht war faltenlos. Er trug ein verschlissenes Unterhemd sowie eine löchrige Hose und hauste ebenso erbärmlich. Ein paar Pellkartoffeln und ein wenig Speck brutzelten in seiner steinalten Pfanne. Es mochte zwei Uhr morgens sein, als in dem alten Wohnhaus die Dielen zu knarren begannen und plötzlich ein gigantisch wirkender Fremder eintrat. Im Schein der 25-Watt-Lampe, die lose von der grauen Decke herunterbaumelte, betrachteten sie einander. “Wecker büst du denn?”("Wer bist du denn?"), fragte Hermann den riesigen Menschen, der breitbeinig auf ihn zukam. Der Hüne trug ein Körbchen mit schön gewölbten Hühnereiern. Er stellte es auf die Bank, zog die Mundwinkel nach oben und fragte: „Is dat de grötzte Pann? Ilses Fründ bün ick! Möt mi ierst werer stärken!“ ("Ist das die größte Pfanne? Ich bin Ilses Freund! Muss mich erst wieder stärken.") Hermann grinste: „Na, denn man tau!“ und meinte spöttisch, dass die Pfanne die da am Küchenbord hing, wohl ausreichen würde.
Der Sonderbare entnahm Ilses Schrank, den er also bereits kannte, eine beachtliche Speckseite und mit einem Seitenblick auf den Nachtfischer säbelte er ein Stück von der Größe eines Lutherischen Gesangbuches ab, schnitt alles sehr gekonnt in Streifen und legte sie in die Großfamilienpfanne.
Seelenruhig schlug er sämtliche Eier auf. Hermann gingen die Augen über. 17 Stück! „De reken vör uns beid! Ick bün Karl“, ("Die reichen für uns beide. Ich bin Karl!") sagte der Koloss, „de Söhn vun den ollen Degelow, den Schlachter!“ ("Der Sohn des alten Degelow, des Schlächters.")
Nun erst reichte er Hermann die Hand, wobei dessen Bewunderung vor dem Eindringling permanent wuchs. Der Fischer bemerkte nur: „Dorher weicht de Wünd.” ("Daher weht der Wind.") Daher also der plötzliche Überfluss an Nahrungsmitteln.
An Stelle eines Tisches standen in Hermanns Stube zwei Fischkisten hochkant und obendrauf lag eine kippelnde Holzplatte, Platz genug für beide Pfannen, die schließlich zugleich die Teller ersetzten. Karl hockte sich in Ermangelung eines Stuhles, ebenfalls auf eine der Kisten, die zwar ächzte, aber nicht zerbrach.
„Wo wierst du?“ ("Wo warst du - im Krieg?")
„Bi Woronesh un Kursk!“
„Kiek mol an. Dor wier ick uk!“ ("Sieh mal an, da war ich auch.") Sie erzählten einander nicht, was sie an Grauenvollem erlebt und durchgemacht hatten.
| Millionen hatten wie Karl und er das Elend gesehen, dass Deutsche verursacht hatten. Das namenlose Leid. |
 Hermann hing wohl seinen Gedanken nach. Soldat und Infanterist wider Willen, wurde er im Raum Woronesh einmal zu einem Spähunternehmen ausgeschickt. Bis dahin hatte er in den vielen Monaten des Männermordens immer wieder Glück gehabt. Stets flogen die Projektile vorbei an ihm, krachten die Granaten der feindlichen Artillerie weit genug von ihm entfernt in den russischen Ackerboden hinein, und selbst wenn seine Einheit unter eigenen Beschuss geriet, traf es stets die anderen. In jener Nacht jedoch wollte das Glück endgültig von seiner Seite weichen. Sein Spähtruppführer befahl ihm, in ein verdächtiges Gebäude einzudringen und zu erkunden wie die Lage ist. Es handelte sich um eins der wenigen, größeren steinernen Häuser, das scheinbar verlassen in der weiten Ebene lag, gedeckt nur durch zwei Bäume. Hermann, die Maschinenpistole schussbereit, betrat mutterseelenallein das Gehöft, dann vorsichtig das Haus. Leise wie eine Katze schlich er vorwärts. Unversehens befand er sich in einem Raum, inmitten von vielleicht zwei Dutzend schnarchenden Russen. Er wagte kaum zu atmen. Nur raus hier. Nur einer brauchte hochzuschrecken und dann war es aus. Beim Verlassen des Raumes zwei Handgranaten zu schärfen und sie verteilt hinlegen? Niemals! Als Gefreiter Hermann Witte sich leise über die letzte Tür zurückzog, bewegte ihn zum ersten Mal unabweislich die Erkenntnis, dass er zwar ungewollt in unentschuldbare Verbrechen verwickelt worden war, aber dass er sehr wohl noch immer selbst entschied, ob er zum Mörder würde oder nicht.
Hermann hing wohl seinen Gedanken nach. Soldat und Infanterist wider Willen, wurde er im Raum Woronesh einmal zu einem Spähunternehmen ausgeschickt. Bis dahin hatte er in den vielen Monaten des Männermordens immer wieder Glück gehabt. Stets flogen die Projektile vorbei an ihm, krachten die Granaten der feindlichen Artillerie weit genug von ihm entfernt in den russischen Ackerboden hinein, und selbst wenn seine Einheit unter eigenen Beschuss geriet, traf es stets die anderen. In jener Nacht jedoch wollte das Glück endgültig von seiner Seite weichen. Sein Spähtruppführer befahl ihm, in ein verdächtiges Gebäude einzudringen und zu erkunden wie die Lage ist. Es handelte sich um eins der wenigen, größeren steinernen Häuser, das scheinbar verlassen in der weiten Ebene lag, gedeckt nur durch zwei Bäume. Hermann, die Maschinenpistole schussbereit, betrat mutterseelenallein das Gehöft, dann vorsichtig das Haus. Leise wie eine Katze schlich er vorwärts. Unversehens befand er sich in einem Raum, inmitten von vielleicht zwei Dutzend schnarchenden Russen. Er wagte kaum zu atmen. Nur raus hier. Nur einer brauchte hochzuschrecken und dann war es aus. Beim Verlassen des Raumes zwei Handgranaten zu schärfen und sie verteilt hinlegen? Niemals! Als Gefreiter Hermann Witte sich leise über die letzte Tür zurückzog, bewegte ihn zum ersten Mal unabweislich die Erkenntnis, dass er zwar ungewollt in unentschuldbare Verbrechen verwickelt worden war, aber dass er sehr wohl noch immer selbst entschied, ob er zum Mörder würde oder nicht. |
| Bild Wikipedia Tischlergeselle und nun Staatspräsident der DDR (GDR) Wilhelm Pieck (1876-1960) ein moderater Kommunstenführer |
Sein Alter sei durch Wilhelm Pieck, den jetzigen Staatspräsidenten, dazu gekommen, in den zwanziger Jahre, in denen sie zusammen ‚auf der Walze’ gewesen wären.
Anderntags sah Karl Degelow seinen neuen Freund Hermann Witte das Fahrrad schieben. Das war auf halbem Wege zwischen Woldegk und dem uckermärkischen Strasburg.
Als Fleischergesellen hatten sie in Carlslust zu tun. Neben Hermann ging eine etwa gleichalte Frau mit einem langen grünen Rock und in einer ein wenig ausgeblichenen rötlich schimmernden Strickjacke. Er lenkte das Rad. Sie hatte offensichtlich die Aufgabe, die beachtliche Fuhre im Gleichgewicht zu halten. Denn auf dem ungewöhnlich breiten Gepäckträger wankten zwei graue, hohe Holzkästen, in denen sich die Aalschnüre befinden mussten. An den Seiten des Fahrrades befestigt hingen ein Paar stabile Ruder, Kescher und Setzbunge. Darin lagen eine Kahnschaufel, ihre Gummistiefel und die metallnen Ruderdollen. Sie benutzten den linken Straßenrand, schritten schnell aus und sahen nur ihre Ladung sowie den staubigen Weg unmittelbar vor sich. Fischer Hermann schimpfte hörbar mit seiner anscheinend neuen Freundin, sie möge gefälligst aufpassen. Wenn ihnen die Kisten durcheinander stürzten, verhedderten sich die Schnüre. Unvorstellbar für sie, wie wütend er dann werden könnte. Das noch eine gute Wegstunde entfernte Strasburg konnte nicht ihr Zielort sein, denn dort wirtschaftete ein anderer Binnenfischer. Karl Degelow wusste das. Beide mussten zum noch zwölf Kilometer entfernten, nicht gerade großen, aber hochproduktiven Schönhausener See marschieren um Aalschnüre zu legen. Da würden sie anschließend in einer Strohmiete kampieren, dann noch vor Sonnenaufgang die Schnur heben, die gefangenen Fische einsacken und sich auf dieselbe Weise auf den langen Rückweg machen, zusätzlich beladen und bereichert um hoffentlich weitere zwanzig Kilogramm Fischlast. Verkaufen durfte Witte die Menge vor Ort allerdings nicht, weil die wertvollen Fische an Fahrer der Fischauslieferungslager gegen Bescheinigung abzuliefern waren. Nur so konnte er den Nachweis führen, dass er ernsthaft bemüht war, sein ihm vom Staat zugeteiltes Auflagesoll zu erfüllen. Obwohl Hermann raubeinig mit ihr umging, muss seine Freundin Gefallen an ihm gefunden haben. Sie teilte bald alles, was sie besaß mit ihm, auch die Hoffnung auf bessere Tage.
Er trug glatte, fest nach hinten gekämmte strohblonde Haare. Ob er getrunken hatte oder nicht, stets wankte er im Wiegeschritt. Damals lief er in mehrfach geflickten, wadenhohen Gummistiefeln. Die Stiefel schwarz, die Gummiflickstücke rot. Seine Bluse war von Art und Farbe der Schlosserjacken. Fast nie überlegte er, was er sagte. Hermann Witte mochte in seiner Kleinstadtschule nur wenig gelernt haben, für dumm verkaufen ließ er sich nicht. Einem Werber, der ihm die Parteimitgliedschaft und damit einen leichteren Weg für seinen Ausstieg aus dem Elend anbot, sagte er es auf den Kopf zu: „Ji SEDisten spannen uns alltohop för jugen Plog.” ("Ihr SEDisten - Sozialkommunisten, Mitglieder der Vereinigungspartei von Sozialdemokraten und Kommunisten - wollt uns uns alle zusammen nur vor euren Pflug spannen.")
So sei das auch mit der Blockpolitik. Ob sie in der CDU waren oder sich Liberale nannten, Bauernparteiler oder Nationaldemokraten, nur was die SED ihnen gestattete, durften sie propagieren und tun. Durch ihren Trick, die Bürger des Landes “offen” wählen zu lassen, verhinderte die SED seit der Herbst–‚wahl’ 1949 jede Form von Opposition. Ihre kaum zu widerlegende Propagandaparole lautete: „Wer für den Frieden ist, der darf das offen bekennen!”
Wer also in die Wahlkabine ging hatte sich für den Krieg entschieden. Das galt für alle Menschen die im Herrschaftsbereich der Kommunisten lebten. Daher stammten die obendrein gefälschten 98 Prozent pro- Stalinismus"wähler".
Diese Wahl war die erste, an der auch ich, Gerd, teilnahm. Damals lebte ich noch in Prenzlau. Noch trug ich mich nicht mit der Absicht Fischer werden zu wollen. Aber für einen Jüngling von meinem Naturell, sollte sich dieser Beruf bald als der bestgeeignete erweisen. „Unser“ Wahllokal befand sich in einem Haus "an der Schnelle". Vor mir standen ungefähr dreißig Jungoffiziere der kasernierten Volkspolizei mit ihren Mädchen. Hinter mir setzten etwa noch einmal so viele Uniformierte ebenfalls mit ihren hübschen Begleiterinnen die Menschenkette fort. Für sie war es selbstverständlich, sich für diesen Staat auszusprechen, denn er bezahlte sie gut.
Ich verdiente als Baumschulisten-Lehrling fünfzig Mark monatlich, meine Altersgenossen erhielten für blankes Nichtstun, fast das fünfzehnfache. Dafür allerdings unterlagen sie dem Trommelfeuer der Kremlpropaganda, die nur ein Ziel kannte: die Eroberung der Welt.
Wenigstens einer dieser Nichtstuer lockte mich, es ihm gleich zu tun -Versuchung war es nicht.
 |
| Poster: Genosse Lenin reinigt die Welt |
In den ehemaligen Prenzlauer Artilleriekasernen in der Alsenstraße wohnten sie umsonst. Sie waren satt, ich aber hungerte nach der Freiheit.
Vielleicht hätte ich gewollt, was ich tun sollte, nämlich die unter SED-Führung agierende Nationale Front wählen. Doch da ich nicht die Freiheit genoss, mich auch anders zu entscheiden, fühlte ich diesen Mangel als großen, schmerzhaften Verlust und wünschte deshalb gegen diese politische Clique zu stimmen.
Mir schien, dass tausende Augen mich böse betrachteten: Würdest du Zwerg es wagen, den Krieg zu wählen? Mit bitterem Empfinden nahm ich die mit den mir unbekannten Namen bedruckten Papierblätter - genannt: Wahlzettel - entgegen und kniffte sie unter den Blicken der Öffentlichkeit. Ärgerlich steckte ich sie gegen meine Überzeugung durch die Schlitze von zwei Kästen auf denen das Wort ‚Wahlurne’ geschrieben stand.
So waren die "Volkswahlen". Wo immer sowjetrussisches Militär stand, dort ging man im Gleichschritt. Das Schrittmaß zu ändern oder gar auszuscheren lag im Bereich des Möglichen, allerdings mit bösen Konsequenzen. Wem das nicht klar wurde, der muss verrückt gewesen sein. Mit den Komunisten herrschte die politische Lüge im Verbund mit psychischem Druck, eben jene Unmoral die in langen Vergangenheiten wiederholt ganze Zivilisationen zerstört hatte.
Im Juni 1950 brach in Fernost der Koreakrieg aus. Ich war ebenfalls der Ostpropaganda ausgesetzt und gab den USA zumindest eine Teilschuld. Bis ich an den Fensterfronten der erwähnten Artilleriekasernen, Prenzlaus, Alsenstraße 1 die riesigen, roten, weiß beschrifteten Spruchbänder las: "Wir erklären uns solidarisch mit unseren Koreanischen Genossen!" Und dann, Wochen später zeigten sie uns angebliche Beutefilme die belegen sollten, dass die verfluchten Amis angefangen haben. Da war es ganz und gar offensichtlich wer hier wen irreführte. Dass der Agressor USA am ersten Kriegtag um 60 km zurückgeschlagen wird, konnte nur glauben, wer das unbedingt wollte.
Einige Monate später machte mich die damalige stellvertretende Bezirksärztin Frau Dr. Edith Ackermann aufmerksam: “Wenn sie wissen wollen, wie es in unserem Lande politisch weitergehen wird, dann lesen sie Stalins Buch. Geschichte der KPdSU (B), Kleiner Lehrgang.“
Es ist ein Irrtum, anzunehmen, irgendjemand, außer dem höchsten Kremlherrn, hätte nennenswert ändernden Einfluss auf den Verlauf der Ereignisse in den von ihm kontrollierten Ländern nehmen können. Nicht einmal ein Mann wie der hart gesottene Generalsekretär der mehr denn je kommunistisch orientierten Partei, Walter Ulbricht, hätte etwas zwingend Erforderliches bewirken können, wie etwa die Gewährleistung der Unantastbarkeit der Menschenwürde. Und wenn er es noch sehr gewollt hätte. Wer sich gegen den Kopf des Unternehmens Kommunismus aussprach, wurde, wenn er Glück hatte nicht nur bedroht, sondern als Volksfeind beschimpft eingesperrt, wer dagegen kämpfte, riskierte sein Leben. Echte Privatinitiativen und divergierende Meinungen wurden nicht geduldet. Wie Eisen durch eine Biegemaschine wurden wir geformt und beschnitten. So hast du zu sein und nicht anders, so zu denken und so zu reden und zu handeln ist deine eiserne Pflicht.
Weil das Sein angeblich das Bewusstsein bestimmt, sollte ein radikal geändertes gesellschaftliches Sein das gesellschaftliche Bewusstsein entscheidend umprägen. Menschen müssen erzogen werden. Niemand darf üppig auf Kosten anderer wuchern. An diesen beiden Grundsätzen wollte ich ja gar nicht rütteln.
Aber, wenn Menschenlenkung durch Zwang erfolgt, dann muss gefragt werden, was das für Wesen sind, die andere, wie Hunde, an eine Kette legen.
Mich tröstete gar nicht, dass die "Christen" des vierten Jahrhunderts genau so gehandelt haben, allen voran der fromme Ambrosius von Mailand, der ein extremer Antisemit war, der prahlte er habe die Synagoge zu Kallinikum in Brand gesteckt, der die Kaiser in seinen Predigten attackierte, weil die sich seiner Überzeugung nach zu tolerant gegenüber denen verhielten, die er hasste.
Hunderttausende‚ von der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ‚befreite’ Männer und Frauen, selbst bodenständige Bauern, verließen, nach der Staatsgründung der DDR, ihre trostlos grau gewordene Heimat, um in den ‚goldenen’ Westen zu fliehen.
Am liebsten wäre auch ich davon gegangen, aber meine Eltern wären traurig gewesen…, doch auch das Wasser und die kaum vergleichliche Schönheit des Tollensesees zogen mich magisch an, fast zum Ausgleich für die Lockungen die von der aufblühenden Bundesrepublik Deutschland ausgingen. Jeden Tag breitete sich beides, der blaue, tiefe See und seine Hügellandschaft zu meinen Füßen aus, denn ich verdiente damals mein bisschen Geld in der Obstplantage Tollenseheim und diese lag an einem der großen Hänge im Südosten des Tollensesees, der sich mir Tag für Tag als herrliches Panorama darbot.
Sehnsüchtig schaute ich stets den Fischern hinterher, wenn ihr Kutter sie bis an die Grenze meines Arbeitsgebietes brachte und neidete ihnen das Glück erfolgreiche Fänger zu sein.
Ich hoffte, eines Tages Fischer werden zu dürfen. Zumal ich schon als Kind vom Wasser angezogen wurde.
Deutlich erinnere ich mich dieses Augusttages 1943. Zumindest wurde damals meine Illusion geboren, ein Leben zwischen Himmel und Erde, auf dem Wasser, sei das Schönste. Ich saß auf der Ducht des Segelbootes unseres Nachbarn, des Wolgaster Sattlermeisters Janzen. Geräuschlos und leicht wie Wasserläufer glitten wir über die leicht aufgeraute Haut des Peenestromes. Korngelb bauschte sich das Großsegel über mir. Darüber wölbte sich der friedliche blaue Himmel.
Fünf Stunden später - in dieser Nacht vom 17. zum 18. August 1943 - heulten die Sirenen. Ich schrak hoch. Der durch Mark und Bein schneidende Ton forderte von uns herrisch, sofort aufzustehen und den Luftschutzkeller aufzusuchen. Aber wie oft schon riss uns dieses himmelschreiende Tosen aus dem Schlaf und dann war nichts passiert. Wie immer flogen die feindlichen Bomber nur über unsere Köpfe hinweg. Wir wussten schon, die Flugzeugverbände zogen in Richtung Stettin.
Nichts wussten wir. Aber ich sollte lernen, auch die Stille zu lieben.
Mitten in meine Träume hinein dröhnten die Detonationen. Anschläge auf mein Leben. Bis zu dieser Schrecksekunde ahnte ich nicht, wie kostbar mir mein Leben war. Andere starben. Das war natürlich. Aber, doch ich nicht. Wir hasteten, Hemd, Hose, Kleider fassend, in den Keller. Direkt neben uns explodierten die Luftminen.
600 Flugzeuge der Typen Lancaster und Halifax hatten Peenemünde bombardiert. Der größte Luftangriff in der Weltgeschichte bis dahin. Die Engländer hatten entdeckt, dass Hitler hier Langstreckenraketen bauen ließ. Eine einfache britische Schneiderin, beschäftigt als Soldatin der Air Force, deutete die Linien auf dem Aufklärungsfoto richtig. “Das sind Abschussrampen!” Entschlossen, einen noch nicht ganz ausgewachsenen Feuer speienden Drachen in zahllose Stücke zu zerfetzen, flogen die Briten diesen Einsatz. Wir beklommenen und neugierigen Herumstromer fanden im Tannenkamp zertrümmerte Flugzeugteile und schaudernd hörten wir von verbrannten, auf Minimaß geschrumpften Piloten.
 |
| Bild Wikipedia. Der Start einer V-2 Rakete in Peenemünde, 1943 |
 |
| Bild Wikipedia: Peenemünde liegt oben rechts unterhalb der Insel Rügen |
Obwohl sich noch keine Tür in diesen Lebensbereich öffnen ließ, sollte ich dennoch bald innigste Bekanntschaft mit dem Wasser des Tollensesees machen.
Damals, in den Jahren ’54 bis ’55, musste ich leider noch auf dem festen Land, hoffnungslos überforderter Betreiber der Obstplantage Tollenseheim bleiben.
Da trat an einem Dezemberabend des Jahres 1955 etwas Unvorhersehbares ein.
Überraschenderweise war eine große Ladung Sport- und Ruderboote auf ‚Tollenseheim’ angekommen. Mir schien, dass da ein Irrtum vorliegen musste. Hausmeister Paul schob mich beiseite. Der Fahrer nickte nur. Nein, die Papiere besagten eindeutig: Auslieferung an die Bezirks-LPG Schule, Tollenseheim, bei Neubrandenburg.
Wir kratzten uns die Köpfe und zuckten die Achseln.
Paul Schmidt und ich waren Menschen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Er, einsachtundachtzig, extrovertiert und athletisch gebaut, ich, einsfünfundsechzig, introvertiert, war schmal wie ein indischer Hungerkünstler. Ich liebte es zu meditieren, Paul war lebensprühender Akteur. Ich liebte meinen kleinen Sohn, er seinen Hund. Aber über den Wellenbinder, den wir als erstes auf dem großen LKW entdeckten, wunderten wir uns gemeinsam.
Paul begab sich ins Haus um Herrn Herbert M., den Chef, zu informieren. Ich fragte mich in der Zwischenzeit, ob unsere noch kleine LPG-Schule sich ein Boot leisten konnte, das schätzungsweise dreißigtausend Mark kostete, sowie weiterhin Wassersportgeräte mit einem Wert von zusammen vielleicht zwanzigtausend Mark.
Er kam eiligst an. Herbert M., ungefähr fünfzigjährig, schritt auf seinen langen dünnen Beinen schnell und federnd, trug das kantige Gesicht eines Mannes, der auch als Schauspieler hätte auftreten können.
Von dem Augenblick an, als er den großen Ferntransporter sah, hatte der schneidige SED-Genosse M. vorübergehend keine Augen mehr für die vorbei flanierenden, jungen Lehrgangsteilnehmerinnen. Seine Sinne richteten sich vor allem auf den als Vorderkajütboot ausgestatteten Flitzer. Wie ein Wiesel rannte er um den LKW herum, schwang sich auf die Pritsche und mahnte nun auch die anderen zur Hilfe herbeigerufenen Männer: „Vorsicht, Vorsicht. Seid bloß vorsichtig mit dem Motorboot.”
Tatsächlich kümmerte sich Herbert M., der ehemalige Kreissekretär der SED, Neustrelitz, ausschließlich um das teure Luxusboot persönlich. Kaum hatte es Platz gefunden in seinem wintersicheren Unterstand, wandte er sich wieder höheren Aufgaben zu, - nämlich mit den Schönheiten zu kokettieren.
Von Anfang an stand fest, das kostspielige Schmuckstück würde quasi nur ihm gehören.
Der Rest der Fuhre war ihm gleichgültig.
Die Paddelboote, darunter eine Vierergig, wurden einfach unter einem der uralten Apfelbäume hingestapelt, so wie man rohes Schnittholz lagert.
Niemand, der ihm auch nur eine Stunde lang zugehört hatte - und feststellen musste wie er sein feuriges Temperament nutzte um die Ausbeuter aller Kategorien in Grund und Boden zu verdammen, - hätte dem Genossen Herbert M., dem derzeitigen Leiter der Schulungsstätte Tollenseheim, diese unrechtmäßige Aneignung von unverdienten Vorteilen zugetraut, Keck hatte er die für Vermessungsarbeiten bereitgestellten staatlichen Finanzen in seinen persönlichen Interessenbereich umgelenkt. Die ihm seitens der staatlichen Organe übertragene Aufgabe bestand darin, den Bau der späteren Agraringenieurschule vorzubereiten.
Aber er war ein leidenschaftlicher Bootsfahrer und Angler, sowie ein möchtegerne Agitator für die Allmacht seiner Partei. Auch er bestätigte damit indirekt, dass die Vernunft der Leidenschaft regelmäßig unterlegen ist.
Das irgendwann zu berichten, betrachtete ich seit jenem Tag als meine Pflicht, als ich an der zwei Kilometer von Tollenseheim liegenden Fernverkehrstraße F 96 drei etwa 20jährige Mädchen weinend sah. M. habe sie zurück in ihre Büros ihrer Genossenschaften geschickt mit einer Begründung die albern war.
Warum wirklich?
"Wir waren ihm nicht zu Willen!"
Es macht gar nichts aus, wie klug jemand ist. Der Wunsch sich auszuleben ist bei gewissen Menschentypen durchsetzungsfähiger, als der Verstand. Ausnahmen bestätigen die Regel. Paul und mir musste er nicht den Bären aufbinden, er brauche den Flitzer für die Besorgungsfahrten nach Neubrandenburg.
Mit dem „Framo“ war er allemal schneller. Selbst wenn Herr M. mit dem Rennboot bis vor die Tür eines Lebensmittelgeschäftes hätte fahren können, der Benzinverbrauch jedes Wasserfahrzeuges ist pro Kilometer Fahrstrecke mindestens doppelt, wenn nicht dreimal so hoch, wie der eines Lieferwagens.
Eindeutig war es sein Vergnügungsfahrzeug. Der gnadenlose Kritiker anderer nahm sich damit ein reichlich unverschämtes, besitzergreifendes Verhalten heraus. Er beutete eben jenen Staat aus, der gegenüber seinen Bürgern gerechter und besser sein wollte, als alles zuvor dagewesene, der von getäuschten und miserabel entlohnten Arbeitern getragen wurde. Genau das war es, was ich immer wieder als zutreffend registrierte: Proportional mit dem vermeintlichen Machtzuwachs des gewöhnlichen Mannes, minimiert sich die Lautstärke seines Gewissens. Wie lange kann das gut gehen? fragte ich mich ungeniert. Das nachfragend zu denken war leicht, denn ich, als das letzte Glied in der Kette dieser neuen Gesellschaft höchst entwickelter Primaten, war nämlich im Wortsinn ohnmächtig.
Das würde auch so bleiben.
Denn ich glaubte daran, dass Evolution nicht alles sein kann, dass es da eine alles überragende, planende und handelnde Intelligenz geben muss und gibt…die übrigens weiß, wie miserabel wir mit unserem allerhöchsten Gut umgehen.
Leute die so ähnlich wie ich dachten durften in der DDR nicht hoch kommen.
Die acht oder zehn Paddelboote und die Vierergig lagen noch tagelang draußen.
Der sie überragende Apfelbaum bot aber keinen Schutz; vor allem nicht gegen fliegende Pfeile und rotweiße Messstäbe. Techniker hatten sie in die Garage gestellt und möglichweise längst vergessen. Respektlos wog ich, an einem der Arbeitstage zwischen Weihnachten und Silvester ’55, eine der speerähnlichen Stangen. Verwegen schleuderte ich sie, aus der offenen Garage, in der, zwischen zerkrümmelten Briketts, auch der Lieferwagen “Framo” stand, ins Freie, hoch über die Boote hinweg. Der rotweiße Markierungsstab flog vielleicht zwanzig Meter weit. Paul, mit seinen strammen Muskeln, ein ehemaliger Waffen SSler, wider Willen übrigens und sehr selbstbewusst, war überzeugt, er würde gewiss doppelt so weit, wie ich Knirps werfen. Aber schlecht gepackt, noch mieser geworfen. Krachend bohrte sich die stählerne Stabspitze in den millimeterdünnen Rumpf der aus Mahagoniholz gefertigten Vierergig. Sie hatte genau soviel Geld gekostet, wie Paul und ich zusammen in einem halben Jahr verdienten.
Der schwere Messstab vibrierte noch, als wir aufgeschreckt hinliefen um dem entsetzlichen Bersten und Brechen des dünnen Bootsrumpfes ein Ende zu bereiten. Viel zu spät. Wir schauten als erstes zum schräg rechts oben liegenden Fenster des alten Stammhauses, das wie eine Villa aussah, aber ursprünglich wahrscheinlich als Hotel gedacht gewesen war. Weder Herbert M. noch seine Wirtschaftleiterin Inge ließen sich blicken. Sie hatten es also, zum Glück, nicht gehört.
Paul verzog keine Miene seines ohnehin ruhigen, großflächigen Gesichtes. „Schnell!”, sagte er.
Ich half ihm.
Gemeinsam schuldbewusst, aber gerissen genug, trugen wir die irreparabel zerstörte Gig gemessenen Schrittes ins nahe liegende ehemalige Hühnerhaus. Diese Behausung war eine aus morschen Brettern bestehende ziemlich große Baracke. Schlau gedacht bauten wir sämtliche Paddelboote davor auf. Wenn es gut ging, kam es nicht heraus, bevor der große Neubau stand und das konnte noch zwei Jahre dauern.
Sollten wir uns irren?
Aber zunächst war da der Gedanke, den wir ebenfalls teilten: Nach uns die Sintflut.
In den Märztagen 1956 glaubte ich, es sei gut, das Gras auf der so genannten Liegewiese abzubrennen. Ohne zu bedenken, dass Feuer im Freien, wenn es trockene Nahrung findet sich auch seitlich und somit gegen die Windrichtung ausbreiten kann, entzündete ich die Grasfläche mindestens zweihundert Meter weit von der Hühnerstallbaracke entfernt, in der die demolierte Vierergig, die Ruderbote, und die Kanus sorgfältig übereinandergestapelt lagen.
Vorsichtshalber entzündete ich die Wiese am untern Teil des Hanges.
Allerdings kam vom Flächenbrand angesaugt, im Handumdrehen mehr Wind auf. In zwei Richtungen breitete sich das Feuer aus. Außerdem schlug der Hauptwind um und ehe ich mich versah, züngelten die Flammen in jene fünf herrlichen Omorikafichten hinein, die vor der für mich so wichtigen Baracke, hünenhaft wie zuverlässige Wächter standen. Wütend auf mich, das knochentrockene Gras, und mein Schicksal, riss ich die wie Zunder brennenden Clematisranken herunter und entdeckte zu spät, dass die Flammen unmittelbar an den dürren Brettern des flachen Hauses leckten. Immer wieder warf ich mich mit meinen blauen Latzhosen mitten hinein ins knisternde Feuer, bis mir die Luft ausging. Ich wälzte mich in den Flammen, von der Vorstellung getrieben, dass da drinnen für mindestens zwanzigtausend Mark Wassersportgeräte lagerten,
In sechs Jahren verdiente ich zwanzigtausend, und damit gehörte ich schon zu den Privilegierten. Alles andere war in diesen Minuten bedeutungslos.
Ich hörte Gespenster lachen.
Ich sah sie erst, die beiden am Wegrand stehenden Spötterinnen, als der Spuk so schnell wie er aufgekommen war, glücklicherweise mangels weiterer Nahrung in sich zusammenbrach, ohne die für mich so kostbare Baracke zu vernichten. Zwar perlte noch Teer vom Pappdach, doch er entzündete sich nicht mehr. Mein Kopf sank auf die Brust, ich atmete tief auf.
Herbert M. sah eine halbe Stunde nach dem letzten Aufbäumen des gefährlichen Feuers die schwarze Wiese und die teilweise angesengten Omorika. Er strich, seine langen Beine behutsam setzend, um den Hühnerstall herum und hielt den markanten Kopf wie ein witternder Fuchs. Bemüht, die ärgsten Spuren zu verwischen, arbeite ich auf dem Gelände eifrig, buddelte da ein Loch um die halbverbrannten Ranken einzugraben und dachte, jetzt zeigt er dir seine Zähne. Doch als Herr M. näher kam, schaute er mich eine ganze Weile nur vielsagend an, als wollte er ausdrücken: Jetzt sind wir quitt! Du hast wie ich, nur eine Dummheit, ohne Folgen, gemacht.
Es war ihm also nicht einerlei gewesen, dass ich ihn eine Woche zuvor mit einer Dame in bestimmter Position gesehen hatte. Eilends trennte sie sich von seinem Schoß, als ich in sein Büro hereingestürmt kam, weil ich meinte, er hätte mich hereingerufen.
Vielleicht wären wir wirklich quitt gewesen, gäbe es da nicht die noch nicht entdeckte Gig, und hätte ich keine weiteren Fehler begangen.
Denn, mich manchmal nur auf mein Gefühl verlassend, redete ich bei Gelegenheit mit mir unbekannten Leuten offen über meine nicht staatskonformen Ansichten.
Ich selber hatte in den ersten Nachkriegsmonaten zu viel gesehen. Verschiedene Exbaltendeutsche und andere Augenzeugen, vor allem ostpreußische Frauen, hatten mir zudem entsetzliche Geschichten erzählt. Bei mir waren all diese Berichte gut aufgehoben. Sie bestätigten mich in meiner Ablehnung und Gesinnung: diese neue Gesellschaftsordnung hatte sich unmenschlich eingeführt.
Mitunter war ich unvorsichtig und sprach darüber. Aber wie gingen unbekannte Fremde mit meinen Äußerungen um?
Was hätte ich antworten sollen, wenn mir die Männer des DDR-Staatssicherheitsdienstes jemals die Frage nach der Authentizität der gelegentlich von mir verbreiteten Antisowjetgeschichten gestellt hätten?
In jenen Tagen des Frühjahres 1956, behandelte das „Neue Deutschland”, den für uns allesamt aufregenden Verriss Stalins auf dem XX. Parteitag.
Noch vor wenigen Wochen stand in weißer, riesiger Schrift auf revolutionsroten Holztafeln, die sie am Friedländer Tor angebracht hatten, der uns alle bedrohende Satz geschrieben: Stalins Geist lebt!
Noch war es nicht die volle Verurteilung des verstorbenen Machthabers. Man sprach vom Personenkult um Stalin. Das wäre nicht in Ordnung gewesen.
Noch wurde nicht klar ausgesprochen, dass er ein Verbrecher war, der Millionen Familien zerstört hatte, indem er maßlose Strafen für geringste Vergehen verhängen ließ, die Hunderttausende nicht überlebten.
Uns gingen dennoch die Augen über. Zwar stand mehr zwischen den Zeilen geschrieben als im Klartext, doch es erregte uns bereits.
Denn Stalin war der Gott der ausgehenden vierziger und der nachfolgenden Jahre gewesen. Nun entgöttlichten sie ihn, obwohl seine einst so strammen Anbeter ihm ewige Treue geschworen hatten.
Einige seiner Verehrer fielen nach der Lektüre ihres ND ins andere Extrem. Sie traten dem Genossen Josef Wissarionowitsch postum kräftig in den Hintern. Unverfroren wie sie bisher das Gegenteil behaupteten, erklärten sie auch uns: Er sei nur ein Götze gewesen.
 |
Nur, ich hatte meine Lektion gelernt, und die da nicht. Deshalb rührte mich diese Woge damals nicht sonderlich.
Dieselben Presseleute, die noch wenige Wochen zuvor Millionen ihrer Leser leidenschaftlich versicherten, dass J.W. Stalin der „Vater der Gerechtigkeit” und der „Genius der Menschheit” sei, schrieben jetzt in scharfen Tönen gegen ihn.
Auf der Straße, in den Bussen, in den Eisenbahnabteilen wurde nun Nikita Sergejewitsch Chrustschow zitiert. Man hielt einander die Zeitungen unter die Nasen. Wir DDRler waren endgültig ein Volk von Politikern geworden. In einem Punkt waren sich alle, mit denen ich sprach, einig: Die Partei hatte sich jahrzehntelang keineswegs nur geirrt. Ihre Köpfe wussten mehr. Zu keiner Zeit der Stalinverbrechen ging es um die Wahrheit. Es ging ihnen um die Teilhabe an Macht. Um den Willen aufzubringen, einen einzigen Mann zu entmachten, hätten sie zuvor auf diese Teilhabe verzichten müssen.
Für das Vorderkajütboot musste ein Anlegesteg gebaut werden. Hausmeister Paul machte sich an die Arbeit. Gegen die Grundregel verzichtete er darauf, Leinen zu spannen, an denen entlang die Pfähle zu rammen sind.
Sein Machwerk sah dementsprechend aus. Eher einem zufällig entstandenen Schrotthaufen ähnlich, als einem Werk von Menschenhirn und -hand, stand das Unding krumm und windschief da, sogar gefährlich wacklig. Eine Schande! Als ich auf dem von Paul zusammen geschusterten Laufsteg entlang ging, wurde mir schlecht. Meine Mitarbeiterpflicht war, ihm zu sagen, dass er vielleicht ein guter Ehemann und bestimmt ein hervorragender Hundeliebhaber sei, aber vom Stegebau keine Ahnung hat. Danach muss er versucht haben, ebenfalls ohne Schnur, die ungleichen Bretter auf die Verbinder zu nageln.
Während ich nun versuchte, meine Bemerkungen zu relativieren (wie man heute zu sagen pflegt, wenn man aus Gründen der Höflichkeit die Wahrheit zu verbiegen beabsichtigt) kam ein sonderbarer Lehrgangsteilnehmer anspaziert, ein großer, steckendürrer Mann. Von Gesicht und Gestik wirkte er wie ein Sektenprediger des vergangenen Jahrhunderts. Er kam uns vor wie einer, der gerade in einen sauren Apfel gebissen hatte. Für einen Meisterlandwirt hätte ihn wohl niemand gehalten. Der Mann setzte die großen Schritte ganz bedächtig. Als er die Bescherung sah, wurde sein langes Gesicht noch länger. Er schlug buchstäblich die Hände über dem Kopf zusammen und blieb nachdenklich stehen. Soviel Mist auf einem Haufen hätte er noch nie gesehen. „Abreißen!”
Dieser Mann war ein Brigadier! Kommandieren konnte er schon.
„Abreißen?”, fragte Paul, gleich wutentbrannt. „Rüchtig!”, erwiderte der große Dünne und machte eine weitere abfällige Bemerkung. Paul zog mich beiseite, zu den Pfählen hin, die ungeordnet im Gras herumlagen: „Den Kierl schmiet ick int Woter!”("Den Kerl schmeiße ich ins Wasser!", flüsterte er. Wahrscheinlich sah Paul selber ein, dass er keine Glanzleistung vollbracht hatte. Nur er wusste nicht, wohin mit dem Ärger.
Ich kannte ihn. Dieses Zucken seiner Augenlider verriet das Ausmaß seines mit Erregung gepaarten Leichtsinns.
Hinterhältig fragte er den Bauernbrigadier, ob der für ihn noch einen guten Rat parat habe.
Arglos, die hohe Stirn gefurcht, erwiderte der etwas schrullige Fremde zustimmend: Am seeseitigen Ende des Anlegesteges müsste ja sowieso noch der Kopf des Laufsteges gerammt werden. Er, an Pauls Stelle, würde restlos alles ‚abräumen’ und dann da, in dreißig Meter Entfernung einen starken Pfahl hinstellen und von ihm ein kräftiges Seil zum Land spannen und dann... Lebhaft machte der uns so großmäulig erscheinende Mensch die dazugehörigen Arm- und Handbewegungen. Sogar mich reizte sein Befehlston.
Paul nickte mir vielsagend zu und fragte den Mann, ob er sich denn auch zutraue, mit ihm und uns aufs Wasser zu fahren, um ihn vor Ort zu beraten. Schließlich käme es ja auf den Eckpfosten an und den könnte man gleich hinstellen. Kurioserweise akzeptierte der Fremde. Warum nicht?
Echt treuherzig schaute Paul jetzt drein.
Das Mienenspiel unseres künftigen Opfers drückte dagegen eindeutig seine Hilfsbereitschaft aus.
Und so machte der Ahnungslose mit seinen Halbschuhen einen eleganten, akkuraten Satz vom Land ins Boot, das sich immerhin in fast anderthalb Meter Entfernung von ihm befand. Er wankte nur kurz, setzte sich dann bedächtig auf die kleine Heckbank, zupfte seine Hosennaht zurecht, zog eine Shagpfeife aus der Hosentasche, stopfte sie aufreizend langsam mit Tabak, entzündete sie seelenruhig, sog den Qualm in sich, blies ihn selbstzufrieden in die blaue Frühlingsluft und schaute sich um. Offensichtlich genoss der ein wenig snobistische Ackerbauer die Aussicht auf die Schönheit der Landschaft, während er paffte und geduldig der Dinge harrte, die kommen sollten.
Paul hatte indessen den kräftigsten unter den herumliegenden Pfählen ausgesucht. Er richtete ihn auf. Das war fast ein Mast, dazu knochentrocken und deshalb nicht zu schwer. Scheinbar fachsimpelnd weihte Paul mich in Details seines schändlichen Planes ein. Als hielte er seinen ärgsten Kritiker schon am Genick, schüttelte Stegebauer Paul den Pfahl, wie man im Herbst einen Pflaumenbaum rüttelt. „De is rüchtig!”, ("Der ist richtig!") ahmte er den anderen nach.
Jawohl, diesen sollten wir einladen ins Boot, meinte der von uns heuchlerisch um sein Urteil befragte Brigadier. Der setzte hinzu: „Naja, ein lütt bisken zu lang ist er noch”, aber sonst sei der Pfosten
ganz prima, wenn es da oben denn weichen Seegrund gäbe.
Wir nickten. „Na klar, da oben ist es bannig weich.” Zufrieden kopfnickend äußerte der Landwirt, kürzer schneiden könne man das Holz ja immer noch.
Wir meinten bei uns, über dem zwei Meter tiefen Wasser, wenn wir da denn angelangt wären, würden wir den Starkpfahl mit Schwung über einen Meter tief in den weichen Grund hineindrücken.
Paul zog sein flächiges Gesicht schief und kniff sein linkes Auge zu. „Ick pett denn up de Siet, un du uk.” ("Ich trete auf den Bord und du auch.")
Ich war längst einverstanden und lachte vergnügt, denn ich sah ja voraus, was sich ereignen musste. Dieses Bild!
„Naja”, dachte ich, „ein Bad im Freien hat noch niemandem geschadet!”
Uns beiden war natürlich klar, dass das Oberflächenwasser des Tollensesees Anfang April sich trotz tagelanger Sonneneinstrahlung kaum erwärmt haben konnte. Dafür war der See zu tief und die Zone des nur nullgradkalten Wassers zu mächtig. Sobald man bloß die Hand in seinen Rachen steckte, biss das Wasser noch kräftig zu.
Mit unseren Gummistiefeln durch Wasser und Morast patschend, trugen wir das Langholz zum kleinen Ruderboot, schoben es so behutsam, wie es uns nur möglich war, zwischen die Schuhe und Beine unseres gemütlich rauchenden Gastes.
Sobald wir uns von Land abgestoßen hatten, schaukelte der Kahn in den Wellen, die durch das Gelege hindurch wogten. Aber das war ungefährlich, obwohl der Nordostwind auffrischte. Wir freuten uns. Das Schaukeln des Kahns kam uns wie gerufen. Wir überaus erfahrenen und eitlen Bootsmänner grinsten einander an.
Vor Ort angekommen nahmen wir den Pfosten, steckten mit ziemlicher Anstrengung seine spitze Nase ins bewegte Wasser und richteten ihn einigermaßen aus.
Wir hatten noch soviel Zeit uns an unseren Berater zu wenden.
„Rüchtig so!”, bestätigte der kühne Bauer. Das untere Ende unseres Pfahles war vom Eigengewicht bereits drei, vier Dezimeter tief in den weichen, tonigen Grund eingedrungen. Entschlossen spannten
wir unsere Muskeln. Paul griff weit nach oben, allzu weit allerdings. Er wollte die Schwere seiner gut neunzig Kilogramm zur vollen Geltung bringen.
Gleichzeitig sprangen wir auf den schmalen Bord, des grünrot getünchten Ruderbootes. Jetzt gab es keine Rettung mehr. Jetzt sauste der lange, aufreizende Kerl samt seiner Shagpfeife über Bord.
Jedenfalls war dies die bunte, auch von mir verinnerlichte Illusion.
Aber, wieso denn ich?
Dabei genoss ich eben noch das Plinkern dieser himmelblauen Hausmeisteraugen und die Vorstellung, wie der andere das erfrischende Bad nimmt. Urplötzlich hatten meine flatternden Hände äußerst heftig und dennoch sehr vergeblich in die kühlen Frühlingslüfte hineingegriffen.
Gewaltig trieben mich die Urinstinkte an. Schnell, schnell! An Land, an Land! Ins Trockene!
Mit einem einzigen Blick, während ich noch eisern kraulte, sah ich Paul. Der klebte noch am Pfahl.
Entschieden zu weit entfernt vom rettenden Boot waren wir, das mit seinem trockenen, immer noch qualmenden Feldbaubrigadier sachte in Richtung Land trieb, weil wir es ungewollt zwar, aber kräftig von uns abgestoßen hatten.
Vom Brustkorb abwärts kam ich mir vor wie ein Eisklotz. Dicht unter meinem Bewusstsein dagegen klapperten die Zähne bereits wie spanische Kastagnetten.
Land unter Füßen, wandte ich mich sogleich wieder um.
Da!
Immer noch, wie ein verstörtes Affenbaby mit enorm verkürzten Armen und Beinen klammerte Exelitesoldat Paul sich verzweifelt an den kräftigen und doch unverlässlichen Pfahl. Die Wellenspritzer nässten schon seinen Hosenboden, denn sein Halt neigte und neigte sich, wenn auch ganz langsam.
Ich war fasziniert. Noch zwei Sekunden vielleicht. Länger hielt ihn das Holz nicht über Wasser.
Da tat er einen urigen Schrei.
Heftig, wie ein startender Schwan, mit seinen Schwingen auf das Wasser einschlagend, krächzte er markerschütternd: „Himmelarsch und Wolkenbruch!”
Weiter kam er nicht.
Es verschlug ihm die Luft.
Ein paar hastige Bewegungen noch, dann hatte auch er den Schilfstreifen erreicht. Mit wilder Kraft richtete sich der bibbernde Gardesoldat auf. Statt dankbar zu sein, dass sein Herz noch schlug, schrie er, je weiter er in Sicherheit kam, Unanständiges.
Der unschuldige Brigadier, dem das galt, nahm erst jetzt die Pfeife aus dem Mund. Er machte eine salbungsvoll anmutende Geste, ehe er uns unterwies. Man müsse auf dem Wasser immer danach trachten, sicher zu stehen, oder sich im Boot gut festhalten. So wie er. Er klemmte den Pfeifenstiel zwischen die roten Lippen, dann griff er nach beiden Bordseiten und demonstrierte, wie er sich verhalten hätte. Da erst bemerkten wir, wie groß und kräftig des Brigadiers Hände waren, Pranken die zufassen konnten. Er hob die Mundwinkel und lächelte nachsichtig.
Irene K.
Schulleiter M. lud häufig Gastdozenten in sein Haus. Darunter befand sich eine freundliche, fünfundzwanzigjährige rotblonde Dame, die Vorlesungen im Fach Philosophie hielt. Sie hieß Irene K., sah gut aus, war ein wenig korpulent und von ganz und gar offenem Wesen. Sie lachte gerne, aber sie hatte etwas an sich, das Männer nicht unbedingt mögen. Sie konnte herausfordernd frech blicken.
Herbert M. stellte sie kurze Zeit später als feste Lehrkraft ein.
Am letzten Apriltag 1956 grub ich, gut dreihundert Meter vom Haus Tollenseeheim entfernt, mit einem Spaten eine Ackerfläche um, die mit Tomatenstauden besetzt werden sollte. Da sah ich die Philosophiedozentin unerwartet auf mich zukommen. Selbst wenn ich sie nie gemocht hätte, allein die berechtigte Vermutung, dass sie ihr graues, gutsitzendes Kostüm für mich angezogen hatte, war aufregend. Denn alle Lehrer und Schüler befanden sich im Kurzurlaub. Nur sie und mich gab es noch.
Ringsum standen im Geviert riesige Birnenbäume, die selten oder nie Früchte trugen. Das Gelände lag unmittelbar am friedlich blinkenden See. Sie lächelte schon von weitem, als sie den Weg zwischen den gerade grünenden Apfelbäumen herunterkam.
„Ich muss doch mal gucken, was unser Gärtner den ganzen lieben, langen Tag so treibt.” Ihre helle Stimme vibrierte reizend.
„Ob er überhaupt was zuwege bringt!”, lachte ich zurück.
Sie schaute mich freundlich an. Das Haus stünde ja, wie ich wüsste leer. Einen Tag vor dem ersten Mai, am Nachmittag, müsste man es ja nicht übertreiben. Sie lade mich zu einer Tasse Kaffee ein.
Sie möchte mit mir über die biblischen Paulusbriefe reden. „Es fasziniert mich, dass du sie kennst!”
Einmal hatten wir darüber gesprochen und ich hatte geäußert, die zweitausend Jahre alten Briefe enthielten noch so manche, für uns interessante Botschaft.
„Und welche?”, wollte sie daraufhin wissen.
„Dass wir tun müssen und in die Tat umsetzen, wovon wir überzeugt sind, dass es richtig ist.”
„Das liest du da heraus?”
„Der Kern der Paulusaussagen ist keineswegs, was die Protestanten daraus ziehen, sondern eher umgekehrt: dass der Mensch ernten wird, was er sät.” Ihre Erwiderung lautete: „Das klingt ja nicht unvernünftig!” Natürlich war ihr völlig gleichgültig, was ich mit kritischem Blick auf die Lehre beider Großkirchen meinte.
Die Sonne wärmte uns, während wir plauderten.
In einer ihrer nächsten Vorlesungen käme das Thema Glaube und Wissen vor. „Mach’ Schluss für heute, lass uns oben gemütlich Platz nehmen und darüber reden.”
Ich wollte nicht nein sagen.
Sie war so höflich gewesen nicht zu formulieren: Was du denkst, ist trotz alledem kurios.
In ihrem Zimmer umfing mich augenblicklich ein Gemisch aus Nelkenduft und dem Geruch von ‚Großer Freiheit’.
Aus der Diskussion über Paulus, Luther, Bauernkrieg und evangelischer Rechtfertigungslehre wurde natürlich nichts.
Schade! Denn ich verdammte die Ansichten jener schwachsinnigen Protestanten, die meinten der liebe Gott würde schon alles richten, wenn sie nur an seinem Namen und ihrem vagen Glauben an ihn festhielten.
So jedenfalls, mit derartigem Selbstbetrug, kann die Welt kein besserer Wohnplatz werden! Aber eben darum geht es, wird es immer gehen, solange wir uns nicht zum Affentum zurückentwickelt haben. Ich war entschlossen zu sagem, dass die Welt selbstzerstöreischen Charakter hat, weil ihr Liebe fehlt, jene Liebe die ihre Echtheit durch gewisse Selbstlosigkeit beweist, denn ich war gewillt mich von ihr nicht, auf Kosten des Lebensglückes meiner Frau, einwickeln zu lassen. Vielleicht kann man einmal Herzen ersetzen, die Treue nicht.
Auch aus dem Kaffeetrinken wurde nichts, denn ich nahm Selterswasser zu mir. Sie saß, die Beine übereinander geschlagen auf dem Sofa, und ich hatte zu tun, mein Gleichgewicht zu behalten. Ich glaube, dass ich stocksteif an ihrem Zimmertisch saß und halb verlegen, halb verwirrt, mit den Fransen ihrer gehäkelten Decke spielte. Sie sprach über Homers Nymphe Kalypso und in spöttischlockendem Ton über Männer wie Odysseus, Kalypsos Verehrer.
Sie sei jedenfalls keine ‚schön dumme’ Penelope, die artig daheim sitze und unentwegt wartend bloß Strümpfe für ihren Mann strickte, während der eine andere bezirze.
Sie nickte, als ich sie anschaute.
„Meiner sitzt jetzt irgendwo in Rostock bei einem Weibsbild herum und spielt den Seelentröster!”
Warum war ich so dämlich gewesen, mich wissentlich in diese Situation zu begeben?
Hatte ich nicht schon einmal Lehrgeld bezahlt?
Jetzt fühlte ich wie mein Wille fest zu sein schwächelte.
Ich sollte, wenn ich meinen Vorsätzen treu bleiben wollte, nicht einen Augenblick länger hier oben in ihrem Zimmer herumhocken, sondern lieber zu meiner kleinen Familie zurückradeln.
Aber das war bloß die Sprache der Vernunft.
Meine Basisinstinkte bestanden darauf, sofort ihren Forderungen nachzukommen. Mein Geist funkte nochmals dazwischen: Du bist nicht der Mann, der das um jeden Preis haben muss. Es ist besser inkonsequent zu sein, als verräterisch. Ich lenkte das Gespräch auf meine Ansichten zum Kommunismus. Mir war der Gedanke gekommen: Wie ich selbst mitunter bin, ist der ganze Kommunismus aufgebaut, gespalten von oben bis unten! Lauter Widersprüche zwischen Theorie und Praxis.
Außerdem: Von menschlicher Läuterung ist ernsthaft keine Rede. Wenn es andererseits auch immer wortreich herausgestellt wurde, dass Menschen für den Sozialismus reif werden müssten. Nicht wenige, die das forderten, täuschten sich selbst ungeniert, weil es ja unsagbar schwer ist sich unter allen Umständen selbst zu zügeln. Man kann es leicht von andern verlangen, sich korrekt zu verhalten.
Die Dozentin lächelte, aber nur aus Höflichkeit.
Sie schätze Leute, die denken können.
Nicht gerade versteckt war meine Attacke auf die marxistischen Weltverbesserer, die alles verändern und verbessern wollten, außer sich selbst.
Herbert M. und diese Frau da vor mir, würden alles tun um mir zu beweisen, wie gut und beschützenswürdig die DDR und ihr Sozialismus seien und im selben Atemzug zeigten sie nicht die geringsten Beschützerinteressen, soweit es seine und meine Frau betraf. Würde ich zugreifen und das Lockende auch nur flüchtig berühren, würde ich mein Recht preisgeben, den Kommunismus vehement wegen innerer Unwahrhaftigkeit abzulehnen. Das war der Punkt, den ich verteidigen oder meine Position aufgeben musste.
„Die ganze Philosophie ist keinen Pfifferling wert, wenn wir uns bei ihr nur bedienen, wie es uns gerade in den Kram passt!” Obwohl ich es mit diesen Worten ein bisschen verkorkst ausdrückte, verstand sie, glaube ich, was ich meinte.
Irene K. schaute mich an wie jemand, der über den Brillenrand blickt. Sie stimmte mir, jedenfalls teilweise zu, allerdings, wie mir schien, mit spröder Stimme.
Doch ihr hübsches Gesicht verriet mir, dass sie das Thema wechseln möchte. Sie schüttelte den Kopf und lachte ein wenig unnatürlich. Es war ja auch komisch. In der Natur fragt man nicht. Die Blüte lädt den Schmetterling ein und der nektarsüchtige Sammler kostet es aus
Ihre Augen sprühten plötzlich Zorn, weil ich mich zusammen nahm und mich erhoben hatte.
Wenige Tage später saß ich wieder an dieser im Tollenseheim nach Nordwesten gerichteten, großen Fensterwand und schaute sehnsüchtig auf den weit unten im Tal liegenden langgestreckten, wunderschönen See. Seinen geschwungenen Buchten folgte der Blick zu gerne. Das herrliche von riesigen Buchenbeständen und seinen großen Hügeln umrahmte Gewässer lockte mich stärker denn je zuvor. Seine ihn umgebenden Mischwaldhänge umrahmten ein Gemälde wie von Monets Hand.
Da kam ein fremder, stattlicher und auffallend gut gekleideter Mann in die geräumige Veranda herein, ein Buchhalter, wie ich richtig vermutete, der mir nur kurz seinen Namen nannte und nach knapper Frage neben mir am Mittagstisch Platz nahm. Ohne uns je zuvor gesehen zu haben, fassten wir zueinander schnell Vertrauen. Es war dieses Gefühl von innerer Übereinstimmung, das mich in den vielen Jahren nie verlassen hatte, das Gespür wie weit und wem ich mich öffnen durfte und wem nicht.
Es dauerte nicht lange, bis wir die übertriebene Parteitreue der Philosophiedozentin aufs Korn nahmen.
Er sei auch Theaterkritiker - und ich, sagte ich, versuche ‚Theater’ zu schreiben. Er gab an, ich auch.
Wir kamen wieder auf die Dozentin zu sprechen. Ich plauderte etwas aus. Daraufhin schmunzelte er. Er kannte sie. Sie gehöre zum neuen Frauentyp. Dabei lachte er und dieses Lachen klang um eine Kleinigkeit zu hart.
Nach einer Weile des Schweigens wechselten wir zum ursprünglichen Thema zurück: Über den XX. Parteitag der KPdSU tauschten wir unser sich erstaunlich ergänzendes Wissen und unsere Meinungen aus. Mir kam noch nicht in den Sinn, dass wir per eingebaute Mikrofone abgehört wurden.
Er wusste, was ich noch nie gehört hatte, und ich wusste von Ereignissen zu berichten, die wiederum in sein Bilderbuch hineinpassten, als hätte er längst nach ihnen gesucht.
Zwei Leute, die nicht ein gutes Haar an der Verwirklichung dieses Sozialismus lassen konnten, hatten sich gesucht und gefunden. Die Rohheit eines Systems, das uns keine Wahl ließ, quälte uns. Zu viele
Leute, deren Namen und Gesichter wir sehr gut kannten, hatten sich für ihre Karriere gegen ihre Vorbehalte entschieden. Andererseits war uns bewusst, dass die große Geschichte so chaotisch, wie sie zum Dritten Reich Hitlers verlaufen war, sich niemals wiederholen dürfe.
An sich war ein Experiment wie der Sozialismus berechtigt. Aber nicht als Abenteuer ohne Rücksicht auf Verluste. Bereits der Urgrund, den Lenin in der Sowjetunion gelegt hatte, erschien uns beiden als unzuverlässig, weil unehrlich und mehr als das gewalttätig. Ihre Funktionäre handelten wie die Elitechristen des vierten Jahrhunderts die der ganzen zivilisierten Welt den Stempel ihres gnadenlosen "Christentums" aufgenötigt hatten, die den Grund für die spätere Inquisition legten.
Einmal würden die Historiker offen legen, wie viele Millionen Menschenleben zwischen 1917 und 1937 infolge dieser Art der Revolution allein in Russland vernichtet wurden.
Beide Jahrgang 30, hatten wir vieljährige Erfahrungen mit dem auf uns zielenden pausenlosen Propagandatrommelfeuer des Stalinismus hinter uns. Wie so viele andere hatten auch wir uns wundgerieben an den uns unsympathischen Parolen, die in uns den undifferenzierten Hass auf den “Kapitalismus” hervorrufen sollten.
Hass sollte gesät werden, er musste als Pflanze des Verderbens aufgehen!
Wir empfanden sehr stark, dass es den maßgeblichen Kommunisten vorrangig um die Vernichtung der Demokratie ging. Das war es, was uns wie die Vorstufe zur Sklaverei erschien.
Als einziges Mittel zum Überleben unserer prodemokratischen Ansichten blieb uns nur der Versuch einander in der Ablehnung zu bestärken. Ähnliches wagten Hunderttausende in diesem Lande, vielleicht sogar Millionen. Und doch war es nur ein Aufblasen der Backen gegen den gewaltigen Oststurm.
Ziemlich unvorsichtig bezeichnete ich in jener Mittagsstunde Lenins Dekret über den Boden als glatte Lüge. Lenin habe nie anderes als die schließliche Verstaatlichung des Bodens gewollt. Die bitterarmen Muschiks jedoch, an die sich das Dekret richtete, mussten glauben, wenn sie sich auf Lenins Seite stellten, dann bekämen sie selbst, für immer, ein Stückchen Land zu eigen. Die vom mörderischen Krieg ausgezehrten, von Heimweh, Hunger, Läusen und Tod geplagten Russen hörten auch heraus, dass Lenin den Krieg sofort beenden wolle. Ja, dass sein erstes Dekret überhaupt ihrem ureigensten, dringlichsten Wunsch entsprach: „Alle Frieden! Frieden!”
Von klaren aber auch unnennbaren Hoffnungen getrieben, mussten sie in Lenin den Erlöser sehen. Vorausgesetzt sie würden seinen Aufrufen Folge leisten, gelangten sie durch einen einzigen Schwenk ihrer Hüften aus der Hölle direkt ins Paradies.
Wir beide glaubten, dass Lenin vorsätzlich so verfänglich geschrieben hatte. Sein wahres Gesicht zeigte er, nur drei Jahre später, in seinem Brief „Tod den Kulaken!”, den man ja in jeder Lenin-Gesamtausgabe nachlesen könne. Eine ganze Klasse, nämlich sämtliche Mittelbauern Russlands, gab er - wenn auch aus dem berechtigten Zorn über einige tatsächliche Verbrecher - unterschiedslos dem Verderben preis. Das waren zwölf Millionen Todesurteile!
Jeder mit einer Pistole bewaffnete Neidhammel, der glaubte, er hätte noch eine offene Rechnung mit diesem und jenem Mittelbauern, kam mit Leninsätzen daher, um an sich zu reißen, wonach ihn gelüstete. Namens der Partei und der Wahrheit wurden Menschen aus Machtgründen schutzlos dem Verderben preisgegeben.
Die Zeitung vom 22. Januar 1956 hatte ich mir aufgehoben. Den Ausschnitt trug ich bei mir. Ich zeigte zwei Passagen, die mir ins Auge gestochen hatten. Auf einer Innenseite der Zeitung des Zentralkomitees der SED “Neues Deutschland” wurde dort berichtet, wie der Frankfurter Obermagistralrat Dr. Julius Hahn, Mitglied des westdeutschen Arbeitsausschusses der Nationalen Front aus einer Tagung heraus verhaftet wird.
„Wir sitzen, hatten gerade das Hauptreferat gehört...plötzlich beim Mittagsmahl stürmen auf ein Trillerpfeifenzeichen 20 uniformierte Polizeibeamte in den Saal, riegeln ihn ab, verlangen in barschem Ton von den Anwesenden die Ausweise...”
Brecht wurde in diesem Zusammenhang zitiert. Auf dieses Brechtzitat legte ich den Finger. Es sollte Dr. Hahn betreffen, den Sympathisanten der Kommunisten, aber es betraf genauso die Kulaken!
“Eurem Bruder wird Gewalt angetan, und Ihr kneift die Augen zu! Der Getroffene schreit laut auf, und Ihr schweigt? Der Gewalttätige geht herum und wählt sein Opfer, und Ihr sagt, uns verschont er, denn wir zeigen kein Missfallen. Was ist das für eine Stadt, was seid Ihr für Menschen? Wenn in einer Stadt ein Unrecht geschieht, muss ein Aufruhr sein...”
In dem Zeitungsausschnitt wurde auf die Quelle verwiesen. Da stand geschrieben: aus ‚Der gute Mensch von Sezuan’, Brechts Drama.
„Bilder, Originalbilder aus den Tagen der Nachrevolution müsste man sehen, dann wüssten wir, wie viel Unrecht in Russland zwischen 1917 und 1956 wirklich geschehen ist. Denkt daran, was Brecht fragte: Was ist das für ein Land, was seid ihr für Menschen? Denn da im Mutterland des Kommunismus wurde bisher jede, -jede-, Ablehnung solcher Brutalität, wie sie die eigentlichen Ernährer des Riesenlandes erfuhren, im Blut erstickt.”
Ich schimpfte und er bekräftigte. Wir selbst befanden uns in Aufruhr. Zunehmend seit Jahren. Wir glaubten, wir hätten eine wenn auch nur schwache Vorstellung vom Elend, in das die Menschen jahrzehntelang durch den Kommunismus gestürzt worden waren... wir erlebten hautnah, was es bedeutete die eigene in Jahrzehnten mühsam erworbene Überzeugung verleugnen zu sollen... meine Gedanken glitten immer wieder zurück in die Zeit wo die Männer um Ambrosius von Mailand ihren Glaubensterror, den sie gegen Millionen Hellenen übten, obendrein "christlich" nannten. Und die Großkirchen ehrten ihn mit Gedenktagen.
Da musste einen die Wut packen.
Plötzlich hob ich den Kopf und erschrak. Den Lautsprecher in der Ecke hatte ich missachtet. In jedem der drei Geräte befand sich seit seiner Installation ein Mikrofon!
Ich hätte es doch wissen müssen! Nicht nur in dem Lautsprecher des Schulungssaales, in jedem anderen befand sich wahrscheinlich dieselbe Technik. Denn einmal, im Büro der Wirtschaftsleiterin zeigte Hausmeister Paul Schmidt mir, wie das funktioniert. Deshalb der große Schaltschrank. Man bediente zwei Knöpfe und schon konnte man hineinhören in den Schulungsraum. Furchtlos, nachdem Wirtschaftsleiterin Inge und Herbert M. eines zurückliegenden Tages mit dem Luxusflitzer nach Neubrandenburg gefahren waren, nahm er sich heraus mich einzuweihen.
Respektlos lauschten wir beide in die Vorlesung der Philosophiedozentin hinein. Wie konnte ich so naiv sein und glauben, dass Herbert M. nur wissen wollte, was in seiner Abwesenheit im Klassenzimmer geredet wurde? Das Naheliegendste war mir entgangen.
Was dort möglich war, das galt auch für alle andern Räume. Während mein Blick sich auf den stoffbespannten kleinen Trichter in weniger als drei Metern Entfernung richtete, fielen mir sämtliche Sünden bei. Sofort gab ich meinem Gesprächspartner, Buchhalter Günter, ein Zeichen der Warnung.
Wir hatten gerade in sehr scharfem Ton über einen Fall von Aufruhrniederschlagung in der SU gesprochen. Da war die nur wenigen bekannte, jedoch zuverlässig überlieferte Erhebung der Kronstädter Matrosen, 1921, gewesen. Nur dreieinhalb Jahre nach der Errichtung der Sowjetmacht ereignete sich das Verbrechen.
Von ihren Schlachtschiffen “Sewastopol” und “Petropawlowsk” aus hatten die Matrosen heftig protestiert, dass die Arbeiter in den Kronstädter Staatsunternehmen der Sowjetunion „wie die Zuchthäusler zur Zarenzeit” behandelt wurden.
Auf Lenins Befehl hin ließ Kriegskommissar Trotzki die Aufständischen zusammenschießen. Da hatten Mitmenschen eben das getan, was Bertolt Brecht sich wünschte. Doch eben die Partei, der auch Bert Brecht diente zerschmetterte gnadenlos den Aufstand des leidenschaftlichen Mitleids.
Wie passte das zusammen?
Buchhalter Günter vermochte es mir sehr anschaulich zu schildern, wie die Truppenteile der Roten Armee über das Eis des finnischen Meerbusens vorrückten und wie sich die Artilleristen der eingefrorenen Schlachtschiffe vergeblich gegen den Sturmlauf ihrer in Weiß gekleideten Waffenbrüder verteidigten.
Ich stimmte ihm zu: Wenn das wahr sei! Dann hätte man Lenin allein für diese Ruchlosigkeit in Ketten legen müssen.
Gerade, als ich das ausgesprochen hatte, war mein Blick auf das Gerät zu unseren Köpfen gefallen. Vor Schreck blieb mir der Bissen im Halse stecken. Die Ikone des Kommunismus hatte ich besudelt. So dumm zu sein, wie ich, musste bestraft werden.
Eine Minute später kam sie tatsächlich an.
Ich hörte, wie Irene K. die Treppe herunterstieg. Das typische Klappern ihrer hohen Absätze klang allein schon bedrohlich.
Ich sah diese blitzenden Augen, als sie sich uns näherte und wusste Bescheid. Als leibhaftiger Racheengel wird sie sich nun erweisen.
Aber wir hatten doch leise gesprochen.
„Die Empfindlichkeit eines Mikrofons der neuen Generation ist beträchtlich.” Dieser Satz eines Technikers kam mir in den Sinn. Namens der Diktatur des Proletariates waren wir der Dozentin, wenn sie wollte, ausgeliefert. Aber, die einzige Diktatur, die mein Gewissen je dulden würde, war die meiner eigenen Vernunft über die Leidenschaft.
„Dafür schuldet ihr mir Rechenschaft!”, hörte ich sie schon im Voraus tönen. Dafür, dass wir uns herausgenommen hatten, sie persönlich zu kränken. Dafür, dass wir uns herausgenommen ihre Partei und den großen Denker Lenin beleidigend zu kritisieren.
Sie wusste nun, dass wir Ulbrichts System als seelenknechtend betrachteten. Für sie gab es keinen Zweifel an der Richtigkeit des Weges, der Zwang als politisches Mittel einschloss.
Sie diente der Diktatur, die wir hassten. Innerlich verteidigte ich mich ununterbrochen gegen eine mögliche Anklage. Ich wehrte mich: Zwang, gleichgültig, von wem angewandt, verkehrt die beste Sache der Welt in ihr Gegenteil. Wisst ihr das nicht? Erniedrigte Frauen müssten unsere Gefühle verstehen können.
Dozentin Irene ging an uns vorbei. Nur einen einzigen, wenn auch sehr sonderbaren Blick gab sie mir.
Es ereignete sich nichts. Ungewissheit kann schlimmer sein als eine schlimme Gewissheit. Das war es, womit sie regierten.
Es braute sich etwas Gefährliches gegen mich zusammen. Es lag in der Luft.
Einige Tage später, Mitte Mai erfuhr ich, dass mein Gesprächspartner, der Buchhalter Günter, wahrscheinlich verhaftet worden sei, oder, und das war nicht auszuschließen, er hatte sich in den Westen abgesetzt.
Jedenfalls sei er spurlos verschwunden.
Das war natürlich zweierlei! Im Westen zu sein oder im Gefängnis zu sitzen.
Verhaftet!
Herbert M. und andere hatten es mir schon mehrfach zu verstehen gegeben: Wer gegen die DDR hetzt, der spricht der Friedensfeinde Sprache.
Einen Tag nachdem ich vom Verschwinden Günters erfuhr fauchte mich die Philosophielehrerin im Waschraum an: „So nicht!”
Was meinte sie mit diesem unbestimmten, unvollendeten Satz? Ich holte mein Fahrrad aus dem Keller, wollte heimfahren. Da sah ich Braun, einen der neueingestellten Lehrer, neben Irene K. stehen. Er löste seinen Arm, den er um ihre Schulter geschlungen hatte.
Braun kam auf mich zu. Er war klein, sogar ein wenig kleiner als ich. Sein Ausdruck allerdings war der eines Giganten. Er machte scheinbar vielsagende Gesten. Ich betrachtete seinen kahlen Kopf, seine glatten Züge, um ihm nicht in die provokant ausforschenden, hellen Augen blicken zu müssen. Unter dieser Schädeldecke bildeten sich Worte und Sätze gegen mich. Das war nicht zu übersehen. Nicht so sehr überraschte mich deshalb, dass er formulierte: „Wir werden sie wohl hoppnehmen müssen!” Wortlos fragte ich: Wegen meiner Gespräche mit Günter, nicht wahr?
Braun schien zu wissen, was ich dachte. Er sagte: „Wegen subversiver Tätigkeit.”
Erst als ich mit meinem Rad davonfuhr und seine und ihre Blicke im Rücken zu spüren glaubte, fiel ich in Panik. So leicht hatte der Neue es dahergesagt, als hätte er gemeint, morgen ist auch noch ein Tag zum Teetrinken.
Bezog er sich auf das Abbrennen der Wiese? Hatten sie die zerstörte Gig entdeckt? War, was die Dozentin über die Abhöranlage vernahm, nur der I-Punkt? Reimten beide sich des Buchhalters Günters Bemerkungen wegen noch mehr zusammen? War Günter ein Spitzel gewesen? Du wirst für die unverzeihliche Sünde bezahlen. Lenin durfte. Im Namen der Revolution durfte er tun, was er für erforderlich hielt, selbst wenn sämtliche Nicht-roten allesamt daran verreckt wären. Wo gehobelt wird, da fallen Späne.
Heiligtümer besudelte niemand ungestraft. Du hast ihre Sache in den Dreck getreten. Geschieht dir recht, wenn sie dich hoppnehmen. Mit diesem Schock, die Gitterstäbe vor Augen, fuhr ich heim. Ich trat in die Pedalen und schwitzte vor Aufregung. Einer meiner väterlichen Freunde beruhigte mich. „Subversiv? Was heißt das? Tollenseheim steht doch noch. Bange machen gilt nicht! Lass dich nicht ins Bockshorn jagen!”
Er hatte gut reden.
Das Wochenende verging. Am Montagmorgen versicherte ich mich, ob Braun die Gig entdeckt haben konnte.
Nein.
Es geschah so gut wie nichts, außer dass meine Gefühle verrückt spielten.
Hausmeister Paul ging in dieser Woche überraschend von Tollenseheim weg und ich beschloss, dasselbe zu tun.
Als ich am 2. Juni 1956, in der Presse las, die Produktionsgenossenschaft werktätiger Fischer “Tollense” suche umgehend zwei Saisonarbeiter, schien mir das ein Wink des Himmels zu sein. Zögern? Nicht eine Minute.
Herbert M. legte sein ernstes Gesicht in tiefe Falten und entließ mich erstaunlich zurückhaltend aus der Pflicht. Hatte ich mich umsonst aufgeregt?
Als Fischereihilfsarbeiter auf Zeit
Erika, meine Frau, schlug die Hände über dem Kopf zusammen: "Das ist die unterste Stufe auf die du dich dann begibst! Hilfsarbeiter - Saisonhilfsarbeiter..."
"Na und? Das ist meine Chance, wo soll ich sonst hin? In ein Büro wo ich über dem Studium toter Zahlen einschlafe?"
 |
| Links außen Karl Neumann, neben ihm Hermann Möller, der Netzmacher, dritter von rechts Otto Görß |
Da ist dieses Bild vom 1. Mai 1953. Auf den ersten Blick sehen sie glücklich aus, die alten Neubrandenburger Seenfischer, doch sie sind es nicht.
Man sollte meinen, dass die Männer sowohl kämpferisch kritisch wie auch zuversichtlich sind. Die Momentaufnahme hätte sie eher pessimistisch fragend darstellen müssen, als heiter dreinschauend. Es ging ihnen eindeutig schlechter als vor fünfzehn Jahren. Mein Informant sagte: „Du musst einmal einen Blick in ihre Fangbücher werfen Aber sie wollen es dennoch packen. Sie wirtschaften nun bereits seit mehr als vier Jahren auf eigene Rechnung. Sie sind nun selbständige Genossenschaftler. Nur, sie fangen zu wenige Fische. Sie leben zwar von einem Tag und Traum zum nächsten, doch sie fühlen sich wesentlich bedrängter und unzufriedener als damals, unter Peters, auch weil ihnen ihr Buchhalter immer wieder, vergevlich, sagt, dass es so nicht weiter gehen kann.“
 |
| Wilhelm Bartel (1913-1972) |
Otto Görß, das ausgeprägte immer scharf rasierte Kinn erhoben, dritter von rechts, hält einen Brotlaib unter seinem Arm. Gerade zum vierten Mal Vater geworden, hegt er trotz seiner Ablehnung des Geistes dieses Staates noch hoffnungsfroh gewisse Pläne. Er wird seinem Namensvetter nicht nachfolgen, sondern dableiben, komme, was da wolle. Er wird aus der miserablen Situation das Beste machen. Seine wunderbare Frau Erna, streichelte ihm für solches Versprechen immer wieder den geraden Scheitel seiner dunkelblonden, starken Haare. Nein er werde gar niemanden verraten. Für Otto galt es voll und ganz: Ein Mann, ein Wort. Seiner Meinung nach muss und kann ihnen gelingen, mehr zu fangen. Wenn sie nur die Mittel hätten, sich mehr Netze zu kaufen. Er muss hier an diesem Ort und auf diesem Platz das tun, was er leisten kann, um herauszukommen aus dem Elend, gleichgültig, was dann wieder auf der großen Bühne geschieht, dessen Geschehen er ohnehin nicht beeinflussen kann.
Der Kopf des Mannes Fritz Biederstaedt ruht scheinbar auf Ottos Schultern. Seit sechs Jahren befindet er sich nun schon wieder außerhalb der Gefängniszäune. Dass er diesen Zustand wirklich genießt, kann Flaschen- und Busenfreund Otto nur bestätigen. Sie sind Freunde in der Trinkerrunde und Kumpels auf dem See. Bescheidener ist Fritz geworden, wesentlich kameradschaftlicher als in den Jahren seiner Regentschaft über den früheren Fischereihof. Deshalb, und weil er gut verhandeln konnte, wenn es ums Geld ging haben sie ihn zum Stellvertreter Wilhelms gemacht. So hatte er sich wieder hochgerappelt. Karl Neumann steht links außen, ein pures Bündel Energie. Dass er das rote Maiabzeichen wie Gräf, zweiter von rechts und wie Mikusch trägt, besagt gar nichts. Neumann ist ausschließlich und jeweils am ersten Mai Mitglied der Arbeiterklasse, sonst ist er ihr und ihren Funktionären spinnefeind. Mit Logik hat das bei ihm nichts zu tun. Mir wollte er an die Kehle gehen, als ich ihn später einmal, als er besonders scharf über die Parteileute herzog, mahnte, er müsste sich doch befreit fühlen. Denn früher sei er doch nur ein armer Schlucker unter der Fuchtel eines Ausbeuters gewesen und jetzt gleichberechtigtes Mitglied einer Genossenschaft. Hart fuhr er mich an: „Du hesst keene Ohnung!” ("Du hast keine Ahnung!")Dabei spreizte er seine mächtigen Hände, als wollte er einen Ochsen erwürgen.
Hermann Müller, das Fliegengewicht, feierlich im schwarzen Anzug, hat vornean links seinen Platz eingenommen.
Ich sollte die Männer allesamt sehr gut kennen lernen.
Denn sie stellten mich ein, für sechs Wochen, wie sie sagten.
Aber wie das Leben so spielt: Mikusch, ein junger Familienvater setzte sich im Juli 1956 alleine in den Westen ab, - als politischer Flüchtling, wie er sehr wahrscheinlich vorgab - und ich durfte bleiben und seine Stelle einnehmen...
 |
| Bild: Jochen Milster Da bin ich schon ein Jahr lang dabei - hier im kalten Sommer 1957 - links außen. So sah die Zugnetzfischerei aus. |
Die Zeit verging wie im Fluge. Aber es wurde nicht besser, jedenfalls nicht 1957. Wegen der Sommerkälte fingen wir erbärmlich wenig. Obendrein trösteten die wortführenden Männer einander mit zu viel Schnaps und so hing meine Fischerzukunft am seidenen Faden.
Geräuschvoll trieb der Nordwest an diesem düsteren Novembernachmittag, des Jahres 1957 die ersten Schneeflocken vor sich her. Das Jahr war gelaufen. Aus. Die Genossenschaft musste wieder Kredite aufnehmen um uns zu löhnen.
Es war nicht nur das Äußere, aber es war auch das. Wie ein Treidler gegen das Seil, stemmte sich der untersetzte, nun gut fünfzigjährige Fritz Biederstaedt gegen den Wind. Stossweise zerrte der Sturm an seiner grauen Schiebermütze.
Gefühlvoll umklammerten seine starken Fäuste zwei glasklare Flaschenhälse, deren schwere Leiber tief in seinen Joppentaschen steckten.
Dennoch, so recht wollte sich die Vorfreude auf seine traute Männerrunde jedoch nicht einstellen. Fritz bog um die Ecke der ersten Bootsschuppenreihe, zwischen denen sich die elende Baracke der Fischer befand. Er spürte es nun noch deutlicher: Irgendetwas stimmte nicht. Er kam nicht so schnell dahinter, was ihn bedrückte und das beunruhigte ihn plötzlich noch mehr. Wie der heftige Sturm mit dem Qualm umsprang, der aus dem abgestumpften Ofenrohr der Fischereibaracke drang, so müsste das Leben alles gegen ihn stehende Schwarze, Unangenehme, zerfetzen.
Fritz stapfte fester auf.
Manchmal ärgerte er sich sehr über unfreundliche Mitmenschen, über sich selbst und den Mangel vor allem, der in den Lebensmittelgeschäften vorherrschte. Aber das war es nicht. Obwohl er sich darüber gerade wieder erbost hatte. Fast nur das zum Überleben Notwendige konnte man einigermaßen billig erwerben. Vieles gab es immer noch nur auf Lebensmittelmarken zu kaufen. Pro Person 1380 g Fleisch im Monat, - 46 g pro Tag, - 815 g Fett und zweieinhalb Pfund Zucker für je dreissig Tage. Wer mehr haben wollte, musste es kostspielig in den HO-Läden einkaufen.
Seine Mitfischer murrten seit Monaten und ich hörte zu: So viel Arbeit für so wenig Lohn.
Der SED - Staat war ihrer Meinung nach der Hauptschuldige an ihrer Armut, Er gab ihnen für viele wertvolle Fische zu wenig Geld.
Tatsächlich trachteten die Finanzexperten der DDR - auf Weisung des Politbüros der SED-Regierung - danach, das Preisniveau der Löhne, Mieten und Nahrungsmittel auf dem Level des Jahres 1937 zu halten.
Das konnte nicht funktionieren.
Meine Kollegen sagten es frei heraus:
So hätten sie sich das Leben in der Binnenfischerei, mehr als 10 Jahre nach dem Kriege, nicht vorgestellt. In den langen Monaten Dezember, Januar, Februar, März lebten sie - und nun traf es auch mich - von Vorschüssen, die wir im kurzen Frühling und Sommer wieder abzahlen mussten. Dieses Teufelsloch war groß und die Hoffnung, da endgültig herauszusteigen, klein. Die Bauernbank gab ungern Kredite für Löhnung. “Warum investiert ihr nicht? Warum dies nicht, warum jenes nicht?” So hieß es bei den Bankern. Lieber rannte Fritz dann, in seiner Eigenschaft als zweiter Vorsitzender der Genossenschaft, zum Steuerberater Hermann Köppen, der sich auch als Geldverleiher hervortat.
Köppen nahm zwar höhere Zinsen, doch er meckerte ihn nicht an. Von seiten der Bank lautete die Losung: „Genosse Biederstaedt, da stellen sie zuerst mal ein Konzept auf, wie sie die Rückzahlungsraten pünktlich leisten wollen.”
„Ück bün aber kein Genosse”, pflegte er sich vor dem Bankchef kopfwiegend zu entschuldigen.
Beim Geldmann Köppen ging das wesentlich kultivierter zu: „Prost, Herr Biederstaedt, auf gute Zusammenarbeit!”
Dieser Mensch wusste, was sich gehörte. Aus dem Kognakschrank holte der höfliche Geldborger stets das Beste. „Wohlsein, Herr stellvertretender Vorsitzender! Sie werden das schon machen. Sechs Prozent sind für sie doch keine Hürde.”
Diesmal jedoch sah er sich genötigt bereits Anfang November bei Herrn Hermann Köppen anzufragen.
Blödes Wetter!
Die sechs Prozent Zinsen waren keine Hürde, aber der verdammte Nordnordwest hatte die Fische in unerreichbare Seetiefen gejagt.
Was soll ein Fischer unter solchen Umständen anderes tun, als abwarten und sich dieses Abwarten auf möglichst angenehme Weise verkürzen? Nämlich da drinnen in der Holzbaracke, wo seine Mitfischer ihn und das, was er mit sich trug sehnsüchtig erwarteten. Als Fritz um die letzte Ecke seines Weges bog, rührte ihn plötzlich der Schlag. „Düwel uk!” ("Teufel auch!")
Da stand der eigentliche Grund seiner düsteren Ahnung fest: der fast fabrikneue PKW F 8 des Rates des Bezirkes!
Biederstaedt schluckte. Die beiden Fischmeister Eduard Jochim und Ernst Stöckelt waren von Neustrelitz gekommen um ihm und seinen Männern ein paar unbequeme Fragen zu stellen. “Düwel, Düwel”, wiederholte er. Er, der zweite Chef, hätte pünktlich und andächtig lauschend in der Quartalsversammlung sitzen müssen! Wo er so verspätet herkomme, werden sie ihn aushorchen. Ob es Wichtigeres gäbe als die Politunterrichtsstunde. Gerade er, der aus dem Polit-Knast entlassene sollte sich schulen lassen.
Ein drittes, „de Düwel holt!” ("Der Teufel hole uns!"), platzte ihm über die dicken Lippen. Fritz schüttelte sich, als wäre ihm ganz unangenehm brennendes Zeug durch die ausgedörrte Kehle geronnen.
Tapfer betrat er den unaufgeräumten Vorraum zum Schulungs- und Kulturraum. Normalerweise kamen die Parteileute an jedem letzten Mittwoch des Quartals angereist, um ihre Unterweisungen zu geben. Ausgerechnet diesmal war es anders. Mit der flachen Hand hätte er sich vor den Kopf schlagen können, wäre die nicht damit beschäftigt gewesen die Flaschen aus dem Versteck seiner Joppe zu ziehen und sie unterzubuddeln unter einen Haufen alter, vergammelter Netze.
Vergessen! Jemine, wie peinlich!
Alle werden den Termin vergessen haben.
Na, denn man tau.
Doppelt werden ihm die beiden Parteigenossen nun zusetzen, es wäre alles eine Frage des gesellschaftlichen Bewusstseins.
Und jetzt erst recht wird die alte Leierei losgehen: “Wann wollt ihr endlich mehr für eure Zukunft tun? Ihr müsst mehr Satzfische kaufen! Wo man nix reinsteckt, da kommt auch nix ‘raus!“
Lächelnd zwar, aber innerlich zerknirscht, wird er ihnen die großen, grünlichgelben Zähne zeigen und es zum Scherz ummünzen: “Ganz meine Meinung!” In Wahrheit aber möchte er sagen und ihnen an den Kopf schmettern, was er wirklich dachte: “Lüd, woväl Geld häm wie all de Johren tun Fenster rut, in den See rinner schmeten.” ("Leute, wie viel Geld haben wir in all den Jahren zum Fenster hinaus und damit in den See hineingeschmissen. (Nämlich die teuren Fischsetzlinge)"
Er murmelte das kleine, aber inhaltsreiche Zwiegespräch vor sich hin, während er sich innerlich aufrüstete, gleich unter die forschen Augen der kritischen Gäste zu treten. Natürlich war er ein Freund von richtigen Besatzmaßnahmen.
Aber die fünftausend Mark für die Maränen war auch solch ein Fall von sinnlos vergeudeten Finanzen. Ein Glück, dass die beiden Genossen auf Kosten des Rates des Bezirkes die Rechnung für ihre wahnwitzige Idee bezahlt haben. Er dachte an die angeblich fünf Millionen winzigen Brütlinge, die sie vor Jahresfrist in ein Eisloch gegen alle Vorschrift in Ufernähe geschüttet hatten, weil das Eis so brüchig geworden war. “So lütt!”, sagte Fritz, als erkläre er jemanden, was ihn so aufregte. Die winzigen Dinger bestanden ja nur aus Augen. Wie wollten die da unten in der Finsternis ihr Futter finden?
Die beiden angereisten Fischmeister Jochim und Stöckelt hatten schon vor Jahren Stock und Bein geschworen, es sei hoch an der Zeit, den Tollensesee mit Aalbrut und Maränensetzlingen zu spicken. Wer weiß, welchen kostenaufwendigen Beschluss sie ihm und den Männern diesmal abnötigen würden. In der vorletzten Versammlung war von zukünftiger Karpfenwirtschaft auf der Lieps die Rede gewesen. Auch so ein Blödsinn.
Viel zu viel Ried (Rohrbestände) ... viel zu teuer! Kaufen, immer kaufen, höhnte er in seine lustlose Seele hinein!
Fritz schöpfte tief Luft, riss die Tür zu dem viermal vier Meter ‚großen’ Schulungs- und Kulturraum auf, in dem sechzehn kräftige Männerärsche auf den mehr oder weniger wackligen Stühlen hockten. ‚Kulturraum’ hieß dieser knapp abgeschlagene Teil der Holzbaracke, weil da ein Radio, ein Blaupunktgerät, auf einem mit silbern glänzenden Fischschuppen überdeckten und verstaubten, kleinen Holzregal stand. Einige Jahre zuvor, 1950, war es ihnen als Prämie übergeben worden und seither gab es gleichmütig West- oder Ostnachrichten von sich, je nachdem, wer sich dem Gelände
näherte und welche Gesichter zur Tür hereinschauten. Fröhlich laut platzte Fritz mit der forschen Bemerkung in die Agitationsstunde hinein: „Dor mach man jo nich mol ‚nen Hund vör de Dör jogen“ "(bei diesem Wetter) da mag man ja nicht einmal einen Hund vor die Tür jagen!") Ernst Stöckelt, der erst gut dreissigjährige, unterbrach seine offizielle Rede. Sein schwungvoll geformter Kopf ruckte herum. Er schaute erstaunt und riss seinen fein geschnittenen Mund auf ohne auch nur ein Wort hervorzubringen. Er verharrte, als sei er verhext, für drei Sekunden. Stöckelt wollte gerade fortsetzen da schüttelte Biederstaedt sich, als sei er geradewegs aus dem Eisbunker gekommen und unterbrach den jungen Mann sogleich noch einmal mit seinem lauten Gruß: “Dach uk alltohop!” ("Guten Tag auch alle zusammen!")
Einige grinsten. Des ersten Bezirksfischmeisters nominierter Nachfolger hob nochmals verwirrt die bleiche Stirn. Biederstaedt nickte ihm herzhaft zu, zog die Mundwinkel herauf, ganz verbindlich, ganz der Alte, der nicht verlernt hatte, wie ein Diener seinem Herrn in einer kritischen Situation zu gefallen wusste.
Er zog unnachahmlich seinen beachtlichen Bauch ein und zwängte sich durch den engen Spalt zwischen der grauen Zimmerwand sowie den vier Rückenlehnen der Stühle des Buchhalters, Bartels und der beiden Bezirksfischmeister. Da musste er partout durchschlüpfen, weil er unbedingt seinen Stammplatz neben Otto einzunehmen gedachte, der auf der entgegengesetzten Tischseite saß.
Noch hatte er es nicht ganz geschafft.
Fritz hauchte dem nervös werdenden Stöckelt aus seinem scheinbar unerschütterlichen Gemüt und mit seiner heiseren Stimme in das weiße Genick: “Ever soveel jemütlicher is dat hür drinnen!” ("Aber soviel gemütlicher ist es hier drinnen!")
Er hätte ja auch auf der Türschwelle Platz nehmen können. Während er sich so durchkämpfte, ruhten aller Blicke auf ihm, wenige missbilligend, die anderen amüsiert. Das genoss er. Fritz wusste, diese Unterbrechung des Vortrages war den meisten willkommen.
Der kleinen Genossenschaft Stimmungsmacher war er allemal, im Guten wie im Bösen.
Erst vor vierzehn Tagen hatten ihn beide, Reiniger und Bartel, zusammengestaucht. Sogar sein Freund Otto Görß war ihm grob über den Mund gefahren. Da hatte er nämlich in Neverin, nachdem sie recht erfolgreich den Dorfteich abgefischt, heimlich einige Kilo Karauschen gegen eine kleine Flasche hochprozentigen “Bärenfang” eingetauscht. Weil ihm doch so jämmerlich zumute gewesen und er gefroren habe, indessen er auf sie warten musste. Bis sie endlich mit dem Fuhrwerk herankutschiert kamen, hätte er sich berechtigt gesehen, etwas gegen die ihn anschleichende innere Kälte zu unternehmen. Der Fehler bestand darin, dass nur für Otto ein Rest übrigblieb. Das bekamen die Benachteiligten mit. - Großes Wehgeschrei. Bei solchen Sachen kannten sie kein Pardon. „Uns hat auch gefroren!”, musste er in deftigem Platt- und Hochdeutsch hören. Als Brigadier sei er abgesetzt und wenn er sich Ähnliches noch ein einziges Mal erlaube, dann sei es endgültig aus mit seiner Herrlichkeit als stellvertretender Chef.
Nachdem er sich endlich geräuschvoll niedergelassen, erteilte Fritz Biederstaedt Ernst Stöckelt das Zeichen, nun könne es von ihm aus weitergehen. Dem energischen schneidigen und intelligenten Redner zogen Unverfrorenheiten normalerweise die Winkel seiner schmalen Lippen herab. In Biederstaedts Anwesenheit allerdings war alles immer anders. Biederstaedt breites Lächeln wirkte überwältigend, wenn auch nicht in jedem Fall.
Ich ahnte, die beiden Bezirksmeister werden ihnen vorrechnen, dass sie die Anzahl der Fänger reduzieren müssten. Ich fiele durch die Maschen, wie ein kleiner Fisch, nur dann wieder ins Nichts.
Sich sammelnd kratzte Ernst Stöckelt seine leicht gewellten, dunkelblonden Schläfenhaare. Er hüstelte, wog den schmalen Charakterkopf und fuhr offensichtlich da fort, wo er unterbrochen worden war. Ernst fragte die Tollensefischer, was sie denn wollten? Niemand könne mehr Lohn bekommen, als er durch entsprechende Gegenleistung verdient hätte. So funktioniere die Wirtschaft eben. Man kann aus einem Topf nur herauslöffeln, was da drin ist.
Ihr fangt nur einhundert Tonnen! Das sei entschieden zu wenig bezogen auf dreizehn Fänger. Das sei umerechnet auf die Wasserfläche all ihrer Seen knapp ein Drittel des Machbaren!
Fritz Biederstaedt kniff die Augen zu. Türlich!
Stöckelt Ernst hatte Recht. Doch da war es wieder, das alte böse Thema. Stöckelt sollte es lieber ruhen lassen. Sah er denn nicht, wie es in den Gesichtern der Fischer zuckte? Otto Görß hob denn auch sofort den Kopf: „Und de Kasernierten? Und de Aktendaschendräger?” ("Und die Kasernierten (Polizisten die nichts taten, gar nichts) und die Aktentaschenträger?") Wofür die ihr Geld bekämen? Ihren Funktionären hätte der Staat große Suppenkellen in die Hand gedrückt und den Arbeitern bloß Teelöffel. Wie ein Paukenschlag vibrierte die ungeheure Anklage. Otto ebenfalls in seinen dreißiger Jahren, war nie feige, jedenfalls nie besonders vorsichtig gewesen, wenn jemand ihn nötigte seine Meinung in Sachen Politik zu sagen. Unverbildet wie er war, sagte Otto, was er dachte. Das bedeutete immer, ich mag euch Kommunisten nicht!, weder eure Macht- noch eure Wirtschaftspolitik. Ihn stinke an, dass die Zeitungen kaum von dem berichteten, was ihn interessiere. Reisen durch die ganze Welt.
Als Vater von vier Kindern sperrten sie ihn nicht so leicht ein. Ottos weiße Wangenknochen schimmerten durch die dünne Haut.
Er selbst sollte schuld daran sein, dass er sich für seine dreihundert Mark monatlich, nur das Unentbehrlichste kaufen könne? Sein Vater hätte vor dem Kriege, einhundertundachtzig verdient, aber es sei für ihn als Kind hin und wieder eine Tafel Schokolade abgefallen. Das könne er seinen Kindern nicht bieten. „Disser Stoot is nich fehig, blot luder Beamte un Pulezisten.” ("Dieser Staat ist nicht fähig, bloß lauter Bemte und Polizisten!")
Eduard Jochim rutschte unruhig auf dem Stuhl umher. Ungestraft durfte sich niemand herausnehmen den Arbeiter- und Bauernstaat zu attackieren! Otto wies die Finger seiner Rechten vor. An ihnen zählte er noch einmal die Ursachen für die Teuerung auf. Es gäbe schließlich zu viele Schmarotzer in diesem Staat der Politkarrieristen.
Jochim, dem alten Bezirksfischmeister, war es unmöglich, noch länger nur schweigend dazusitzen. Einmal, vor Monaten, hatte er Otto sogar zugestimmt, insgeheim, unter vier Augen. Es traf zu. Zu viele Polizisten gab es! Hunderte in einer kleinen Stadt wie Neubrandenburg. Ein übergroßer Polizeiapparat sei das Kennzeichen eines faschistoiden Staates, hatte auch er in früheren Schulungen gelernt.
Seine eigenen Worte könnten Eduard Jochim nun in Teufels Kammer bringen, falls Görß ihn hier und jetzt daran erinnern sollte, was er ihm heimlich zugestanden hatte. Das runde, hochrote Gesicht des ältlichen, kleinen Mannes verriet, dass er sich wieder einmal in tiefen Zwiespalt gestürzt fand. Konnte er wissen, ob da unter den Fischern nicht ein Schweinhund saß, der ihn bei Walter Bär anzeigte, bei dem Wachhund der im Rat des Bezirkes eine große Nummer war (allerdings nur solange er nicht durch einen polnischen Besucher zufällig enttarnt wurde - er sei ein berüchtigter Anführer der hitlerschen "Feldgendarmerie" in Polen, im Generalgouvernement gewesen.)
Ins Herz sah man Niemand. Eduard strich nervös über den kahlen Kopf. Irgendjemand könnte schon am nächsten Morgen im Auftrage Walter Bärs in seinem Büro in Neustrelitz auftauchen, seinen Dienstausweis zücken oder die ‚Hundemarke’ vorweisen und sagen: ‚Kommen Sie mal mit, Genosse Jochim. Wir müssen mit Ihnen über das Gesetz zum Schutze des Friedens reden. Sie haben Ihre Dienstaufsichtspflicht verletzt. Man lässt den Klassenfeind nicht zu Worte kommen. Schon gar nicht in einer öffentlichen Versammlung. Fest stand, ein einziges Wort gegen den DDR-Staat gerichtet konnte selbst einem Familienvater fünf Gefängnisjahre kosten. So das Gesetz.
Otto Görß ließ nicht ab. Um seinen harten Mund zuckte es spöttisch. Wer sich gegen die Überbezahlung der Angehörigen der kasernierten Volkspolizei aussprach, der galt den ‚Hundertprozentigen’ als Klassenfeind. Das war ihm wohl bewusst. Doch darüber konnte einer wie er nur lachen. Siebenhundert Mark bekämen selbst die dämlichsten Bengel, die knapp ihren eigenen Namen schreiben konnten und er bekam dreihundert plus achtzig für die Kinder. Unklug wiederholte er sich: Früher wären in Neubrandenburg nur drei Ordnungshüter zu sehen gewesen, jetzt rannten über sechshundert umher - mindestens. Auch das langte nicht zu. Doppelt so viele. An jeder Straßenecke stünden und liefen sie und die meisten säßen in den Kasernen herum, statt zu arbeiten. In breitem Mecklenburger Platt sagte er das. Es klang fast harmlos. Aber das war in Wahrheit einer seiner, im Kern der Aussage, sich wiederholenden scharfen Angriffe auf die ungeliebte Partei.
Stöckelt schaute wütend herüber: „Wi kennen Di all, Otto Görß, wes blot still un taufräden!” ("Wir kennen dich, Otto, sei bloß still und zufrieden.") Warnend waren diese Blicke gemeint. Sie bedeuteten dem Furchtlosen: Warum er immer wieder den Bogen überspannen müsse? Das sei doch kein Geheimnis, dass er jeden Samstag sein Aaldeputat verscheuere - jene knapp drei Kilogramm die sich fast alle Fischer Mecklenburgs selbst zuteilten, was stillschweigend von oben geduldet wurde und wofür sie nur zehn Mark Steuern bezahlen mussten...Das könne Folgen haben.
Biederstaedt räusperte sich. Er wollte etwas sagen.
Kahlkopf Jochim hob den Zeigefinger zur eindeutigen Geste. Er wünsche keinen Streit. Ärgerlich erwiderte Otto umgehend und unbeherrscht: statt ihm zu drohen, sollten sie lieber dafür sorgen, dass die Lebensmittelkarten abgeschafft würden, dass es außer Margarine, Brot und Marmelade auch alles andere frei zu kaufen gäbe. ”Teigen Johr no den Krieg!” ("Zehn Jahre nach dem Krieg!") Von Westberlin sollten sie sich eine Scheibe abschneiden, statt ihn vollzunölen. Stöckelt schnitt Otto das Wort weg: “Walter Ulbricht hat gesagt,...”
Fritz Biederstaedt und Otto stießen sich gegenseitig mahnend an: Lasst es gut sein. Fritz wies Otto vorsichtig auf das Bild zu ihrer Linken. In Schwarz-Weiß blickte der spitzbärtige, hartherzige Mensch von der kleinen Zimmerwand großformatig auf sie herab. Dieser Ulbricht da an der Wand, Generalsekretät der SED von Kremls Gnaden, hatte gesagt: „Ja Genossen, also, ja, da machen wir eine klare Front zwischen Freund und Feind, ja.” So, im vollen Wortlaut, unfreiwillig komisch, zitierte Stöckelt ihn und das sogar ein wenig in Ulbrichts sächselnden Geschnarre.
Die andern Männer schwiegen aus Gründen der Vernunft. Otto Görß biss auf die Zunge.
Sein Freund Fritz hatte ja Recht. Wem half das ganze lamentieren? Nachher werden sie ihren Ingrimm auf ihre Weise bekämpfen.
Mit nun brüchiger, wenn auch gedämpft klingender Stimme, fasste Stöckelt zusammen: „Erfüllt erst mal euer Soll, dann reden wir weiter!”
Damit war alles Wichtige gesagt. Sie hätten es dabei bewenden lassen sollen. Doch er war noch nicht ganz am Ende seiner vorbereiteten Rede angelangt. Er stelle sich das folgendermaßen vor: "Die Mannschaft ist zu groß!"
Da war es das Wort! Es stach tief in mein Bewusstsein.
Mir drohte augenblicklich das definitive ‚Aus’.
Schon in der letzten Oktoberdekade bemerkte Buchhalter Voß lapidar: „Männer wir sind zahlungsunfähig!”
Kein Ratschlag, keine Versammlung konnte mich nun noch aus der Misere befreien.
Vorsitzender Bartel verkniff das Gesicht. Er habe schon vor Jahren mehr Aalbrut kaufen und in die Gewässer einsetzen wollen. Aber das hätte er nur tauben Ohren gepredigt. Seit eh und je befürchteten seine Mitfischer, dass diese zusätzlichen Kosten ihren augenblicklichen Verdienst schmälern würden.
Mensch, wer bloß auf den Augenblicksvorteil starrt, der darf sich über kärgliche Ernten nicht wundern.
Die seit Jahren zu geringen Besatzmengen wirkten sich nun natürlich verheerend aus. Selbst wenn sie das bisher Versäumte reuevoll nachholen würden, käme alles Bemühen für die nächsten Jahre zu spät.
Buchhalter Voß machte seine unschöne Rechnung präzise auf.
Dann sagte Ernst Stöckelt: "Das ist nicht alles. Ihr habt Satzkarpfen in die Lieps zu bringen. Zwei Tonnen!"
Da sprach die Partei und hier setze ich hinzu, nicht alles was die SED wollte und tat war falsch!
Während des ganzen Vormittags hatten die Männer schon Alkohol zu sich genommen. Unbesonnen wie Kinder konnten sie sein. Die irreversiblen Folgen, falls sie Ernst Stöckelt den Schlips gerade rückten, bedachten Neumann und Kurt Reiniger gewiss nicht. Ich sah, wie es ihnen in den Fäusten juckte.
Bartel rutschte zunehmend unruhig auf dem Stuhl hin und her. In den letzten drei Wochen hatten sie von nichts anderem als vom ausfallenden Weihnachtsgeld und der daraus resultierenden Verdienstminderung gesprochen. Weihnachtsgeld stünde Genossenschaftlern nicht mehr zu, hieß es, sondern es sollte im Eigenbetrieb erwirtschaftet werden.
Das sei auch richtig so, bekräftigte Ernst.
"Warum habt ihn nicht weiter gefischt? Bei Windstärke neun werden die kleinen wettergeschützten Seen befischt."
Noch ein einziges unbedachtes Wort aus Stöckelts Mund und sie sprangen ihm tatsächlich an seine große Gurgel.
Hermann Müller schaute zu Bartel hinüber, gab ihm ein kleines Zeichen.
Sofort presste Bartel es hart und schnell über die Lippen: ”Zehn Minuten Raucherpause!”
Nicht einen Augenblick länger hätte er warten dürfen.
Sofort rückten die eingeengt sitzenden Fünf den Tisch und ihre Stühle von sich, als würden sie einen Reifen sprengen, der sie einzuschnüren drohte.
Bartel schnäuzte ins bunte Taschentuch.
Gefolgt von seinem bisher schweigsamen Vorgesetzten, begab sich Ernst Stöckelt ziemlich schnell hinaus. Eduard Jochim sprach draußen auf seinen Mitarbeiter intensiv ein.
Es raschelten die letzten an den Pyramidenpappeln haftenden Blätter. Die fast dreißig Meter hohen Bäume wogenund bogen sich.
Biederstaedt sah sie beide neben dem Auto stehen und hin und her gehen. Ernst Stöckelt wickelte sich in seinen langen, schönen Marinemantel. Er schüttelte immer nur den Kopf und machte sich gerade. Anscheinend sah er keinen Grund die Situation zu entschärfen. Es war ja gar nichts passiert.
Es war in der Tat nur ein Nachdenken angeregt worden, ohne das es nie weitergehen wird.
Biederstaedt sah, dass Ernst Stöckelt kaum weniger als seine Männer aufgeregt war. Sein Mundwerk stand nicht eine Sekunde still, obwohl Eduard Jochim ganz offensichtlich versuchte seinen jungen, ungestümen Mitarbeiter zu beruhigen.
Biederstaedt fühlte sich getrieben, seinerseits die Rolle, die Jochim vor der Türe spielte, drinnen zu übernehmen. Er packte Otto und mit einem zweiten Griff Neumann am Ärmel. „Jetzt wat dat Muhl hollen!” ("Jetzt wird der Mund gehalten!") Gleichgültig was der junge Mann noch sagen könnte, selbst wenn er sie bis aufs Blut reizen sollte.
Was im Guten nicht ginge, ließe sich im Bösen sowieso nicht erzwingen. Schließlich wünschte er, was er herbei geschleppt hätte, noch heute ungestört zu genießen. Als Kurt das hörte, reckte der den langen Hals. Wo Fritz die guten Sachen denn versteckt habe? Plötzlich war für beide nichts wichtiger.
Görß dagegen sagte, er habe nichts zu verlieren. Das sollten sie sich mal versuchen mit vier Kindern. Deshalb. Bevormunden lasse er sich von diesen Maulhelden nicht mehr und die ganze DDR mitsamt ihren Parolen könne ihm gestohlen bleiben. „Freie Wahlen sollen sie machen!”, dröhnte er, dass es bis an Ernst Stöckels scharfe Ohren gedrungen sein musste. „Um Gottes Willen! Lüd’ wi hem drunken, mokt juch nich unglicklich!” ("Um Gottes Willen, Leute, wir haben getrunken, macht euch nicht unglücklich!") bettelte Biederstaedt.
Görß lachte. In trockenem Ton wiederholte er sich. In einer freien Wahl bekämen sie weniger Stimmen, als die SED Mitglieder hätte.
Wir gingen wieder hinein in den Kulturraum.
Aber darum ginge es doch gar nicht, beschwor Biederstaedt seinen besten Freund. Er wollte ihm gerade etwas zuflüstern, da kam auch Ernst Stöckelt zur Tür herein. Biederstaedt stockte der Atem, noch bevor der junge Mann den Mund aufmachte. Gleich krachte es.
Doch Stöckelt fragte nur, ob es immer so trocken zuginge bei ihnen.
Im Nu ruckten die kantigen Schädel.
Das war ein Wort vom Himmel gesandt.
Eine Stecknadel hätte man fallen hören können.
Sogar Otto Görß ging der Mund auf. Perplex, dass Stöckelt plötzlich ihre Sprache beherrschte! Sofort erhob Fritz Biederstaedt sich. Er strahlte wie ein blauer Morgenhimmel. Im Handumdrehen standen vierzehn randvoll gefüllte Gläser da. Keine halbe Stunde später sangen Biederstaedt, Kurt Reiniger und Sablotny in drei verschiedenen Tonarten: „Heut wolln wir glücklich sein, heut wolln wir fröhlich sein...”, als hätte es nie zuvor Anlass zu geringstem Ärger gegeben.
Heute!
Heute hieß es für Stöckelt und Jochim nachzugeben, nicht in der Sache, nur im Stil und Ton. Der Pessimisten Horizonte sind klein, aber ihre Fehl- und Vorurteile riesig groß. Diese für ihn neue Erkenntnis muss vor Ernst Stöckelt wie die Morgensonne aufgegangen sein. Denn er prostete ihnen lächelnd zu, zeigte seine kräftigen Zähne. Zwischendurch erklärte er dasselbe, sogar deutlicher als vorher, nur bemüht ihresgleichen zu sein. Immer habe er wirklich nur ihr Bestes gewollt. Immerhin seien nun schon zwei Sommer lang die Maränenbrütlinge im Tollensesee und sie sollten mal sehen, in ein paar Jahren...
Im Verlaufe der kommenden Jahrzehnte müssten und könnten sie den Hektarertrag durchaus vervierfachen und damit ihren persönlichen Reichtum. Jahraus, jahrein reproduziere ein See von durchschnittlicher Bonität auf einer Fläche von einhundert mal einhundert Metern, einhundert Kilogramm Fischmasse, wenn sie abgeschöpft wird. Blieben die Fänger unter dieser Möglichkeit, dann reduziere sich der Gesamtzuwachs. Es pendele sich stets eine gewisse Menge Biomasse pro Kubikmeter Wasser ein, in Abhängigkeit von der Nährsalzlösung und der Lichtdurchlässigkeit. Diese beiden Faktoren seien im Tollensesee aber von hervorragender Qualität.
„Jawoll! Ji hem schlecht wirtschaftet”, ("Jawohl, ihr habt schlcht gewirtschaftet!") schimpfte Stöckelt wieder durchaus nicht nur humorvoll. Wasser hätten sie genug. Und sie schimpften mit ihm auf sich selber, weil er im selben Atemzug einen neuen Fünfmarkschein aus der Westentasche hervorgenestelt hatte um sie dem Moloch Alkohol zu opfern.
Jawoll, Wasser hätten sie genug, Mikusch möge Bier holen. Aber der war längst in Westberlin gelandet. „Zweitausendachthundert Hektar! Achtundzwanzig Quadratkilometer!”, wiederholte Stöckelt rückfällig scharf, vorwurfsvoll. Aus ihren Möglichkeiten müssten sie, verdammt noch einmal, mehr machen!
„Jawoll!”, bestätigten Otto Görß und Biederstaedt wie aus einer Kehle, als hätte derselbe Mann, den sie soeben noch verwünscht hatten, nicht nur seine Stimme sondern sogar Fell und Gesinnung gewechselt wie ein Chamäleon seine Farbe. „Wat willn ji miehr?” ("Was wollt ihr mehr?), rief Ernst Stöckelt verwegener als vor einer halben Stunde aus. Mehr als zwei Quadratkilometer pro Mann. Damit lägen sie in der Norm.
Sogar Kurt und Fritz Reiniger stimmten zu. Ungefragt erwähnten sie Beispiele aus heimischer Fischereierfahrung.
Beide stammten aus dem Posener Gebiet. Während in den Nachbarfischereien nur klägliche Aalmengen gefangen wurden, hätte ihr Vater schon in den zwanziger und dreißiger Jahren das Zehnfache geerntet, weil er mehr Aalbrut eingesetzt habe. Daraufhin meldete sich Eduard Jochim zu Wort. In der Tat, sie sollten endlich den Beschluss fassen, mit Karpfen zu wirtschaften. Satzkarpfen sollten sie kaufen, mehrere Tonnen, egal ob mit oder ohne Bankkredite.
Da hätten sie doch die mehr als vier Quadratkilometer große Lieps, dieses Prachtgewässer, oberhalb des Tollensesees, mit der idealen Wassertiefe für Karpfen, nämlich weniger als zwei Meter im Maximum. „Acht Tonnen Karpfen gehören da hinein und mindestens sechzehn Tonnen werdet ihr wiederfangen. Rechnet euch den Gewinn selbst aus!” Das alte Lied, neu gespielt. Doch keine Dissonanzen mehr. Obwohl die Lieps wegen der ungeheuren Riedflächen kein Gewässer für die Karpfenproduktion war. Die sich immer mehr ausdehnenden Schilfbestände konnte niemand beherrschen. Dieser Urwuchs von ungeheurer Ausdehnung vereitelte einen geregelten Wiederfang von Karpfen zuverlässig. Weil sich in den Rohrbereichen der tieferen Uferzonen ganze Kutterladungen Großfische zuverlässig verstecken konnten. Da konnte sie das beste Zugnetz nicht erwischen.
Er hätte schon vor einem Jahr gesagt, was sie tun sollten, bekräftigte Eduard Jochim. „Rottet das verfitzte Rohr aus. Flache See verlanden eben mit den Jahren.” Dann seien die besten Partien des Gewässers schließlich nur noch stinkenden Löchern vergleichbar.
"Wir sind Fischer und keine Sommerrohrschneider!" äußerte der sonst ruhige Bruder des Westflüchtlings, Fritz.
"Nein, das sind wir nicht. Können uns das auch gar nicht leisten." Aber, er hätte bereits über den Bau und den Einsatz einer Unterwasserschilfschneidemaschine nachgedacht, flocht Otto Görß überraschend ein.
Biederstaedt sah das sonderbare Glimmen in Ottos Augen. Der Schalk Otto sprach. Eulenspiegels bester Kopist. Biederstaedt kratzte den Kehlkopf anhaltend. Denn Otto holte eine Streichholzschachtel aus der Tasche und zeichnete mit vorgespielt seriös wirkender Miene ein Kreuz auf die winzige blaue Rückseite. Vorsitzender Bartel schlug, als er das sah, die Hände über dem Kopf zusammen.
Jedesmal wenn sie tranken, brüteten seine Männer etwas aus, das nie flügge werden konnte. Otto Görß bildete sich doch nicht ein, er könne ein so komplexes Gerät aus Schrottteilen zusammenbauen.
„Wüso nich?“ fragte Otto selbstbewusst. Bartels rang um Atem. Das kannte er zur Genüge. Baumann Otto hatte immer Lust, etwas zusammenzubasteln und hinzuflicken. In Sachen Holz kannte er sich aus, aber doch nicht in der Metalltechnik. “Fische soll der hitzköpfige Kerl fangen!” Das flüsterte er Eduard Jochim zu. Der aber wollte Otto, oder zumindest seinen Denkanstoß, für bare Münze nehmen. „Erst mal sehen!”, erwiderte Jochim deshalb ausweichend.
Ottos fixe Idee, er müsse so etwas wie eine Erfindung machen, reizte Bartels Nervenkostüm bis aufs Äußerste. Mit seinen braunen Machorkafingern knöpfte er vor Erregung zitternd den obersten Knopf seines dunkelblauen Oberhemdes auf. Wer weiß, was Otto in Wahrheit beabsichtigte. Otto schob sein markantes Kinn noch weiter vor. Vom Scheitel bis zur Sohle war Otto ein Draufgänger.
Vorsitzender Bartel wusste aus trauriger Erfahrung, was aus Fieberphantasien, die man ernst nahm, herauskommen konnte. Regelmäßig, wenn sie trinkend beieinander saßen, kamen ähnlich verrückte Vorstellungen zum Vorschein. Wenn sie im Rausch beieinander hockten, dann fingen sie jedesmal Unmengen Fische. Nur mit der Verwirklichung haperte es gewaltig. „Hört bloß auf!”, warnte Bartel mühsam an sich haltend und zugleich eindringlich. Buchhalter Voß, der in den Weiten der Sowjetunion zuerst als Zahlmeister und später lange Zeit als Kriegsgefangener dienen musste, nickte ihm hilflos zu. Bartels war Realist, mochte er auch sonst seine Fehler haben. Bartels erklärte Bedenken richteten sich als vorsichtige Mahnung vor allem an Stöckelt und Eduard Jochim, Görß um Himmels Willen nicht zu glauben und die Versammlung zu schließen, obwohl sie einem Görß in dieser Situation gern Glauben schenken möchten.
Bartel sah nur noch das schwarze Loch in das Otto die ganze Mannschaft reißen könnte.
Er sprach gewöhnlich Hochdeutsch. Wenn er je Platt zu sprechen versuchte, klang das schaurig. Er wandte ein: “Nicht Ruhrschnitt, Ruhrschnitt! Sondern Unterwasserruhrschnitt, - un dat jeht nich.”
Görß hatte die miesmacherischen Flüstereien des Vorsitzenden Bartel natürlich mitgehört und ärgerte sich. „Rüchtig Willem”, grinste er, „Unterwasserschilfabschnittmaschine!” Spaßvogel Görß
machte komische Gesten, und dann im Ernst, erläuterte er sein Vorhaben an dessen Verwirklichung er anscheinend bereits einige Denkstunden lang gearbeitet hatte.
Er bewegte seine Hände wie zwei gegenläufige Sägeblätter eines Gatters. Er werde das Ding zuwege bringen! Man müsse sich nur die Schnittblätteranordnung wie ein Kreuz vorstellen.
„Lasst uns von was anderem reden!“ verlangte nun auch der Buchhalter, dem schwante was auf ihn zukommen würde.
Indessen leuchtete das, vom hochprozentigen Alkohol geschürte Feuer in Görß Augen.
Bartel schüttelte den graumelierten Kopf vergeblich. Nicht ein einziger DDR-Ingenieurbetrieb habe bisher die Aufgabe zufriedenstellend lösen können, ein Boot zu fertigen, dass sich durch Eigenantrieb im Rohrdickicht Bahnen in Metertiefe freischneiden konnte und inzwischen waren auch Gegenstimmen laut geworden, eine massive Schilfreduzierung würde der Natur nicht gut bekommen.
Bartel kniete mehr, als er saß.
Eine alte Schusswunde im Becken, vor Stalingrad erlitten, hinderte ihn beschwerdefrei aufrecht zu sitzen.
Bezirksfischmeister Jochim wunderte sich: „Warum bist du bloß immer gegen den Fortschritt, Wilhelm?” Er strich sehr langsam mit der weißen Rechten über seinen kahlen, roten Schädel.
Jochim versuchte energisch, die Bedenken Bartels zu zerstreuen. Wenn die Bauern so dächten, würden sie mehr Melde und Disteln ernten, als Korn. Man müsse das Unkraut ausrotten, egal wo es vorkommt. Kultur kommt vor Natur!
„Bitte!”, sagte Bartel grob, „dann macht doch gleich, was ihr wollt. Görß spinnt!” Damit erhob er sich. Er ginge nun doch lieber nach Hause. Der Versammlungsrahmen war ohnehin längst gesprengt, die offizielle Schulungsrunde hatte ihren Geist aufgegeben.
Stöckelt, als er bemerkte, dass der Vorsitzende sich nun, wo es konkret wurde, davonstehlen wollte, hielt Bartel am Jackenärmel fest und legte die Stirn in Falten. Warum er nicht auf die Fähigkeiten seiner eigenen Leute baue.
Otto sah sich wie nie zuvor ermutigt, seinen geheimen Intentionen zu folgen.
Mit vermehrtem Eifer legte er dar, was das Kreuz auf dem blauen Untergrund der Streichholzschachtel bedeuten soll. Das sei die Schwachstelle aller bisherigen Unterwasserschnittmaschinen. Es müsse lediglich das gleichzeitige Zusammenwirken des Horizontal- als auch des Vertikalschnittwerkes bedacht werden. Während er so redete, rollte er allerdings wieder verdächtig mit den dunklen Augen.
Stöckelt nickte, als verstünde er.
Er traue ihm das zu. Otto solle sich umgehend an die wichtige Arbeit machen.
Eduard Jochim, der als einziger noch völlig nüchtern war und der voraussah, dass er im Bezirkstag fundiert zu berichten habe, welche Steigerungsraten im Bereich der Fischproduktion zu erwarten seien, hegte natürlich gewisse Zweifel, ob ausgerechnet ein dickschädliger Fischer das zwar dringend anstehende, aber komplizierte Problem zu lösen vermochte.
Andererseits war er froh, dass die Diskussion nun angenehmer verlief.
Wilhelm Bartel möge die Angelegenheit mit Fingerspitzengefühl begleiten. Dieser Görß meine anscheinend wirklich, er sei imstande die Maschine zu bauen. „Du kannst hier nicht kneifen, Willem!”
Wilhelm wollte nicht. Mit ihm war hinsichtlich Karpfenwirtschaft in der Lieps grundsätzlich nicht zu reden. Er könnte aus der Haut fahren. „Wir sind Fänger, und machen keine Kinkerlitzchen!”
Mitten in diese Bemerkung hinein lachte Ernst Stöckelt.
Wilhelm, der immer noch dastand, so klein wie breit, sog verzweifelt am letzten Zentimeter seiner Zigarillo. Erst verbrannte er sich erneut die geschwärzten Fingerkuppen, dann gab er eine Erklärung ab. „Ein für allemal”, begann er so laut, dass alle aufhorchten: selbst wenn sie das Ried denn jemals auf wunderbare Weise um die Hälfte gemindert hätten und wenn er sich denn dazu durchringen könnte, die Bank um Kredit zu ersuchen, gäbe es immer noch riesige Probleme, für die er keine Lösung sieht.
Er hustete gegen den Nikotinreiz auf den Schleimhäuten. Die Satzfische würden sich auf der Lieps nicht halten lassen.
Die zweisömmrigen Karpfen hetzten von der ersten Minute des Einsetzens an wie eingesperrte Tiger im neuen Gewässer umher, den Ausweg aus der Gefangenschaft zu suchen. Das wüssten alle Fachleute. Kleine Karpfen sind reisende Fische. Das kleinste Schlupfloch würden sie finden und auf Nimmerwiedersehen flüchten. Es müssten aufwendige Sperren zwischen dem Tollensesee und der mit ihr durch einen breiten Graben und einen weiteren immer noch intakten Flusslauf verbundenen Lieps gebaut werden.
Viertens... Bartel hob den Ringfinger.
Ernst Stöckelt und Otto Görß ließen übereinstimmend kein weiteres Gegenargument zu.
Mit seinem üblichen ‚Kinnings!’ fuhr Stöckelt den „Genossen Vorsitzenden“ an, der längst noch kein Genosse war, sowie den sich gegen sämtliche Illusionen sperrenden Buchhalter Voß. „Ich bin dafür!“
Zumindest Voß hätte sein Vater sein können.
Biederstaedt strahlte: „Otto bucht die dei Maschin und de Afsperrung. Stümmt dat Otto?” ("Otto baut die Maschine und die Absperrung der Verbindungsgräben zwischen Lieps und Tollensesee. Stimmt das Otto?")
Der Angesprochene nickte Stöckelt zu. Seine Lippen zuckten, denn er war ein ausgemachter Schelm.
Erst vor einer Woche hatte er dem dicken Neumann freundschaftlich den Rücken getätschelt, worüber der sich gefreut und fast geehrt gefühlt hatte. Gerade zu Hause angelangt war der Koloss Neumann jedoch von seiner resoluten Ehefrau Ida dreimal um die eigene Achse geschleudert und laut befragt worden: „Weker hett di de Hosenpot anstickt?” ("Wer hat dir die Hasenpfote an dein Jackett geheftet?")
„Otto!”
Keiner weiter brachte das fertig ihm den Rücken zu klopfen und zu streicheln und ihm gleichzeitig auf die Hinterseite der guten Feierabendjoppe ein Hasenbein zu binden, mit der er dann durch die Neubrandenburger Straßen gerannt war.
Neumann, der wie ich ahnte, was auf ihn zukommt, mäkelte: „Otto, du hesst di övernohmen.” ("Otto du hast dich übernommen.") Sein riesiger Schnauzbart zitterte, seine derben Pfoten nicht minder.
Otto würde immer bevorzugt werden, immer bekäme der das größere Wochenendpaket Frischfische.
„Hei hett uk miehr Kinner as du!” ("Er hat auch ehr Kinder als du!") konterte Biederstaedt grollend.
Aber seine Verwandtschaft sei genauso zahlreich, lautete Neumanns geharnischte Erwiderung.
Doch schon eine Woche später beklagte Neumann sich, er sei schon wieder von Otto betrogen worden.
Biederstaedt verteidigte seinen Freund Görß, der maßgeblich daran beteiligt gewesen war, die Rationen zusammenzustellen. Wütend erklärte Biederstaedt, dann müssten die Fische eben ausgelost werden.
Damit erklärte Neumann sich einverstanden.
Der Augenblick kam. Karl wurde ausersehen, die blinde Justitia zu spielen. Er beugte den gewaltigen Rücken, die imprägnierte schwarze Schürze um den mächtigen Bauch gebunden stand er breitbeinig da. Diesmal, endlich konnte er sicher sein. Horst Gruß, der Augenzwinkerer, hielt dem Ahnungslosen die Lider zu. Karl Neumann presste seine vor Aufregung nassgeschwitzte Stirn in Grußens Arbeiterhände.
„Puck-puck Korl, weker sall dissen Hümpel hem?” )"Puck-puck Karl, wessen ist dieses Packet?"
Karl nannte, nach einigen anderen, seinen Namen. In der Tat der größte Zander wäre ihm zugefallen, hätte in diesem Augenblick nicht der Schalk mitgespielt. Alle nickten und grinsten Zustimmung als einer der beiden Reiniger, den herrlichen Edelfisch gegen ein paar mittelmäßige Barsche und einen Blei austauschte.
„De Düwel salt holen!” ("Der Teufel solls holen!"), entfuhr es Karl Neumann, als er die Bescherung sah. Wieder einmal war ihm das Glück nicht gewogen gewesen.
Er wusste es irgendwie, dahinter steckte Görß. Nur ihm war nicht klar, wie das vor sich gehen konnte. Wie ein Trompeter blies der Muskelmann seine Backen auf und zog los, Unflätigkeiten vor sich hin brummend.
Diesem Görß würde er eines Tages den Kopf nach hinten drehen. Dann hätte er Genugtuung.
„Otto, Düwelskierl, woväll Geld brukst du dorför?”("Otto, Teufelskerl wie viel Geld brauchst du dafür?"), fragte er. Wie aus der Pistole geschossen antwortete Görß: „Höchstens Sössdusendt!” ("Höchstens sechstausend!")
Bartel lachte stotternd. Das könne Ottos Ernst nicht sein. Er musste Platz nehmen. „Miehr nich?”, ("Mehr nicht?") wunderte dagegen Stöckelt sich, „dat löt sich doch moken.” ("Das lässt sich doch machen!") Der Riesenbrocken wollte Wilhelm Bartel im Halse stecken bleiben. Mit solcher ungeheuren Summe vermochte er seine zwölf Männer sechs lange Wochen zu löhnen.
„Wer ist dafür?”, fragte Stöckelt ungerührt. Die Abstimmung zu leiten stand ihm nicht zu.
„Alltohop!” ("Alle zusammen!") erklärte Biederstaedt leichtfertig, weil er Otto liebte. Gewohnheitsgemäß hoben die Mitglieder die Hand. Sablotny und Neumann wussten offensichtlich nicht, worum es ging. Aber da Biederstaedt und Hermann Müller zustimmten, musste es schon seine Richtigkeit haben.
Wilhelm wollte retten, was zu retten war und deshalb im Protokoll zu vermerken sei, dass ihm die Quartalsversammlung der werktätigen Fischer „Tollense”, Neubrandenburg, mit dem Datum des soundsovielten November, den Auftrag übertragen hat, zu prüfen, ob ein Karpfenbesatz in der Lieps vertretbar sei. Zweitens, dass die Anwesenden Otto Görß verpflichteten, eine technische Zeichnung anzufertigen, ehe er über irgendwelche finanziellen Mittel verfügen dürfe ...
Görß fuhr sogleich gegen Bartel und dessen geschickt gedachte Formulierungen: „Quatsch! Zeichnung.” Er tippte auf seinen Kopf. Da drinnen wäre alles klar und außerdem gab es da eine Skizze, die auf seiner Streichholzschachtel. Bartel konterte mit ungewöhnlicher Schärfe: „Nix is! Endwerer orer!” ("Entweder oder.")
Otto wiederholte diese zwei Worte mit Betonung. Er verlange die Freigabe von wenigstens dreitausend Mark oder er stünde für die ganze Sache nicht mehr zur Verfügung. Er wusste, dass Bartel geizig bis zum selbstverhängten Hungerleiden sein konnte. Da hatte der Vorsitzende neulich frierend auf dem Strasburger Bahnsteig gestanden und sich nicht eine Tasse Kaffee gegönnt, weil die ihm zu teuer erschien, obwohl sein Gesicht schon blau angelaufen war. Den Preis bisse er von der Tasse nicht ab. Dabei hatten sie den ganzen Tag schwer und erfolgeich auf dem Haussee gearbeitet.
Otto fühlte für Geizkragen kein Mitleid. „Dredusend!”, forderte er, nun erst recht trotzig. Im Stehen, wankend, die winzige Streichholzschachtel in der Hand, mit glasigen Augen auf das von ihm gezeichnete Kreuz starrend, wiederholte Görß: „Dat watt dat Vertikolschnittwark!” ("Das wird das Vertikalschnittwerk!")
Andere Schwierigkeiten sehe er nicht. Ihm war anscheinend klar, nie wieder würde er seine Kollegen davon überzeugen, dass sie ihm soviel Geld zur freien Verfügung aushändigen müssten. Im Protokoll müsse geschrieben stehen, er bekäme die dreitausend Mark, dafür sei abgestimmt worden.
„Jawoll!”, bekräftigte Fritz Biederstaedt, nach tiefem Seufzer.
Milster holte tief Luft. Neumann ballte die Fäuste. Nur Hermann Müller sah noch Hoffnung. Er tröstete mit Vergleichen. Auch Ernst Peters hätte jahrelang ums Überleben als Pächter gerungen. „Euch steht das große Glück bald ins Haus!“
Tatsächlich standen wir buchstäblich mittellos da.
Ernst Stöckelt zog, nach kurzem Bedenken, die aus seiner Sicht nächste Konsequenz: „Nau ierst Recht!Ji möten de Hälft’ von de Lüd entloten.” ("Nun erst Recht" Ihr müsst die Hälfte der Leute entlassen!")
„Kommt gar nicht Frage!” konterte Göck mit der vollen Autorität eines Mitgliedes der SED-Bezirksleitung Neubrandenburg, der gerade eben den Raum betrat und der sofort begriff um was es ging. Im Sozialismus gebe es keine Firmenpleiten und schon gar keine Kündigungen.
Er selbst, der einsneunzig große Altkommunist, der sich 1956 zum Ehrenfischer und Beschützer der Genossenschaft ernannt hatte, protestierte erneut.
„Möten!" ("Muss!") konterte der Fachmann Stöckelt gnadenlos.
Ich war der Jüngste, außerdem der fischereilich ungebildetste.
Göck sah mich an: Richtig. Mich würde es zuerst treffen. Das war klar.
Und wieder einmal werde ich von vorne anfangen, aber wo? Gedankenberge fielen über mich her.
Da nutzte mir der Status eines Mitgliedes der Genossenschaft gar nichts.
Ökonomische Gesetze sind unerbittlich. Nichts sprach für mich. Zudem hatte es zwischen Stöckelt und mir nicht gerade höflich ausgetragene Meinungsverschiedenheiten in Fragen der SED-Politik gegeben. Was ich von Diktaturen hielt, hatte ich ihn auch aus gewisser Eitelkeit wissen lassen.
Er dagegen stand für harte ‚Disziplin’ ein. Diese übrigens, sollte ihn bald darauf ereilen und ihn hinausbefördern aus seinem hohen Amt, wegen einer scheinbar nur kleinen Affäre, mit einer ein Jahr zu jungen Dame. Da war sie streng die Partei, damals noch. Verführung Minderjähriger war ein Straftatbestand, sobald es leitende Kader betraf umso mehr - wenn es herauskam. Und das eben passierte dem schneidigen Mann.
Nachdem ich im Januar ‘52 meine Lehrerausbildung zum Berufsschullehrer abgebrochen hatte, - einfach weil ich mich außer Stande sah, den Lehrauftrag der DDR zu erfüllen - war meine berufliche Zukunft nun fünf Jahre später, einmal mehr als ungewiss. Gegen den zur Staatsdoktrin erhobenen Atheismus hatte ich mich gestellt. War auch deshalb freiwillig aus dem öffentlichen Leben ausgeschieden und befand mich, wie Erika richtig vorausgesagt hatte, auf der untersten Stufe der Gesellschaft und würde an diesem Tag und von da aus ins Nichts stürzen.
Ich wollte dennoch wer sein und hatte deshalb gegen Stöckelts Ansichten argumentiert. Auch dieser Umstand müsste sich für mich nachteilig auswirken. Sie können gar nicht anders, sie werden mich auf die Straße setzten müssen.
Ich war ratlos.
Aber Hermann Göck nicht minder.
Ein paar Gesichtspunkte wurden noch betrachtet. Es half alles nicht. Das Denkresultat lautete schließlich: von den dreizehn beschäftigten Männern müssten fünf entlassen werden.
In einer weiteren Versammlungspause beriet der Vorstand.
Binnen einer halben Stunde werden sie fünfmal Schicksal spielen.
Ich ging auf den kleinen Hof und sah bewegt die Kähne am Bollwerk liegen. Träge floss das graugrüne Wasser des Oberbaches in Richtung Vierrademühle.
Nun war ich fast achtundzwanzig und stand abermals vor einem Trümmerhaufen. Also doch eine verkrachte Existenz.
Meine Versuche zu schreiben und vielleicht einmal mit dem Schreiben von Geschichten und Reportagen meinen Lebensunterhalt zu verdienen, waren ebenfalls gescheitert. Die Leiter der Arbeitsgruppe “Junge Autoren” hatten mich auf Empfehlung des Friedrich - Wolf - Theaters Neustrelitz zwar eingeladen an den Schulungen für angehende Schriftsteller teilzunehmen, doch sie hatten mich da nach wenigen Wochen Teilnahme gerade erst in diesem Sommer geext. Mit Leuten wir mir, wollten sie nichts zu tun haben. Horst Blume, damals Direktor der Polytechnischen Oberschule „Fritz Reuter”, Alfred Wellm, Joachim Wohlgemuth, Gerhard Diekelmann und andere fanden meine Ansichten und Arbeiten skurril. Im Zusammenhang mit einer Vorlesung über die Leninsche Widerspiegelungstheorie, gehalten von Horst Blume, dem ehemaligen Rechtsberater in einer Hitlerjugendbannführung, nahm ich mir heraus die dominierenden Auffassungen zu kritisieren. Vielleicht wäre es besser gewesen, zu schweigen und nur klug mit dem Kopf zu nicken. Doch ich musste das Maul weit aufreißen und behaupten, dass es nicht allein die Umwelt ist, die den Menschen prägt und bestimmt, sondern auch der Wille nach der Einsicht.
Für mich stünde fest, dass sich jeder Mensch kraft seiner Urteilsfähigkeit für das Bessere gegen das Schlechtere entscheiden kann, wenn er das will und zwar unabhängig von äußeren Einflüssen.
Wie ich das meine?
Vor allem die Möchtegerneschriftsteller lästerten, dann könne ich gewiss auch beweisen, dass es absolut Gutes gibt. Mir fiel ein Goethewort aus dem “Faust“ ein.
"Der gute Mensch in seinem dunklen Drange, ist sich des rechten Weges wohl bewusst."
Die Ablehnung meiner Ideen aus Vorsicht, - nicht aus Gründen der Vernunft - stand den meisten meiner neuen Freunde in die Gesichter geschrieben. Mir schien, sie würden mir zustimmen, aber nur dann, wenn es allgemeiner Konsens wäre. Zumindest ahnten sie, was ich meinte. Ich konstruierte ein Beispiel. Hätten sie Recht, dann wären die meisten KZ-Aufseher ja eher für unschuldig als für schuldig zu erklären.
Ziemlich intensiv haben wir diesen Aspekt diskutiert, zeitweise sogar heftig. Wahrscheinlich erkannten sie mein Bemühen, dem Problem gerecht werden zu wollen. Denn es geht um Schuld und Sühne.
Meiner Überzeugung nach verfügt jeder Mensch in sich über einen untrüglichen Maßstab für Recht und Unrecht. Es ist das moralische Gewissen. Es mag unterschiedlich stark entwickelt sein, doch es ist da.
Vor allem der immer brillierende Horst Blume vertrat gegen mich die Auffassung, dass die Notwendigkeiten vor dem Gewissen rangierten. Er strich mit seinen Lehrerhänden langsam über den sehr gepflegten graumelierten Kinnbart und schaute mich an, wie ein strenger Vater seinen begriffsstutzigen Sohn.
Ich widersprach ihm dennoch und insofern, als ich einwandte, dass Notwendigkeiten vom Gewissen geprüft werden müssten.
Er ereiferte sich. Sein kahler Schädel, seine energischen Züge, seine gewählte Ausdrucksweise, sein ganzes Erscheinungsbild sprachen ganze Bände zu meinen Ungunsten.
Ich wurde zum Ewiggestrigen erklärt.
Alle anderen Autoren gingen mit der neuen Zeit. Daran sollte ich mir ein Beispiel nehmen. Die Kategorien des dialektischen Materialismus müsse schließlich jeder Mensch akzeptieren.
Leute wie ich, die am Alten und noch am Glauben an einen Schöpfergott hingen, brächten bloß nicht den Mut auf, den unmodernen, hinderlichen Zopf abzuschneiden.
Alfred Wellm, der bereits erfolgreich veröffentlichte, beugte sich anschließend zu mir. Freundlich werbend sagte er: „Wir vollziehen in diesem Lande eine Revolution in den Köpfen. Es geht nicht nach dem Gewissen schlechthin, sondern nach der uns zugewachsenen Erkenntnis aus der leninschen Philosophie. Sie macht aus uns starke, staatsbewusste Bürger. Wir wollen etwas aufbauen, das es in der deutschen Geschichte noch nicht gab. Den Sozialismus. Komm zu uns! Wo du hingehörst!”
„Wie sollte ich, nachdem ihr mich nicht überzeugen konntet?”
In Folge dieses Gespräches beschloss der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft “Junger Autoren”, meiner Argumentation aus dem Wege zu gehen.
Das geschah denn auch. Als an jenem Sommertag, 57, im Tagungsort Volkshaus, zu Neubrandenburg von Horst Blume bekannt gegeben wurde, dass es fortan zwei Gruppen geben würde, nämlich: die jungen Autoren, und die jungen Schriftsteller, da vermutete ich noch nicht, dass sie die Stirn haben würden, mich vor die Tür zu setzen. Nachdem zuerst die Namen der Fortgeschrittenen aufgezählt wurden, dachte ich, na, ja, sie werden dich zu den jungen Autoren stecken. Aber als deren Namen verlesen wurden, fand ich meinen wieder nicht erwähnt.
„Warum habt ihr mich ausgelassen?”
Ungefähr dreißig Augenpaare richteten sich auf mich. Eine Weile knisterte es im Raum, wie mir schien. Die Spannung lag wie Gewitter in der Luft.
Ein älterer Mann aus Anklam meinte, sie hätten mich vergessen.
„Nein, wir haben ihn nicht vergessen”, entgegnete Joachim Wohlgemuth, - der das Buch geschrieben hatte: "Egon, und das achte Weltwunder", sowie Horst Blume, der Poet. Letzterer setzte erläuternd hinzu: „Mit dir haben wir nur Scherereien. Geh du deiner Wege! Unbegabt bist du nicht, aber dir fehlt der Zug und das Wollen zum Staatsbewusstsein.”
Ich hörte es als Echo, mit Ausnahme des Anklamers, von sämtlichen Anwesenden.
Dieser eine verteidigte mich.
Ich hätte doch ein beachtliches Drama geschrieben. Die anderen angehenden Schriftsteller wünschten mit mir nicht mehr zu reden. Nicht mit einem Querschläger. Ja, wenn ich mich nicht geäußert hätte. Aber mich immer wieder konträr in die Diskussion einzumischen, das sei zu viel gewesen.
Da musste ein Schlussstrich gezogen werden. Das sei nun geschehen.
Sie waren so tapfer…
Auch die Fischer müssen nun einen dicken Schlussstrich ziehen und reduzieren, das leuchtete mir ein.
Vielleicht könnte ich doch eine interessante Bürotätigkeit finden.
Du doch nicht!
In den Westen gehen?
Meine Frau war prinzipiell dagegen.
Zurück in die Lehrerausbildung? Mein Entscheid war definitiv gewesen.
In dieser langen Beratungspause des Fischereivorstandes ging mir mancherlei durch den Kopf. Ich war und bin für das Zusammenarbeiten der Menschen in Genossenschaften, aber nicht für die Rohheit eines Systems, gegen das sich im Grunde nahezu alle Leute, die ich kannte, deutlich aussprachen. Das könnte ich ja auch für mich behalten, statt es immer wieder herauszuposaunen. Gerade in einer Genossenschaft - nicht in einem volkseigenen Unternehmen - in dem Gewinne restlos an den Staatshaushalt abgeführt werden, konnte ein Großfang oder beständig bessere Fänge allen Beteiligten richtigen Wohlstand bescheren. Abenteuer Fischfang war für mich wie erlaubtes Vabanquespiel. Ich liebte es zu spielen. Deshalb wäre die Fischerei nebst den Berufswünschen, die sich zerschlagen hatten, für mich das Beste.
Ich sah den Genossenschaftsvorstand aus dem Nebenraum kommen. Den Mienen konnte ich ansehen, dass in der internen Runde die Würfel gefallen waren. Biederstaedt und Görß kamen auf mich zu. Sie schauten mich sehr freundlich an: Du bleibst! Einstimmiger Beschluss.
Ausgerechnet die vier Nichttrinker traf es.
Neumann, Milster, Sablotny, Müller. Fast ihr ganzes Leben hatten diese vier als Fänger zwischen offenem Himmel und bewegten Wassermassen zugebracht.
Aus!
Mit einem Mal wurden sie für immer an Land gesetzt. So sahen sie auch aus, als sie das Urteil entgegen nahmen, wie unglückliche Vögel, die besser schwimmen als laufen konnten.
Für die vier über Fünfzigjährigen erhob sich damit dieselbe Frage, die mich schwer bedrückt hatte. Was nun?
Selbst wenn ich freiwillig verzichtet hätte, wäre nur einer gerettet worden.
Doch welcher Name folgte als fünfter?
Das stünde noch offen.
Von einem Tage zum anderen verloren vier Prachtkerle ihren Traumberuf.
Auch Kurt Reiniger der Westflüchtling durfte bleiben.
Ich hatte ihn gleich am ersten Abend meines neuen Fischerlebens, im Juni 56, kennen gelernt: wäre um Haaresbreite von seinem niedersausendem Ruder in dem niedrigbordigen Kahn getroffen worden, - möglicherweise tödlich - weil er glaubte ich hätte ihn mit meiner Wasserschaufel mutwillig durchnässt. Deftige Wasserspritzer von außen waren die Ursache gewesen. Instinktiv handelnd vermochte ich es, in den kritischen Sekunden jener Gewitternacht auf dem bewegten See vor dem drohenden Schatten mich unter den Netzballen zu ducken. Es war ohnehin eine gespestische Szenerie: die zuckenden grellblauen Blitze, das Weiß der Wellenkronen, die schwarzen Umrisse der Männer, das wogende heftige Auf und ab der in Fahrt befindlichen, von einem morschen Kutter gezogenen ebenso verrotteten Fangboote.
Nachdem Kurts Unmut sich binnen Sekunden legte, dachte ich augenblicklich: wie sonderbar: ich bin glücklich. Ich bin da wo ich hingehöre.
Ist es nicht allemal so, dass sich das wahre Leben weniger um uns ereignet, als im Innersten unseres Gemütes. Ja, ich war glücklich., denn ich war frei, ich fühlte, ich werde hier aufsteigen aus dem Elend, es würde mehr Freude in Erikas Leben kommen.
In der auf die brisante Mtgliederversammlung folgenden Nacht wälzte sich der Vorsitzende Bartel unruhig im Bett. Der Sturm war zum Orkan angeschwollen und ließ ihn nicht schlafen. Die riesigen Lindenbäume ächzten und ihre starken Äste knackten. Wilhelm erhob sich und ging ans Fenster. Wind pfiff durch die Ritzen der Fensterrahmen. Er fror und stand sinnend da. Wie sollte er diese Genossenschaft zusammenhalten, wenn seine Männer gegen ihn entschieden? Wie konnte der kluge Stöckelt glauben, Görß meine immer was er sage?
Die brausenden Wellen brachen sich in geringer Entfernung von seinem Wohnzimmer an den Findlingen, die das Ufer am Badehaus säumten. Bartel sah die dunklen Konturen des Waldes und seufzte. Schließlich begab er sich wieder zu Bett. Er starrte die graue Zimmerdecke an, als stünde da der Ansatz für die Lösung seiner vielen Probleme geschrieben.
Ruhe fand Wilhelm erst, als er auf den rettenden Einfall kam, am nächsten Morgen eine Kurzversammlung einzuberufen. Er wird seine Fischer überzeugen, mit dem Genossenschaftskapital sorgsamer umzugehen und nichts zu überstürzen. Otto schulde ihnen erst den Beweis, dass er das, was er wolle, auch umsetzen kann. Den idiotischen Beschluss, Görß dreitausend Mark in die Hand zu drücken, wird er wegen gestriger Unzurechnungsfähigkeit der Mehrheit der Anwesenden kassieren. Zweimal dreitausend sogar, die waren ja verrückt!
Der ernüchterte Otto wird sich selbst ein gehöriges Stück zurücknehmen. Wahrscheinlich wird er zugeben, dass er sich lediglich einen Scherz erlaubt habe.
Der Sturm toste immer noch. Als sowohl die Gekündigten wie die Restmitgliedschaft morgens endlich beisammen war sagte es Wilhelm Bartel direkt: „Otto, was wir gestern im Rausch geschrieben und gepinselt haben, ist vergeben und vergessen.”
„Vertroch is Vertroch!” ("Vertrag ist Vertrag!"), beharrte Görß. Er klatschte die derben Hände zusammen.
Die Gekündigten horchten auf. Vergeblich, wie sich bald herausstellte. Es ging hier nur gegen Otto. Überraschend für Bartel reckte Otto seine Rechte aus: „Wetten?”
In der Tiefe seiner Augäpfel glomm der rote Zorn. Er wollte die Welt umstürzen, und zwar die ganze Welt. Dabei gähnte und lachte er gleichzeitig.
Der unerwartete Wechsel im Mienenspiel seines Gegenübers überreizte den Vorsitzenden. Bartel fuhr ihn an: „Schluss mit den Kindereien.” Otto Görß schüttelte den Kopf ganz langsam. Diesmal nicht! Immer noch hielt er die Hand hin: „Wenn’t nix wat, denn go ick in de SED, wenn’t ever wat wat, denn geihst du inn’ne Partei!” ("Die Wette gilt, wenn es mir nicht gelingt, dann gehe ich in die Partei, aber wenn es was wird dann du!") Bartels graue Augen schielten über den Brillenrand.
Alle schwiegen. Dann musste das Verhängnis eben seinen Lauf nehmen. Er hatte redlich versucht es aufzuhalten.
Ottos immer noch vorgestreckte Hand regte ihn noch mehr auf als der übrige Blödsinn.
Wilhelm verkniff die Augen. Vielleicht wird der Tag kommen, an dem er der SED beitreten muss, aber dann nicht als Verlierer.
Vorsitzender Bartel erreichte, dass Otto Görß bis zur ersten Ausführungsstufe nur zweitausend Mark in bar ausgehändigt wurden. Darüber hinaus erhielt er das Verfügungsrecht über eintausend Mark in Verrechnungsschecks.
Es war seine Pflicht, den Schaden zu begrenzen.
„Rohrspatz sollst du heißen”
Wieder einmal war für Otto Görß, die ein ums andere Mal verlängerte Frist, zur Fertigstellung der Unterwasserschilfschneidemaschine, abgelaufen.
Am Abend des 20. Maitages 58 klopfte es an Wilhelm Bartels Wohnungstür im Badehaus.
„Heiner!”, hörte der Vorsitzende die junge, von Weinkrämpfen geschüttelte Ehefrau seines damals jüngsten Genossenschaftsmitgliedes Mikusch schluchzen. Ihr Heiner sei nun schon seit einem dreiviertel Jahr spurlos verschwunden. Jetzt glaube auch sie, was die Leute ihr zumuteten, er käme nie zurück. Er sei nicht wegen Leichtsinns eingesperrt worden. Er habe sie verraten und sich auf Nimmerwiedersehen in den Westen abgesetzt. Sie suche seinen Rat. Aufseufzend und ratlos musste Bartel jedoch zuerst an Otto Görß denken. Vier lange Wochen hatte Otto sich nicht blicken lassen.
Nahm denn diese Anzahl der Probleme nie ab?
Eine ganze Stunde lang heulte die junge Frau und nervte ihn, während er gegen einen weiteren furchtbaren Verdacht ankämpfen musste. In der Tat. Otto Görß und Mikusch konnten mancherlei gemeinsam haben. „Dreitausend Mark!”, murmelte er, indem er an die Summe dachte, die der Buchhalter Adi Voß Otto teilweise zur freien Verfügung oder in Form von blanko unterschriebenen Verrechnungsschecks ausgehändigt hatte. Schon ganz andere Leute waren so weit gegangen, Rechnungen zu fingieren. Wenn Otto wollte, dann ...
Wilhelm bemühte sich, die niederträchtigen Verdächtigungen, als wären sie Fliegen, zu verscheuchen
Nein! Otto war kein Betrüger. Otto war ein ehrlicher Mann!
Wilhelm Bartel schrumpfte zusammen, als er sich seiner eigenen Nachfrage stellte: Bist du sicher?
Trau, schau, wem. Die Fliegen machten ihn verrückt.
Sehr reuig wiederholte er vor sich selbst: ‚Ich habe mich breitschlagen lassen!’
Was wollte er der kleinen Dame sagen?
Das traf hunderte so.
Er war nicht dafür gewesen, dass Görß sich zum Konstrukteur und gar zum Erfinder aufschwingen wollte. Eulenspiegel wollte auch über den Kirchturm springen. Dem zusammengeströmten erstaunten Publikum erklärte der Narr dann: ‚Na, ja, ich will ja immer noch. Daran liegt es nicht! Bloß, der Kirchturm ist zu hoch.’
Otto könnte allemal beteuern, dass es an seinem guten Willen nicht gelegen habe.
Die Klagende ging schließlich. Halb hatte er sie gebeten, ihn endlich schlafen zu lassen, zur andern Hälfte sah sie wohl ein, dass selbst Wilhelm ihr den Ehemann nicht herbeizaubern konnte. Vorsitzender Bartel entnahm der fast geleerten Schachtel eine neue Zigarillo. Tief in schwarze Gedanken versunken schaute er aufs dunkle Wasser. Von nebenan hörte er die Wanduhr. Es war Mitternacht geworden.
Morgen früh sehe ich nach! Das schwor er sich. Wilhelm litt sehr unter dem plötzlich massiven Selbstvorwurf, nicht eher misstrauisch geworden zu sein. Seiner Aufsichtspflicht war er nicht nachgekommen.
Mit geweiteten Augen lag er im Bett und starrte noch lange an die Zimmerdecke.
Gleich am nächsten Morgen begab Wilhelm sich mit dem blauen LKW “Phänomen” zum Blumenborn, in die Zehdeniker Straße, wo Otto Görß wohnte und angeblich die hochkomplizierte Technik zusammenbaute.
Diesmal wollte er Fakten sehen, schlechte oder gute. Die Zeit der Geduld und der Ausreden war endgültig vorüber.
Ihr Mann sei nicht daheim, sagte Frau Erna leise. Ein wenig gekrümmt stand sie in der Eingangstür des grauen, kleinen Einfamilienhauses. Ihr Otto sei, bereits vor zwei Tagen, nach Waren gefahren. Sie schlug die Augen nieder. Eigentlich müsste er längst zurück sein. Sie wog ihr jüngstes Kind auf dem Arm, während ein zweites und drittes an ihrem Rockzipfel hingen, alle mit großen, dunklen Kulleraugen. Verschüchtert betrachteten die Kleinen den erregt paffenden Eindringling. Beide in den Westen abgehauen! Bartels graue Mausaugen rotierten. Er wehrte sich tapfer gegen die Vorstellung, auch Otto hätte sich davon gestohlen. Doch es galt nun, den unangenehmen Wirklichkeiten ins Auge zu blicken.
Nervös zupfte er an den Blättern einer Spiräe. Er zerrieb sie.
Das also war des Pudels Kern.
Statt es zu Ende zu qualmen, zerbiss Wilhelm sein Zigarillo.
Es war äußerst unwahrscheinlich, dass Otto über Sonntag in Waren blieb. Durchgebrannt!
Hatte er nicht gleich befürchtet, aus dem Vorhaben komme nie und nimmer Gutes heraus? Für Geld und Weiber ließen die Kerle ihr Leben. Otto ist auch nicht besser. Warum auch? Alle sind sie gleich, die blöden jungschen Böcke. Ihm schien, dass er beide Familienväter in einer der grauschwarzen Holzhütten am Bahnhof Zoo sitzen sah, wo sie den Westberlinern vorjammerten: Die Partei hetze hinter ihnen her, wie der Teufel hinter den frommen Seelen.
Wilhelm hustete.
So schlimm traf es nur selten zu. Die meisten gingen nur rüber, weils hier so grau war und der Goldglanz von drüben herüberschimmerte.
Er war einmal in einer dieser Flüchlingsauffangsbaracken in Marienfelde gewesen und hatte dort aus purer Neugierde ein Gespräch mit einem der jungen Angestellten, einem Mitglied der ‚Berliner Falken’, gesucht: „Was wäre, wenn ich mittellos hier ankäme?“ Darauf hatten sie ihm schwach geantwortet.
Ohne Bedeutung war dieses kurze Gespräch geblieben. An die sonderbare Stimmung von damals konnte er sich erinnern.
Dieses düstere Bild, da säße er als Bettler und Flüchtling, und er hätte die Brücken hinter sich abgebrochen, er hätte seinen bunten reichen See hinter sich gelassen und mit ihm ein zwar hartes Leben, aber auch die Vorzüge des auf eigenen Füßen stehenden Fischers.
Nee!
Niemandem würde er je raten, einer blanken Illusion zu folgen. Das Leben wiegt im Westen wie im Osten seine sechsundsiebzig Kilogramm. Denen entkommt man nicht.
Das schöne Geld!
Es zerriss ihm fast das Herz. Er hatte sich zum letzten Mal Anfang Mai um den Fortgang der übernommenen ‚Heim’ - Arbeit Ottos gekümmert und schon damals dieses miserable Gefühl gehabt, dass mehr als nur eine Kleinigkeit nicht stimmte. Otto war niemals imstande eine Bauzeichnung anzufertigen, geschweige denn ein derart komplexes technisches Gerät. ‚Bekloppter Ernst Stöckelt.’
So etwas brockten ihm nur die führenden Genossen ein und die Partei wird obendrein nicht den Verursacher, sondern ihn als Vorsitzenden für schuldig halten, wenn die furchtbare Pleite offen zutage tritt. Versäumnis der Kontrolle. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So nannte man das. Von wegen, was die Partei beschloss, das wird sein.
Nun wird ihn die gerechte Strafe für seine Kapitulation vor der Unvernunft ereilen. Wilhelm fragte nicht lange, er ging an Ottos Frau Erna und ihren schüchternen Kindern vorbei, einfach durch den schmalen Flur in den Hof. Sein Verdacht trieb ihn gewaltsam vorwärts. Aufgeregt zog er eine Zeltplane beiseite.
Das hatte er sich gedacht!
Von Luftikus Otto war erst der glatte Boden des Bootes gelegt, sowie die ersten Spanten und ein bisschen Schrot in die Ecken der kleinen, knapp überdachten Hoffläche gestellt worden, zum Schein und für alle Fälle. Otto hatte die dreitausend Mark eingesackt und war nun ein für allemal verschollen. Wie stand doch gleich der Wechselkurs, den die Westberliner Geldhändler manchmal jede Stunde neu festlegten?
Vierfünfzig Ost für eine Westmark? Blitzschnell hatte Wilhelm es ausgerechnet: schäbige sechshundertundsechsundsechzig Mark West für so einen Berg Vertrauen. Wenn das wenigstens zehntausend gewesen wären.
Da saßen sie also, seine gutgläubige Erna mit den Vieren und die kleine schöne Mikusch.
„Nö!”, entgegnete Erna entschieden, als sie endlich verstand, was der missgelaunte Fischerchef andeutete. „Doch Otto nüch!” und: „Wülhelm schäm di wat!” ("Doch Otto nicht. Wilhelm, schäme dich!")
Wilhelm versuchte es mit einer Ausrede. Er hätte nur Spaß gemacht.
„Över mit Vertrugen mökt man kein’n Spoß!” ("Aber mit dem Vertrauen macht man keinen Spaß!"), tadelte sie ihn.
Ihr Mann suche nur noch zwei Windenräder. Spätestens morgen käme er zurück.
Haushoch war ihr Glaube an ihn, den Vater ihrer Kinder.
Wilhelm blinzelte Erna an. Er wollte ja hinter und vor und neben seinen Männern stehen. Am guten Willen seinerseits lag es nicht. Andererseits war sein guter Wille immer nur die eine Sache.
Nee, die Ottos und Mikusch machten doch, was sie wollten. Wie könnt ihr Frauen nur so leichtgläubig sein? Vertraut doch diesen Windhunden nicht!
Wilhelm hockte anderntags seiner Gewohnheit entsprechend in der Fischereibaracke und studierte die “Freie Erde”. Er las und begriff nicht, was er da buchstabierte. Er könnte heulen. Nichts lief, wie es sollte.
Da ging, im Augenblick seiner furchtbarsten Gedanken, die Tür auf und als käme um Mitternacht die Sonne zum Vorschein, leuchtete Ottos spitzbübisches, helles Gesicht. Sein schiefes Lächeln war es. Das war Otto, wie er leibte und lebte.
Brüderlich spöttisch schaute er in Wilhelms geweitete Augen. Jetzt habe er alles, auch das letzte Schräubchen, beisammen.
Wilhelm schluckte und erhob sich. Er kratzte die buschigen schon von einigen weißen Fäden durchzogenen Brauen, er kratzte über seine schlecht rasierten, eingefallenen Wangen, hob die gefurchte Stirn, atmete tief aus. Im Geiste sah er eine gewisse Baracke in der Nähe von Bahnhof Zoo. Seine gebräunte Stirn zuckte. Aber irgendwo musste doch die ganze Wahrheit stecken.
Ottos ganze Wahrheit lautete, er hätte bisher bloß siebenhundert Mark ausgegeben. Dreißig für Getränke und Geschenke, zweihundert für Holz, Farbe und den Rest für eine Kardanwelle sowie den Dieselmotor und ein paar Mark für das Material vom Schrottplatz, sowie für Transportfahrten. Otto holte seinen Brustbeutel unter dem rotblauen Hemd hervor. Er nestelte daran, nahm dreizehn Hunderter heraus, und blätterte sie hin, auch die Blanko - Verrechnungsschecks.
Als ginge es um wenig mehr als nichts, setzte er hinzu: „Hew ick mi glicks dacht. De brukte ick gornich.” ("Das habe ich mir gleich gedacht, soviel benötigte ich gar nicht!")
In höchstens zwei Wochen liefe das Ding.
Wilhelm, als er das Geld und die Schecks sah, wurde vor Freude schlecht: „Sagen wir in fünf Wochen!”, erwiderte er. Zum Glück konnte niemand seine Gedanken lesen.
Sollte die Zukunft für ihn doch noch Gutes bereithalten?
Der Unterwasserschnitt müsse zwangsläufig vor Sommerbeginn erfolgen, sonst wäre er für die Katz.
Auf der Pritsche des betriebseigenen LKW sitzend, einem Zweitonner “Phänomen”, fuhren wir an jenem Spätfrühlingstag hin zu Otto. Insgeheim hoffend und zweifelnd zugleich tauschten meine beiden Kollegen ihre Gedanken aus. Keiner wagte die Möglichkeit eines Misserfolges ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Wenn Otto etwas in die Hand nahm, dann kam dabei immer ein Erfolg heraus.
Das war vor allem Fritz Biederstaedts Überzeugung. Die Unterwasserschilfschneidemaschine würde wie ein Uhrwerk laufen, dafür stehe er gerade. Aber Biederstaedt nahm Otto ja allezeit in Schutz.
Wir drängelten uns ungeduldig durch den schmalen Flur des Hauses, um das Gerät zu sehen.
Otto hatte alles bedacht, wie es schien.
Da befand sich auf dem kleinen begrünten Hof etwas unter der Zeltplane. Dass es groß war, sah man. Ja, aber, - für Sekunden dachte ich -,war es auch die angekündigte Maschine? Oder ein modernes Kunstwerk, das zu nichts zu gebrauchen war? Ein zusammengeschweißter Schrotthaufen? Da riss Otto die mit dem Seil gezogene Schleife auf und sogleich auch die graugrüne Plane beiseite. Seine braunen Augen leuchteten.
Vor uns stand nun wie eine Selbstverständlichkeit das nur etwa sechs Meter lange Boot. Die Eisenteile waren teilweise mit glänzend schwarzer Nitrofarbe bepinselt. Es war nicht höher als ein normales Motorboot, vielleicht anderthalb Meter breit und am Bug mit dem oft erwähnten Senkrechtschnittwerk ausgestattet, sowie mit der höhenverstellbaren Waagerechtschnitteinrichtung. Otto erklärte uns kurz und knapp wie es funktionieren sollte.
Biederstaedt ging, stürzte fast auf seinen Freund Otto zu, umarmte und schmatzte ihn rechts und links ab, wie die Kremlstaatsmänner auf dem Flugplatz, nach uralter Christensitte, mit dem Bruderkuss, von Grotewohl und Ulbricht begrüßt wurden.
Wenn das kein Grund zur Freude und zum Feiern ist?
Gratulation!
Mönsch Otto!
Nur der Beweis der Funktionstüchtigkeit fehlte noch, und dass die vielen eisernen Einzelteile der Schneidemaschine von diesem Boot auch getragen werden könnten, - und dass der Probelauf gelang, dass sie vollbrachte, was man von ihr erwartete.
Keine langen Reden und Fragen. Die Männer packten das schwere schwarz- und blaubemalte Boot, nahmen es heftig in Besitz, und trugen es stöhnend mit sich, luden es, nachdem der niedrige Zaun zur Straße beiseite geräumt worden war, auf den LKW “Phänomen”.
Die von Anfang an Beteiligten wollten doch sofort sehen, ob alles seine Richtigkeit hat. Ernas Kinder standen aufgereiht neben den roten Polyantharosenbüschen und lutschten gelbe Bonbons am Stiel.
Die hatte der fürsorgliche Vater aus seiner Jackettasche hervorgezaubert.
Erna lächelte still vor sich hin.
Ihr Otto!
Endlich langte der LKW am Bollwerk des kleinen Fischereihafens an. Er hielt unter einer Moorbirke.
Biederstaedt strahlte. Er streckte die Brust heraus. Sein Freund Otto und er!
Weiße Wolken segelten unter dem blauen Himmelszelt. Die gelblichen Halteleinen wurden gelöst. Wilhelm Bartel sprach unbeholfen ein paar Worte. Sehr karg im Lob. Seine leichte Sorge klang hindurch: Otto, hoffentlich geht alles gut.
Von stets einer ‚handbreit Wasser’ unter dem platten Bootsboden sagte er nichts.
„Ich taufe dich auf den Namen: ?” Verlegen schaute Wilhelm herüber.
„Ruhrspatz!”, erwiderte Otto schmunzelnd. Das hatte er ganz vergessen zu sagen. Den Titel auf die schwache Holzhaut zu schreiben, wäre ja immer noch möglich.
„Rohrspatz, sollst du heißen!”
„Und schneiden wie der Teufel”, ergänzte keuchend Hermann Müller, dabei legte er die helle Stirn in tiefe Falten und zog den roten Ballon aus der Tasche, sprühte Balsam in seine Kehle, versteckte das Gerät wieder in seinem grünen Anzugsjackett und hielt sich hinterher den Hals.
Mit einem Ruck, fast so gut vorbereitet wie von einer Helling herunter, sauste der Rohrspatz über zwei Bohlen vom sicheren Trockenen hinein ins weißblaue Nass des Bootshafens. Es platschte. Das Boot tauchte kurz mit dem überladenen Bug ins Wasser und richtete sich wieder auf, so stolz und selbstherrlich wie niemand es vorausgesehen hatte. Blaurotschwarz war es nun und ein wenig komisch anzusehen, weil die Nase des Maschinenbootes zu tief im Wasser lag. “Hurra!”, schrie Biederstaedt, aber nur er. Wir klatschten. Wenn er, Biederstaedt, jemandem volles Glück wünschte, dann Otto. Des Buchhalter Schulter zuckte. Wir ruckten und wogen die Köpfe, Boote, die ihren Bug zu tief ins Wasser tauchten, missfielen allen.
Otto beruhigte. Wenn er selbst einsteigen würde und der Motor ebenfalls im Heckteil zum Tragen käme, dann wäre die Normallage hergestellt. „De ‚Ruhrspatz’ möt leicht gohn!” ("Der Rohrspatz, muss leicht gehen.", erläuterte er uns. Schwere Klamotten könne jeder bauen. Darauf sei es doch gerade angekommen, ein Gerät zu fertigen, das in jeder Hinsicht unschwer zu handhaben ist.
Sofort zog Otto sich seine Schöpfung mit der Fangleine heran und stieg, ganz und gar nicht andächtig, ein. Der Motor wurde eingebaut. Das Anflanschen nahm auch nur wenige Minuten Zeit in Anspruch. Otto holte aus seiner Jacke das Zündpapier, drehte den Luntenhalter fest, steckte die Kurbel in die Halterung, brachte die Schwungräder des wassergekühlten Deutzmotors zum Rotieren. Der Diesel tuckerte los. Als wäre das eine Alltäglichkeit legte der Binnenfischer und gelernte Zimmermann Görs den Gang ein und rauschte los, den Oberbach hinauf. Unter den ragenden Pappeln mit ihren sich leicht im Winde wiegenden Zweigen und Blättern hindurch fuhr er zur “Fläkt” hinauf.
Wir rannten, längst des träge fließenden, graugrün schimmernden Oberbaches, hinter dem Wunderwerk her. Aber da war Otto schon angelangt an jenem riesigen, im leichten Wellenschlag sich wiegenden Simsenfeld, das ohnehin einem künftigen Badestrand weichen sollte. Er schaltete mit verschiedenen Hebeln, versenkte das Horizontalschnittwerk und rauschte nur Sekunden später durchs olivgrüne Dickicht, eine fast zwei Meter breite Schneise hinterlassend. Das war der Beweis. Blaurotschwarz triumphierte und die SED Grundorganisation ‚Stadtmitte’ hätte es auch können, wäre eine gewisse Wette rechtskräftig geworden... Ich spürte das Glück des Lebens. Denn noch an diesem Abend beförderten sie mich vom Hilfsfischer zu ihrem nun anerkannten Genossenschaftsmitglied.
Das kurze Verfahren meines Aufstieges kostete mich zwei Flaschen eines scheußlich riechenden, braunen Getränkes.
Zum zweiten Mal in meinem Leben, nach der von mir nicht ganz freiwillig aufgegebenen Ausbildung zum Berufsschullehrer, hatte ich den Platz gefunden, der mir ebenfalls wie auf den Leib zugeschnitten war.
Mir blieben nun all diese Herrlichkeiten erhalten: die strahlende Natur, der lachende Himmel, das blaue Wasser, die stets sich wandelnde Landschaft, die unerschöpflichen Reichtümer der Seen, die Chancen des Lotteriespiels Fischfang.
Zudem war ich jung und glücklich verheiratet, allerdings immer noch ein Mann fast ohne Ausbildung. Mein Berufsabschluss als Baumschulist zählte nicht und erst recht nicht das abgebrochene Studium zum Berufsschulehrer.
Hier, nur hier, könnte ich mir die Unabhängigkeit meines Denkens bewahren!
An keinem anderen Ort der Welt, hätte ich glücklicher sein können, gäbe es nicht Tollenseheim und wäre von daher nicht der Zwang einer eisernen Konsequenz zu erwarten, der ich bisher nur vorübergehend entronnen war. Denn da gab es immer noch die Vierergig und Leute die ohnehin ihren noch stillen Verdacht gegen mich hegten. Da gab es eine Dozentin die mir nie verzeihen würde sie gedemütigt zu haben. Noch hatten sie das zerstörte Boot wohl nicht entdeckt. Aber wenn, dann würden sie mich verhören und dann galt: Klassenfeinde müssen wie Feinde behandelt werden!
Schon am nächsten Tage sank der “Rohrspatz” auf den Seegrund.
Das hatte so kommen müssen.
Fritz Biederstaedt wollte Otto begleiten und mit ihm hinauffahren zur Lieps. Freudetrunken, aber auch voll der Triumphgetränke begingen die erfahrenen Männer einen simplen Fehler.
Statt das funkelnagelneue Boot sicher anzubinden, nämlich den kopflastigen Bug nicht in die Laufrichtung, hatte Otto seinen “Rohrspatz” umgekehrt ans Heck des Schleppbootes gehängt.
Zuerst ging es gut. Höchstens Windstärke fünf lautete die Wettervoraussage, und so war es. Nur, der Tollensesee, lang gestreckt und windanfällig, zeigte sich wie immer schnell erregt. Schon bei Windstärke vier rollen mitunter bereits meterhohe Wellen, wenn sie bei ‚Unterwind’ aus Südwesten daher geschaukelt kommen.
Biederstaedt und Otto Görß waren nur dreihundert Meter weit hinaus gefahren. Da ereignete es sich.
Ein leichter Schwung hob sie jäh herauf und ehe sie sich dessen versahen, schwappte eine zweite Welle. Der Rohrspatz verschluckte sich sofort.
Bis dahin hatten beide Männer, wie zwei prallvolle Hundertkiloweizensäcke, stur nebeneinander gehockt, jeder mit einer grünen Flasche in der Rechten.
Otto, durch den Schreck schmerzhaft aus der Starre geweckt, schrie nach dem Messer. Biederstaedt griff in die Hosentasche. Tatsch-ratsch, und die zwingend erforderliche Trennung ward vollzogen. Sonst wäre auch das Heck des kleinen Heuers folgenreich überflutet worden.
Der Rohrspatz ging sang- und klanglos unter. „So!”, sagte Otto. Nur dieses eine Wort und drückte seinen entgeisterten Freund Fritz Biederstaedt zurück auf die Ducht. Da solle er sitzen bleiben.
Biederstaedt wollte handeln. Aber was wollte er tun?
Langsam schob und steuerte Otto Görß den Heuer mit einem Ruder zu den aus dem Wasser ragenden Pfählen der nahe gelegenen Zugnetzhenkstelle. Dort befestigte er das Schleppschiff und fiel vorübergehend in Ratlosigkeit.
Otto hätte ein elender Pessimist sein müssen, um ratlos zu bleiben.
Schon von weitem erkannten wir vom Fangplatz Heimkehrenden das Malheur.
Natürlich stellte keiner dumme Fragen. Niemand erlaubte sich gegen das Genie Görß Vorwürfe zu erheben. Das hätte jedem zustoßen können.
Wir legten unsere mit Handwinden ausgerüsteten Fangboote bei. Ankerten vor Ort und halfen. Sogleich zog Otto sich die Kleidung, Stiefel, Strümpfe, vom Leib. Nackt tauchend fand er die beiden Stellen an dem Kahnbord des Havaristen, an denen er in der Tiefe zwei Drahtseile knüpfen konnte, um ihn wieder ans Tageslicht befördern zu lassen. Sein weißer Körper leuchtete verheißungsvoll herauf.
Unsere Winden begannen ihr Werk. Das klappte.
Der „Rohrspatz” tauchte langsam aber zuverlässig auf.
Fritz Biederstaedt, der solange kummervoll und gehorsam auf der Heckbank sitzend abgewartet und vielleicht sogar gebetet hatte, dass es gelinge, sprang vor Erregung hoch. Aus der Entfernung gab er gute Ratschläge, die so überflüssig waren wie Regengüsse in den Tollensesee. Er stieg in eben dem Augenblick, als die Bordwände des wieder neugeborenen Rohrspatzes sichtbar wurden, hocherfreut aufs Schweff des Heuers und riss begeistert die beiden Arme gleichzeitig in die Höhe. Seine und Ottos Ehre waren gerettet.
Die Wucht seiner Gefühle riss ihn hin, er konnte sie nicht mehr beherrschen. Ob es nun das mäßige von Wellen verursachte Wiegen war, oder die Reaktionen seines leicht beeinträchtigten Gleichgewichtsorganes. Biederstaedt wankte. Langsam, als befände er sich, oder wir uns, in der Irrealität eines Traumes, bog sich sein Körper. Biederstaedt beeindruckend großer Kopf näherte sich unwiderruflich den Wogen, während seine Füße sich von den Schweffdeckeln lösten, als seien sie von dort abgefedert worden, wie von einem Trampolin.
Er schlug ein halbes Rad. Das Obere gelangte nach unten und umgekehrt. Seine erste Hälfte verschwand auf schier unwirkliche Weise im See.
Als schwebe eine Feder, sank er hinunter. Gleichmäßig pendelten seine mit pechschwarzen Gummistiefeln bewehrten Beine. Die kraftvollen Waden wedelten wie abschiedwinkende Hände und Arme. Sie wollten durchaus nicht in der Tiefe verschwinden.
Ein letztes Mal ging es her und hin.
Ringsum strahlte das sommerliche Blau. Möwen kurvten harmlos kreischend vierzig Meter über ihm.
Verwundert und rund wie eine Robbe tauchte der prustende Teil des stellvertretenden Vorsitzenden der Fischereigenossenschaft wieder auf. Kaum hatte er Luft bekommen, brüllte er: „Dat sech ick juch!” ("Das sage ich euch!")
Das Wasser gluckste.
Eifrig und ungeschickt strampelnd, aber mit den Jahren geübt darin mit Gummistiefeln zu schwimmen, fand Biederstaedt schließlich festen Boden unter den Füßen.
„Dat sech ick juch”, spottete jemand hinter seinen Urfeind her,
Biederstadt vollendete den Satz: „en för allemol, wenn sopen wat, denn wat nich arbeit’t” ("Ein für allemal, wenn gesoffen wird, wird nivht gearbeitet!"
Das war es, was Biederstaedt stets zum Besten gab, wenn er wieder einmal ins Wasser gefallen war.
Er hätte wohl noch mehr zitiert wäre ihm nicht eine Welle hart über den Mund gefahren.
Tags darauf kam Schulleiter Herbert M. angesaust. Wir verließen gerade den Oberbach, waren gerade am linken Schilfkopf angekommen und fuhren erst mit halber Kraft. Ich stand draußen auf dem Schweff des morschen schwarzen Achtmeterkutters, auf diesen ziemlich verrotteten Deckeln der Wasserkammer, in die stets die gefangenen Fische hineingekeschert wurden, um sie so lange wie möglich lebend zu hältern. M. lenkte das schnittige Vorderkajütboot scharf heran. Er nahm die Fahrt weg und glitt plötzlich sehr verlangsamt auf uns zu. Seine eher dunklen als grauen Augen suchten meine Blicke. Seine Miene besagte, dass er mit mir noch eine nicht gerade kleine Rechnung zu begleichen hätte.
M. geballte Rechte bedeutete mir, dass ich ihm nicht entkäme. Meine Kollegen scherzten.
Sie ahnten ja nichts.
Sie grüßten auf dieselbe Weise zurück, wie sie glaubten begrüßt worden zu sein.
Er rief etwas herüber.
Aber beider Motoren Geräusche und der Wellenschlag ließen nur Wortfetzen hörbar werden.
„Teufel”, hatte er gesagt!
M.machte noch eine scharfe Bemerkung, deren Sinn ebenfalls nur mich betraf und schon war die Begegnung beendet. Meine Mitfischer, die sich in den Fangbooten befanden, winkten freundlich hinter dem Besitzer des Wellenbinders her. Sie fühlten sich gewürdigt. Der große Chef von Tollenseheim hatte sie beachtet. Ich indessen dachte: Herbert M. musste endlich die zerstörte Vierergig entdeckt haben.
Die schlagartige Zunahme meines Unbehagens blieb meinen Kollegen verborgen. Mir war klar, es würde zu einer unangenehmen Befragung kommen. Exhausmeister Paul würde auf
‚Teufelkommheraus’ leugnen und Herbert M.dürfte mir mit harter Stimme ins Gesicht hinein schmettern: „Haben wir sie doch noch erwischt! Deshalb also sind sie damals getürmt! Deshalb der Wiesenbrand. Sie sind sich doch hoffentlich dessen bewusst, dass wir auf Schadensersatz klagen werden.” Ich schaute dem elegant gekleideten Schulleiter besorgt hinterher.
Einmal, während meiner Tollenseheimzeit, als Herbert M. den LPG-Buchhaltern seinen Einführungsvortrag hielt, hörten wir seine markigen Worte durch die Tür dringen:
„Die verfluchten Imperialisten haben vor, die Welt in Brand zu stecken, um die Spuren ihrer Verbrechen zu vertuschen.”
Ich war ebenfalls ein Brandstifter, einer, der vertuschen wollte.
Vom Klassenkampf redete er am liebsten. Reden konnte er wie kein Zweiter, aber auch klassenbewusst handeln. Die Klasse schöner, liebesbedürftiger Mädchen war ihm die liebste, die Klasse der Brandstifter die verhassteste.
Jetzt zeigt er mich doch noch an.
Während der einen Fahrstunde über den blauen See nach ‚oben’ in den Bereich der Fischinsel beruhigte ich mich allmählich. Das wird er sich dreimal überlegen, mich anzuzeigen. Erstens käme es dann an die berühmte ‚große Glocke’, dass er staatliche Mittel zu eigensüchtigen Zwecken fehlgeleitet hatte. Zweitens würde ich es darauf ankommen lassen und im Falle eines Gerichtsverfahrens darauf bestehen, Paul und mich versuchsweise je einen Messstab werfen lassen.
Natürlich war das alles nur theoretisch von Belang, denn falls die Dozentin für Philosophie befragt würde, sah es für mich trübe aus. Wer Lenin beschimpfte, der konnte nur im Auftrage des Klassenfeindes handeln. Das Gesetz zum Schutze des Friedens sprach mich in jedem Falle schuldig.
Drei Wochen lang, nach dieser ihrer richtigen Taufe, schnitt die Unterwasserschilfschneidemaschine den Weg frei für einen späteren Aufstieg der Tollensefischer aus dem Elend zu bescheidenem Wohlstand. Aber das sollte noch dauern. In der Fischerei bedarf es von der Saat bis zur Ernte manchmal fünf bis zehn Jahre Geduld, vor allem wenn es sich um Aale handelte.
Noch war erst der Grund gelegt für eine neue, bessere Zeit.
Noch sah es trübe aus.
Noch hatten wir nicht einmal die Talsohle erreicht.
Am Jahresende erfuhren wir von unserem Buchhalter Voß, dass der Finanzplan zwar mit 110 Prozent erfüllt worden sei, dass jedoch keine Aussicht bestand, den Jahresverdienst von vier auf viereinhalbtausend Mark zu erhöhen.
Nun gut, für unsere beiden je 10 Quadratmeter kleinen Stübchen, bezahlten wir ja auch nur zehn Mark Monatsmiete. Schuhe allerdings kosteten immer noch einhundert Mark, ein Dreipfundbrot neunundsechzig Pfennige. Schokolade gab es, aber die Qualität war, verglichen mit Sarotti, miserabel. Vier Mark musste man in einem Geschäft der HO für eine Tafel hinlegen, und das war viel Geld für jemanden, der nur dreihundert im Monat nach Hause brachte. Einen Anzug konnte man für fünfundsiebzig Mark kaufen, der allerdings sah dann auch aus wie ein Gewand aus Sackzeug. Mit mindestens zweihundert Mark musste man schon rechnen, wenn es etwas einigermaßen Gutes sein sollte.
Daheim in den eigenen vier Wänden waren wir glücklich.
Görß hatte die Winden umgebaut. Motoren zogen nun die Netze. Folglich konnten die Netze nun größer werden.
„Richtig!”, bestätigte Fritz Reiniger. „Genau das werden wir jetzt machen.” Was bis dahin fast ängstlich vermieden wurde: ein Zugnetz von der ungeheuren Länge von zweimal siebenhundert Meter Länge wurde aus vielen schlecht zueinander passenden Teilstücken zusammengesteckt. Damit gingen die Erfahrenen das Risiko ein, es in den Morast zu fahren und zu zerfetzen. Aber angesichts der noch nicht gebannten Katastrophe widersprach niemand. Bloß noch sechs Wochen, dann kam der Winter.
Es musste gewagt werden auf der Lieps mit einer Gesamtlänge von mindestens 1 400 m Netz zu fischen. Die Lieps ist flach, nur zwei bis höchstens zweieinhalb Meter tief, ihr Untergrund von weicher, toniger Beschaffenheit. Wenn Wadenstücke von dieser Länge eingesetzt werden, muss die Unterleine so präpariert sein, dass die Beschwerungssteine sie während der Zugphase nicht ins Bodenlose hinabreißen. Das leichte Zeug gehörte in den Sackbereich, das schwerere nach vorne. Das Unterwassergewicht der Leinen und der Netzteile muss beachtet werden.
Sonst kann es passieren, dass die Drahtseile wie Zwirnsfäden reißen. Statt einer Tonne Last zerren unter Umständen drei- vierfache Kräfte an den Windentrommeln und können sie aus der Verankerung katapultieren. Das kann zu tödlichen Unfällen führen. Vorschriftsmäßig, nachdem wir es ausgerudert und ausgesetzt hatten, kam das riesige Umfassungsnetz im Halbkreis heran. Der beste Großzug, Lohwiek genannt, war von den alten Meistern ausgewählt und angelegt worden. Wir spürten den gewaltigen Druck, der auf dem Drahtseil, dann auf den Dederonleinen, lag.
Es kam der Augenblick des Netzeinholens.
Große Fische erschienen auf den Seitenstücken des Garns. Ein gutes, stets mit Spannung erwartetes Omen. Wir ahnten nicht, dass in vierhundert Metern Entfernung ein Teilstück des Zugnetzes
bereits zerfetzt worden war. Auch hatten wir noch keine Erfahrungen mit den gerade aufkommenden synthetischen Leinen, die sich, noch nicht mit dem Zusatzstoff Lanon als Antidehnungsmittel versehen, wie ein Gummiband strecken ließen. Da es im Fortgang nicht zur Entspannung der Leinen kommen konnte, speicherte sich der Druck auf den Trommelwinden. Das wäre nicht weiter schlimm gewesen, hätte sich dieser Gesamtdruck nicht auch auf die Seiten, auf die Führungsscheibe der Windenrolle ausgewirkt.
Mit Krachen und Tosen eines Paares jäh aufeinander gedröhnter Schellenbecken riss nach einer halben Stunde die sechzig Zentimeter breite Führungsscheibe von der Trommelwinde meines Arbeitskahnes ab. Einige Schlaufen der Windenleine rutschten hart klatschend auf die Antriebswelle. Augenblicklich würgten sie den Motor ab.
Nun war guter Rat teuer. Eine Schnellreparatur unmöglich. Von Hand ließ sich der immer noch beträchtlich lange Rest des Zugnetzes nicht einholen. Wechselseitig musste nun die Winde des anderen Kahnes das Netz heranziehen. Dieser Umstand änderte die Winkel.
Die Netzwände wurden nun gegeneinander bewegt. Sie klappten zusammen. Die Fische, die sich im Umfassungsbereich aufhielten, fanden keinen Raum mehr, sich frei zu bewegen. Statt sich im Wadensack, der sozusagen als Sammelbehälter dienen sollte, zusammen zu finden, zwangen die Umstände die eingekreisten Fische im Aufzugsbereich unter den Zugnetzleinen und wo sonst noch möglich auszubrechen.
Hätten wir aufgeben sollen? Es dunkelte bereits, als die letzten Netzteile eingeholt wurden. Da erst bemerkten wir die zerfledderten Netzteile. Sämtliche Fische werden durch diese riesige Lücke geflohen sein.
Das mussten wir annehmen und befürchteten. Umso größer die Überraschung. Wir bemerkten, dass der Wadensack breit dalag. Das bedeutete, wir hatten allen Widrigkeiten zum Trotz wahrscheinlich gut gefangen. Biederstaedt lobte Wilhelm Bartel, der in den Wadensack eine “Kehle”, gewissermaßen einen Trichter aus raffiniert geschnitten Netzstücken eingebaut hatte. Wenn sich eine bemerkenswerte Menge Fische im Sack befinden sollte, dann mussten sie sich vor dem Zusammenschlagen der Netzwände, sogar vor der Zerfetzung unserer Netzseite dort eingefunden haben. Ich sah aufgeregt wie es “qualmte”. Große Fischmengen wühlen und wirbeln über weichem Seegrund die Morastmassen auf. Das war allemal ein sicheres Zeichen für beachtlichen Erfolg. Wie sich herausstellte, hatten wir fast einhundertundzwanzig Zentner (sechs Tonnen) Hechte, Zander sowie große Karpfen und Brassen gefangen, dazu stattliche Barsche sogar Schleien. Bis es völlig dunkel wurde, kescherten wir die Qualitätsfische aus dem unversehrten Wadensack und freuten uns wie Schuljungen, die unverhofft statt einer Fünf auf dem Zeugnis ein Lob bekamen.
Dieser unter enormen Handlungsdruck ausgewählte Wadenzug und einige andere halfen uns zu überleben.
Otto Görß allerdings überraschte uns. Er kündigte anderntags. Er nannte uns seine Gründe nicht. Vielleicht suchte er eine größere Aufgabe.
Binnen Jahresfrist wurde er als DDR-bester Raupenbaggerfahrer ausgezeichnet. Das und wenig später die Anzeige von seinem plötzlichen Tod, lasen wir in der Zeitung.
Wäre uns nach diesem Zufallszug nicht gelungen eine Wende herbeizuführen, hätten die Oberen des Bezirkes die Produktionsgenossenschaft werktätiger Fischer “Tollense” wahrscheinlich liquidiert. Benachbarte Betriebe wie die Genossenschaft “Müritz”, mit Sitz in Waren, hätten uns übernehmen müssen. Dann wäre es mit unserer Selbständigkeit aus gewesen. Wir hätten uns den Weisungen Fremder fügen müssen. Dann wäre aus der Oase Fischerei für mich ein Arbeitsplatz wie jeder andere geworden. Deshalb schwor ich mir, mich dafür einzusetzen, dass wir nie wieder in eine ähnlich gefährliche Situation geraten würden. Ich kämpfte für den Erhalt meiner Unabhängigkeit.
Doppelt dringlich hieß es deshalb, das kommende Jahr gut vorzubereiten. Nicht eine einzige Chance, die sich uns bieten könnte mehr zu fangen, durfte ausgelassen werden.
Erster Schritt dazu war die vermehrte Produktion hochwertiger Fanggeräte.
„Ein Fünftel des Umfangs ist die Kehlenlänge!”
Diesen Grundsatz der damals üblichen Reusenherstellung bläute mir Wilhelm Bartel ein. Er war der erste von zehn, die ich lernen musste, ehe ich mit dem Messer ins maschinengestrickte Maschenzeug hineinschneiden durfte.
Ich musste und wollte lernen große Geschirre anzufertigen. Man hat ja nur weiße Netzballen vor sich liegen. Wie ein Schneider steht der Fischer vor den nicht weiter vorbereiteten Stoffbahnen. Ich lernte, dass man durchgehende Diagonalschnitte anwenden kann, um dann durch Zusammenstricken der nun um 90 Grad gedrehten Teilstücke aus den großen Rechtecken mit ursprünglich rhombisch stehenden Maschen quadratisches Ausgangsmaterial herzustellen. Daraus resultieren bei entsprechender Berechnung Reusensysteme, die nicht von Rundbügeln sondern nur mittels Leinen offen gehalten werden.
Zum ersten Mal in meinem Leben arbeitete ich auch an Sonnabenden bis zehn Uhr abends. Als wir die Reusen nach Eisabgang Anfang April in den See einbauten und wenig später die Bungen auf dem Barschberg auslegten, konnte ich in den ersten Nächten vor Aufregung kaum einschlafen.
Was brachte uns die neue Wirtschaftsweise ein?
Ich rechnete vom ersten Fangtag des neuen Jahres gewissenhaft mit. Frei bleiben hieß, ich musste Erfolg haben.
Bald darauf kamen Brassen (Bleie, die Peters reich gemacht hatten) aus der Mode. Kaum jemand interessierte sich für Fische dieser Art. Aus Hausfrauen waren nahezu ausnahmslos Werktätige mit Kantinenverpflegung geworden. Wer außerdem wusste noch, welche Köstlichkeiten aus entgräteten Bleien zubereitet werden konnten?
In der Entwicklung der DDR hatte es jedoch, wirtschaftlich, einen Sprung nach vorne gegeben. Das wirkte sich mehrfach positiv aus. Immerhin schrieben wir schon das Jahr 1959.
Wir erhielten zusätzliche Seen zur Bewirtschaftung und mit ihnen kam Meister Hermann Witte, der Woldegker, das Unikum. Auch er wollte heraus aus der Armut, unbedingt, denn seine treue Meta hatte ihm eine Tochter geboren.
Nach guten Fängen im Sommer stellte sich statt einer ruhigen Herbstwetterlage ab Anfang September eine Südwestwindsituation ein, die leider stabil blieb. Nichts regt den Tollensesee mehr auf als eben das. Bei Stärken um sechs bis sieben, kochte das Wasser im zehn Tiefenmeterbereichen.
Wegen der riesigen Buchen und Mischwaldbestände die auf den langgestreckten Hügeln gut gediehen strömten die Herbstwinde wenn sie eben vom Südwesten kamen wie durch einen sechs Kilometer langen Kanal mit zunehmend verstärkter Wucht.
Noch hatten wir den bestellten neuen Kutter nicht, noch nicht die neuen höherbordigen strapazierfähigen Arbeitsboote. Jedenfalls war es nicht angeraten mit den halbverfaulten Booten durch die Zone des aufgewühlten Seebereiches, durch die Bandung, zu stoßen.
Nach zehn Tagen vergeblichen Wartens auf Wetterbesserung traf ich den Entschluss es doch zu wagen.
Vositzender Bartel sah was ich vorhatte. "Ich verbiete dir rauszufahren!"
Das sei Wahnsinn. Ich hätte ja keine Ahnung. Vier weitere Mäner um Hermann Witte nickten mir zu. Eigenlich hätte Hermann mir Berufsfremden vorgesetzt sein sollen, aber er ordnete sich freiweillig unter - bis ich einen größeren Fehler begehen würde.
Wir beluden die Fangboote mit dem großen Garn. Es war ein Umfassungsnetz von zwei Flügeln von je 300 m Länge bei einer Netzhöhe von 13 Metern.
Ich hatte Wittes Unterstützung sofort gewonnen, nachdem ich ihm meinen Plan erklärte: Wir lassen die Arbeitsboote nicht , wie sonst üblich, nebeneinander laufen (weil der Sack in dem sich die Fische zuletzt befinden mittig angeordnet ist), sondern die ganze Fuhre werden wir durch Seile verbinden, so dass Beiboote und Arbeitskähne hintereinander laufen. Wir werden, um den Starkwellen zu widerstehen, je fünf Meter Abstand von einem Boot zum andern zu halten. Dann können sie schaukeln wie sie wollen, der Sturm hält sie auf Kurs.
Bartel ballte die Faust. "Ich mache dich darauf aufmerksam, dass du gegen meinen Willen rausfährst. Ersäuft das Ganze bis du schuld. Säuft ein Kahn ab oder zerbricht er, haftest du!"
Als wir den Oberbach verließen und in den Dreimeterwellenbereich kamen stauchten uns zwei harte Schläge. Zu Fünft befanden wir uns in der dunklen Kabine. Kurt Reiniger stand am Steuer. Sein Faltengesicht blieb ruhig. Er hatte schon Schimmeres erlebt. Nach wenigen Minuten sehr langsamer Fahrt in denen wir beständig die Blickrichtung wechselten sahen wir dass wir bei knappem Schritttempo immerhin noch alles in Ordnung fanden. Natürlich konnten man das letzte Boot entweder oben auf dem Dreimeterwellenberg sehen oder gar nicht.
Nach einer viertel Stunde schien es so, als hätten wir es geschafft. So war es .
Oben am See-ende angekommen stellten wir überrascht fest, wie die hohen Pappeln den Wind der letzten dreiundert Meter brachen.
Das Zugnetz wurde wie üblich ausgefahren. Uns umgab tiefster Friede.
Als hätten die Urgewalten kapituliert holten wir das Netz ein.
Wir fingen 5 Tonnen Fische erster Qualität, Hechte, große Barsche, Schkeie, sowie erste Klasse Plötzen (Rotaugen), die damals noch in Berlin gut gefragt waren.
Der brüchige Kutter wurde randvoll gefüllt.
Natürlich ließen wir die Arbeitsboote vor Ort.
Es dunkelte sehr als wir heimfuhren, geschoben auch vom noch sausenden Sturm, diesmal ungefährdet. Nur die Brandungszone noch. Dann hatten wir es vollbracht.
Kurt Reiniger meisterte es, durch geschicktes Manovrieren.
Wir sahen Wilhelm, unseren Vorsitzeden in der Finsternis dastehen. Erkenntlich am Glimmen seiner unvermeidlichen Zigarillo und dann den schwarzen Umrissen. Er wird durch schreckliche Ängste gegangen sein, denn andere Produktionsmittel als dieses Zugnetz gab es zunächst nicht.
Als der sieben meter lange Kutter im Oberbach wendete und am verfaulten Bollwerk anlegte, aber noch während der knallende Dieselmotor lief, schnarrte der Vorsitzende mich heftig an: "Wo sind die Arbeitskähne?"
Ich beruhigte ihn. Dann mit einem federnden Satz sprang er herunter und riss den ersten Schweffdeckel auf (Der Kutter hatte drei wassergefüllte Sektionen mit einem Volumen von etwa 1.8 Kubikmeter.)
Bartel ließ sein Zigarillo aus dem Mund fallen, dann riss er den zweiten und den dritten Deckel auf. Fünf Tonnen Fische. Loben durfte er allerdings niemanden.
Er sagt kein Wort und fuhr davon, offensichtlich verwirrt und zugleich erleichtert.
Der Sturm hielt noch weitere sechs Woche an. Und wir fingen im Windschutz der Riesenpappeln vor Nonnenhof weitere fünfundzwanzig Tonnen beste Fische. Der Buchhalten und meine Kollegen tätschelten mir den Rücken.
Von dieser Zeit an, hat mich, außer selbstverständlich Hermann Witte, niemand mehr wegen meines Glaubens verspottet. Das war aus. Definitiv.
Wir insgesamt neun Fänger erzielten zum ersten Mal seit Jahren einen beachlichen Überschuss, nämlich vierundzwanzigtausend Mark. Das ergab eine Barauszahlung für jeden von 2400.-Mark. Was das bedeutet, kann nur ermessen, der weiß, dass DDR-weit Spezialisten in der Industrie erst seit Januar 1956 durchschnittlich 437 Mark monatlich verdienten.
Nun, da wir von nun an fünfhundert Mark Monatslohn nach Hause trugen, begannen auch die ersten von uns an mehr, viel mehr an sich selbst und damit an eine kommunistische Zukunft zu glauben.
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Gruß, dem Aussehen nach zur Hälfte eine Sinti um die dreißig war besonder eifrig. Bislang war er durch sein Schweigen aufgefallen, nun Besitzer eines neuen Motorrades trat als erster der SED bei, ich glaube, mit ehrlicher Überzeugung.
Er wurde nie wieder wankend. Die anderen Männer in unserer Fischerei fühlten sich vor allem von der plumpen Propaganda und von Agitatoren wie dem Rundfunkkommentator Karl-Eduard von Schnitzler abgestoßen.
Das Ostradio nahm seine, ihm vom Parteiapparat vorgegebene Aufgabe immer sehr ernst: Ohne SED-Begleittöne hätte kein LPG-Bauer auch nur eine einzige Kartoffel richtig legen können. Das Granulieren von Superphosphat war ein Schlag gegen den Imperialismus. So der Bauernfunk, so stand es auf den Plakaten geschrieben. Der Bäcker sollte morgens um drei Uhr beachten, dass die DDR der bessere deutsche Staat war. Undenkbar, dass bei uns ein Handwerkergeselle politisch unmotiviert arbeiten konnte. Wenn der Dreher aus einem Rohling eine Präzisionswelle herausspanen wollte, dann konnte ihm das nur gelingen, weil er den Frieden liebte.
Lückenlos dehnte sich das Propagandanetz über unseren zweifelnden Häuptern aus. Die Wolken der Ideologie, die uns stets einhüllten waren gefüllt mit Banalitäten, Lügen und Verheißungen auf das in kommunistischer Ferne liegende Paradies.
Schüler lernten im Fach Mathematik die DDR lieben, weil sie angeblich berechenbar sei. Ihr Anspruch war, der erste Friedensstaat in der deutschen Geschichte zu sein, was sie aber nicht
daran hinderte die militärische Aufrüstung mit äußerster Kraft voran zu treiben. Es hieß allemal: der Friede muss bewaffnet sein.
Nur, wenn die Sechzehnjährigen die zehnte Klasse der polytechnischen Oberschule verließen und mit der rauen Realität des sozialistischen Alltags konfrontiert wurden, erlitten nicht wenige einen Schock.
Altkommunist Hermann Göck wünschte sehr, dass wir uns an Horst Gruß ein Beispiel nehmen sollten und der Partei beitreten. Für ihn war es unfassbar, dass wir werktätigen Genossenschafter hartnäckig bei unserm Nein blieben.
Natürlich muss es an feststehende Grundsätze geknüpfte Ideen geben. Aber niemals dürfen Prinzipien schließlich wie sausende Knüppel wirken.
Es können logischerweise nur die kombinierten Ideen von der Unantastbarkeit der individuellen Entscheidungsfreiheit und der liebevollen Wahrhaftigkeit sein, die uns helfen, glücklicher zu werden.
Ausgerechnet ein Altgenosse bewies mir, in diesen Tagen, dass ich mich in diesem wichtigen Kritikpunkt nicht irrte.
Ernst Kay, hieß dieser Mann, ein durch Schicksalsschläge klug gewordener Junggeselle, der mir bestätigte, dass wir ein Organ für die Wahrheit haben. Er wusste um eine für unser aller Urteilsfähigkeit höchst wichtige Sache.
Etwa Jahrgang 1900 gehörte er der Werkleitung des Panzerreparaturwerkes Neubrandenburg an, genannt RWN. Er war für den Bereich innere Sicherung mitverantwortlich und wenn wir am Ostufer des Tollensesees fischen wollten, begleitete er uns häufig. Er oder einer seiner Männer ‚bewachten’ uns. Groß und hager kam Ernst Kay auch an jenem Frühlingsmorgen des Jahres ’60 daher. Er wirkte fast zerbrechlich und schritt doch sicher. Fest setzte er die langen Beine auf den Boden der Tatsachen. Ernst war mehr als hager. Er ging leicht gebückt.
Aus kleinen, mausgrauen Augen schaute er offen in die Welt. Ihm machte man nichts vor. Unausgesprochen hieß das: Ich, Ernst Kay, bleibe, wer ich bin. Zahllose Riefen und Kniffe kreuzten die gebräunte Haut seines langen, schmalen Gesichtes, dessen kämpferischer Ausdruck für einen Kommunisten typisch zu sein schien. Er trug an diesem frischen Morgen eine graue, ein wenig zu große Schiebermütze. Sie hing auf seinem linken Ohr. Ernst konnte sowohl unentwegt reden wie auch ebenso wirkungsvoll schweigen. Die Hose baumelte so lose an seinem dürren Leib, dass man befürchten musste, es sei in diesem Stock kaum Leben. Aber man täuschte sich. Seit fast drei Jahren kannte ich ihn. Sein Sohn war so alt wie ich. Vielleicht gab das den Ausschlag. Vielleicht hätte er mich sonst gar nicht beachtet. Denn er konnte ziemlich schroff werden, wenn ihm jemand nicht gefiel.
Der Kuttermotor dröhnte. Der neue, grüne Kutter aus Lärchenholz gebaut, setzte sich wieder in Bewegung. Das Wasser spritzte.
„Na!”, fragte Ernst, „wü geiht di dat, mien Söhn?” ("Na, mein Sohn, wie geht es dir?") Vielleicht gefiel ihm, dass ich ihm gern zuhörte. Ich musste hören, ich musste wissen. Irgendwann ist der Tag herangerückt, an dem man es genau wissen will.
Ob es die Zeitung dieses Tages war oder ob ich sie für den Zweck aufgehoben hatte, ihm eine wichtige Frage zu stellen, weiß ich nicht mehr. Dass ich ihm das ND mit einer gewissen Schlagzeile vor die Nase hielt, ist wahr.
Da verkündigten die Lettern: „Nikita Sergejewitsch Chrustschow: Für eine Welt ohne Waffen!” Ernst Kay warf nur einen müden Blick auf die Schlagzeile. Mit jener ungeheuren Selbstverständlichkeit, die gewisse Wirklichkeiten eben begleiten, grummelte er nur zwei knappe Worte heraus: ”Hei lücht!” ("Er lügt!")
Auch ich war vom Text beeindruckt worden, ich war im Begriff gewesen, Chrustschow Glauben zu schenken!
Hei lücht!
Wenigstens guten Willen wollte ich dem neuen Kremlherrn unterstellen.
Hei lücht!
Ernst schaute mich unnachahmlich an, ein wenig spöttisch und überheblich, aber auch fragend und vieldeutig. Was ist? Du wolltest doch die Wahrheit von mir hören oder etwa nicht?
Das sind die Worte die die Macht der Wahrheit tragen.
Seine Blicke sagten: So dumm bist du doch nicht, mien Söhn!
Wie überrascht ich war, von einem Mann der sich selber als Kommunisten bezeichnete, zu hören, dass er seinem Generalsekretär kein Sterbenswörtchen abnahm. Das sah mir der alte, kluge ‚Genosse’ gewiss an.
Er aber, gleichmütig, als gieße er ein Glas Wasser in den See, erklärte er: Weder Trotzki noch Lenin, kein Tuchatschewski und niemand im Politbüro der KPdSU hätten jemals, in Friedenszeiten, dermaßen brutal auf militärische Rüstung gesetzt wie Chrustschow.
Die Vokabel ‚brutal’ drang tief in mich wie Eiswind durch die Haut.
Diese Vokabel stand aber auch vor mir wie ein Bandit mit einem Schlagring.
Ich fasste noch einmal nach, doch Ernst Kay verweigerte sich mir diesmal. Er langte in seine Jackettasche, holte eine kleine Flasche heraus.
Seelenruhig und mit dem Ausdruck der Erwartung von sehr Gutem schraubte er die silbern schimmernde Kappe ab. „Prost!” Er trank etwas, das wie Wasser aussah. Ernst Kay betrachtete den Rest des Inhaltes traurig und steckte das durchsichtige Gefäß zurück, wo er es hergeholt hatte. Aus Frauen und Militärs mache er sich nichts mehr. Für ihn sei die pünktliche Einnahme seiner Seelenmedizin immer noch das Wichtigste. Ob wir, mit unserem großen Zugnetzgarn, viel oder wenig fingen an diesem Tage weiß ich nicht mehr. Ich vermute, ich vergaß über Ernst Kays Offenbarung die obligatorische Eintragung ins Fangbuch.
Darin hielt ich sonst fest, was wir wo unter welchen Wetterbedingungen gefangen hatten. Vor meinen inneren Augen sind zwei stattliche, grünrot schimmernde Barsche. Die nahm Ernst Kay mit, um sie sich auf seiner Jungegesellenbude im RWN zu braten. Mehr brauche er nicht, einer war zuwenig, drei zuviel. Ernst winkte kategorisch ab. Immer mit nicht gerade kleinen Gesten.
Das war er. Wie ein leibhaftiger Rohrspatz konnte er auf die Kapitalisten schimpfen. Er vergaß jedoch nie seinen eigenen Genossen einen Satz ins Stammbuch zu schreiben. Der lautete: „Ji sünd uk nich better!” ("Aber ihr, ihr seid auch nicht besser!")
So war das Leben. Wer sich nicht selber disziplinierte um bei der Wahrheit zu bleiben, der hatte keinen Anspruch auf ein Lob von Ernst Kay.
Er ließ sich nicht beirren, im Osten gäbe es nicht weniger Schweinehunde als im Westen. Wer sollte sie gebessert haben? Er schob sein Kinn nach vorne. Ernst Kay kannte die Welt. „Hauptsok ick!”
("Hauptsache: ich")
Das verstand ich. Ihn ärgerte das. Jeder war sich hüben wie drüben der Nächste. „Ümmer ihrlich blieben!” ("Immer ehrlich bleiben!"), pflegte Ernst zu sagen.
Ehrlich gesagt, er wird so manches Mal angeeckt haben.
Kritische Genossen hatten nie einen leichten Stand. Sie mussten mit dem Grundkonflikt leben, ihre Ehrlichkeit gegen die unrichtige Behauptung der Partei zu stellen, sie handele stets im Auftrage des werktätigen Volkes, denn dieses Volk hatte keine Meinung, außer in den direkten Fragen nach dem persönlichen Wohlergehen. Deshalb war der Anteil halbabtrünniger Altgenossen so hoch. Tatsache war ebenfalls, dass Nikita S. Chrustschow auf diese Weise in unsern Köpfen eine Hauptrolle spielte. Fast süchtig, sammelten wir biographische Daten wie diese:
während seiner USA-Reise 1959 schloss er bei der Besichtigung einiger Musterfarmen leichtfertig Wetten ab und verlor sie.
Seine Bauern hätten noch bessere Maissorten, noch schönere Pferde gezüchtet. Chrustschow konnte nicht gewinnen. Er war das Opfer der Ungenauigkeiten seiner Biologen und seiner eigenen Chefideologen.
Die ihn begleitenden Landwirtschaftsfachleute staunten, als sie die amerikanische Kleintechnik sahen. Ein einziger Mann und nur ein Traktor schnitten, trockneten oder verluden und transportierten und entluden riesige Heumengen. Mit Zollstock, Bleistift und Papier bewaffnet begaben sich seine Fachberater an die Heu-erntefront. Von Feinden lernen, heißt siegen lernen. Fest stand für uns, soweit hatten sie uns im Verlaufe der zurückliegenden anderthalb Jahrzehnte überzeugt, dass nur eines der beiden Systeme überleben würde, nämlich das bessere. Professor Beier Red zeichnete damals eine Karikatur, die voll ins Schwarze traf. Sie erschien erst später im “Neuen Deutschland”, dem offizielle Organ der SED, das faktisch jeder Betrieb zu halten verpflichtet war. Groß aufgeschlagen sehe ich das Blatt auf dem Universaltisch der Fischereigenossenschaft liegen: Beier-Red’s Zeichnung zeigte einen auf dem Nordpol des Globus! sitzenden Rotarmisten mit seiner Budjonnymütze. Der hat den Schaft der mit Hammer und Sichel bestückten roten Fahne in den Bauch der Mutter Erde gesteckt. Ausschließlich der Kommunist besitzt das Überlebensrecht. Kess lächelnd teilt der von seiner Mission restlos überzeugte Bolschewist diesen unabweisbaren Anspruch Uncle Sam mit.
Der Ami kratzt sich sorgenvoll den Kopf. Er kann es nicht und soll doch begreifen, dass statt der Freiheitsidee die Frechheit siegen wird. Der Russe macht, dass der Kapitalist abrutschen und verschwinden muss. Der Erdball, den Beier-Red zeigt, bietet nur einem die Bleibemöglichkeit. Die westlichen Imperialisten sind laut Lehrbuch des Marxismus-Leninismus dazu verurteilt, den Globus zu verlassen. So, angeblich, will es das Gesetz des gesellschaftlichen Fortschritts.
Die rote Fahne für das Kapitol in Washington ist schon gestickt, so wie einstens Adolf Hitler ein bisschen verfrüht, den Siegesmarsch für den Einzug seiner Räuberbande in Moskau komponieren ließ.
Um eben die Verwirklichung dieses Zieles der erfolgreichen Weltrevolution ging es.
Deshalb herrschte ‘kalter Krieg’.
Ob wir Fische fingen oder sie sortierten. Dieses unverschämte Trachten nach Weltvorherrschaft bezog uns DDR-Bürger intensiv ein. Tag und Nacht, bei jeder Nachricht beschäftigte und beunruhigte es unseren Geist. Manchmal - wenn ich nicht gewusst hätte, dass der Mensch sich an nahezu jeden Zustand zu gewöhnen und anzupassen vermag - wäre ich an mir selbst irre geworden und hätte an meinem Verstand gezweifelt.
Denn, obwohl permanent die ernste Ursache bestand, das Schlimmste - den Atomkrieg - zu befürchten, fühlten wir uns bei der Arbeit und zu Hause häufig wohl.
Ein Widerspruch, den man erlebt haben muss, um ihn verstehen zu können.
Vor allem, wenn wir frühmorgens bei herrlichstem Wetter und bildschöner Umgebung zum Fischfang hinausfuhren oder wenn wir während der Arbeitszeit die Schönheit der Natur genossen, uns sonnten und uns des manchmal auch faulen Lebens erfreuten, während der kleine Kutter uns mühelos über das Wasser beförderte, fragte ich mich, womit ich das verdient hatte, inmitten des sich dramatisch zuspitzenden Großgeschehens glücklich zu sein.
Ich erinnerte mich dabei einmal dieses Bildes der russischen Lehrerin Irena. Durch ein blühendes Feld blauer Kornrade und roten Mohns geht sie, pflückt ein paar Blumen. Es ist der frühe friedliche Morgen des 21. Juni 1941. Sie hat einen weiten Weg bis zu ihrer Schule vor sich. Sie singt. Sie ist verliebt. Sie wird geliebt.
Dreihundert Meter von ihr entfernt liegen, von Büschen und Strauchwerk geschützt und versteckt, mehrere hundert deutsche Panzer.
Sekunden später befindet sie sich in der Hölle zwischen platzenden Granaten und dröhnenden Todesmaschinen. Die exzellente sowjetische Filmkunst unterschlug uns hier, dass Irenas Geschichte in Wladimir-Wolynskij spielte, nahe dem Bug. Nämlich, dass es sich hier um das Gebiet handelte, welches die Rote Armee im gemeinsamen Krieg der Sowjetunion und Hitlerdeutschlands gegen Polen erobert hatte.
Als Neunjähriger sah ich in Wolgast im Kino die Bilder der Wochenschau. Nie wieder vergaß ich diese enorm beeindruckenden, ganz offensichtlich ungestellten Szenen der Verbrüderung. Deutsche Wehrmachtsangehörige und sowjetrussische Armeeoffiziere umarmten sich als Waffenbrüder am Bug. Später vervollständigte sich mein Wissen: Hitlers SSler und Stalins GPU-Kommissare reichten sich auf Kosten Polens als gemeinsame Verbrecher an Polen freundschaftlich die Hände, und sie gaben und nahmen der SU unliebsame Kommunisten, wie Margarete Buber-Neumann, entgegen und sperrten sie in deutsche KZ ein.
Wie oft hatte ich mich an diese unterschiedlichen, unwiderruflich in meinem Gedächtnis gespeicherten Szenen erinnern müssen.
Einerseits hofften wir, dass uns ein besseres Schicksal beschieden sein würde als den damals Lebenden, andererseits schürte die DDR-Presse die Kriegshysterie 1959 erheblich.
Am 01. Juni schrieb ND: „KPD fordert Verzicht auf Gewalt”. Am nächsten Tag hieß es dort: „Westberliner Spionagezentrum von unschätzbarem Wert (für die Kapitalisten)”, aber, ... „es ist militärisch nicht zu verteidigen”... „Franz Joseph Strauß lässt zivile Fahrzeuge für den Tag X erfassen”.
Unentwegt sollten wir befürchten, dass uns der 3. Weltkrieg unmittelbar bevorstünde. In derselben Presseausgabe hieß es in einem Artikel von Lothar Bolz: „Westberlin darf nicht länger Pulverfass sein.” Was nicht anders zu verstehen war, als dass man ein Pulverfass durch eine schnelle Aktion unter Wasser setzen und dann einnehmen muss.
Am 14. Juni schrieb ND: „Den deutschen Militarismus bändigen.” Einen Tag später im selben Tenor: „Bonn soll Atomrüstung einstellen!”
Chrustschow befragt, wem er denn die 20 Megatonnenbombe, deren Prototyp er damals in der Arktis zündete, zugedacht habe, antwortete unverfroren: „Amerika!“ Solche Drohung schockierte nicht nur die Amerikaner.
Ich aber erinnerte mich der Worte des Altkommunisten Ernst Kay.
Am 17. Juni prangten die schwarzen Lettern im ND: „Empörung über Adenauers Kriegskurs!”
Wenig beruhigend die Kommentare der NVA Offiziere: „Wir sind zum Kampf bereit!”
Ich fragte nach.
Die Antwort, gegeben in einer Gaststätte, lautete: „Mein Körper gehört der NVA der DDR!” Das machte Angst. Bis einer schallend lachte: „Klar! Von Geist keine Spur!”
In eben diesen aufregenden Sommertagen gerieten uns auf einem Wadenzug in Höhe Tollenseheim einige hundert Stück Silberlinge ins Netz. „Das sind Maränen!”, erklärte Fritz Reiniger.
Er fügte nachdenklich hinzu: „Sind sie also doch hochgekommen!”
Damit spielte er auf die verwirklichte Idee der Doktoren des Institutes für Binnenfischerei und auf Eduard Jochims Überzeugung an, der 1955 mit Mitteln des Rates des Bezirkes 5 Millionen Maränenbrütlinge in den Tollensesee einsetzen ließ.
Niemand konnte bis dahin ernsthaft daran glauben, dass von den in ein Eisloch eingelassenen Millionen, nur wenige Millimeter langen, wie Glas durchsichtigen, hochempfindlichen Maränchen, auch nur ein einziges überlebt haben könnte.
Denn allemal kommt, selbst unter günstigeren Umständen, von etwa zwanzigtausend geschlüpften Fischchen in der Natur nur ein einziges Exemplar weiter. Wären es mehr, würden die Anzahl Fische sich jährlich verdoppeln, was nur ausnahmsweise geschehen darf. Das biologische Gleichgewicht würde empfindlich gestört werden. Lediglich durch Verzögerung des Schlupftermines in Fischbrutanstalten lassen sich diese drastischen Verluste reduzieren.
Die Embryonen, gleichgültig, ob sie auf dem Seeboden liegen oder in so genannten Zugergläsern künstlich erbrütet werden, zeigen ungefähr im Februar ihre Augen. Durch die dünn gewordene Eihaut hindurch schimmern die von einem kleinen Silberring eingefassten schwarzen Punkte. Dieses Augenpunktstadium wird nach dreiviertel der Embryonalentwicklungszeit erreicht. Sie wälzen sich dann bereits in ihrer anscheinend gemütlichen, wenn auch recht engen Behausung. Sie drehen und wenden sich. Mit der Lupe betrachtet sieht man ihr winziges Herz schlagen und schon bei fünfzigfacher Vergrößerung erkennt der Beobachter die grünlich schimmernden Blutplättchen durch die unsichtbaren Adern schwimmen.
Wilhelm Bartel nahm, als wir die Kleinen Maränen auswogen, einen der Silberlinge in die Hand. „Gut gewachsen!”, bemerkte er und betrachtete den runden Rücken der ungefähr hundertundfünfzig Gramm wiegenden fangreifen Fische und nickte.
„Geeignet!”, sagte er, in einem Tonfall der an übertrieben salbungsvolle Worte eines evangelischen Geistlichen erinnerte. Er schaute mich an. Ich spürte, das war ein gewichtiges Wort. „Du wirst sehen, dass wir mit der Zeit zu Maränenfischern werden.” Bis zehn Prozent der angelandeten Gesamtfischmenge könnten dann Maränen sein. Denn wenn ein Gewässer seine Eignung für eine bestimmte Fischart erweist, dann bietet es dieser auch die Chance, im Kampf ums Dasein zu dominieren.
So weit zu kommen, ist nicht leicht. Denn so genannte ökologische Nischen gibt es in intakten Seen kaum. Die sind normalerweise besetzt. Wenn Bartel Recht behielte, würden wir eines Tages mit Kleinen Maränen als bedeutendem Wirtschaftsfisch rechnen können. Jahresfänge über 20 Tonnen dürften wir einplanen. Er wies auf die Fettflosse: „Das macht sie zu den Lachsartigen, geräuchert sind alle Fettflossenträger eine Delikatesse.”
Noch waren es nur vage Hoffnungen und der Fang von dreihundert Stück Maränen blieb nur ein kleines Ereignis.
Wir hofften jedoch…
Das Jahr ‘61 kam herauf
Am 22. April hielt ich in meinem Tagebuch zwei Bemerkungen fest:
„Bezirksfischmeister Eduard Jochim ging in seinem politischen Referat anlässlich der Quartalsversammung weniger auf den Fischfang ein, als auf das Ereignis Weltraumfahrt. Eduard sprach feierlich von einer ‚Großtat der Sowjetunion’: Major Juri Gagarin war als erster Mensch am 12. April in den Orbit geflogen.“
Zweitens: Der wichtigste Beschluss der Mitgliederversammlung lautet: Wer am 1. Mai mitmarschiert, erhält 25,-Mark.
Wir marschierten wegen der 25,- Mark.
Aber das ist nur die halbe Wahrheit.
Wir Fischer gingen auch zur Maiparade, weil dieser Tag seinen eigenen Reiz auf den ausübte, der mitmachte. Es herrschte immer für einige Stunden richtige Feststimmung.
Auch wenn in diesem Jahr die Apfelbäume am ersten Maientag nicht in voller Blüte gestanden hätten, wäre er mir in Erinnerung geblieben.
Denn am Vorabend war ich zum ersten Mal als Aktivist ausgezeichnet worden.
Einen Augenblick lang war ich am Morgen versucht gewesen, meinen ‚Orden’ anzulegen.
Erika sah mich vor dem Spiegel stehen, als ich das braunrote Band mit dem Metall dicht ans Revers meines neuen Anzuges hielt. Während ich dachte: Soll ich oder soll ich nicht? schmunzelte sie mich halb spöttisch, halb anerkennend von der Seite an. Sie legte ein paar kleine Falten in ihre helle Stirn. Ihre Augen lachten.
Das hieß ihrerseits, wenn du es tust, ist es ein Kompliment an das System der Kommunisten, ich denke, dass du es so nicht haben willst! Oder?
Na ja! Alles ist ja wirklich nicht schlecht. Die Solidarität und so...
In diesem Augenblick kam die Moskauer Militärparade in meine gute Stube hineingeflimmert.
Von einem mit schweren Ordensleisten behangenen Marschall der Sowjetunion wurde die Tageslosung verkündet: „Bereit zur Verteidigung des Friedens”. Aber ich wusste was das bedeutete. Dieser Friedenskampf, den die Kremlherren meinten, würde mehr als doppelt so viele Opfer fordern, wie die beiden Weltkriege zusammen. Da machte es gar nichts aus ob dieser Kampf des Friedens oder des Krieges wegen stattfand. Die ruhmreichen Garderegimenter marschierten auf, die Elitedivisionen, die Offiziersschüler der berühmten sechsten... alles in meiner Wohnung. Sie paradierten hingebungsvoll und exakter als die Preußen, starr die kaum ruckenden Köpfe zur dicht besetzten Empore des Leninmausoleum ausgerichtet. Ihre Arme schwenkten nicht. Ihre in makellos weißen Handschuhen steckenden Fäuste berührten die ihrer Nebenmänner. Nikita Sergejewitsch winkte freundlichst herunter. Die SU ist auf Friedenskurs! O, je!
Des Marschalls Parole, die er stark akzentuiert ins unsichtbare Mikrofon hineinrief, bewegte mich sekundenlang. Es imponierte vielen. So haben die Welteroberer zu allen Zeiten mit ihren Säbeln gerasselt. Ihr bemannter Weltraumflug war nichts weiter als der Ausdruck ihres mit ungeheurer Anstrengung erzielten Vorlaufes im Rüstungswettbewerb. Deshalb die im Morgensonnenschein glitzernden Langstreckenraketen...
Schließlich verzichtete ich, mir ‘was ans Jackett zu heften.
Hermann Göck, der Ehrenfischer, stand an diesem lauen und blauen Maienmorgen neben einem oder zwei sowjetischen Generälen mit ungefähr einhundert anderen Prominenten auf der Haupttribüne. Viele der Leute da oben hatte ich noch nie gesehen.
Diesmal befand sich das Gerüst auf halbem Wege zwischen der Johannis- und der Marienkirche, in der Thälmannstraße. Aus seinem Hintergrund ragte ein großer Baukran hervor. Von dessen langer Trosse hing ein Seil bis einige Meter über dem Erdboden herab und an ihm befestigt eine rote, riesige Papiernelke. Es war der Ort der späteren Grundsteinlegung für den “Kulturfinger“.
Natürlich sahen wir zu Hermann Göck auf. Er hielt die geballte Linke in die Höhe. Wir Fischer schauten uns gegenseitig fragend an. Wenn wir ihm zuwinkten, dann hielt er das für ein Bekenntnis, unterließen wir den Gruß jedoch, dann missachteten wir ihn. Also winkten wir. Immer war auf solchen Großveranstaltungen beides miteinander vermischt, echtes und unechtes Pathos, Bewundern und Prahlen. Am neuen “Vier-Tore-Hotel” scherten die meisten Demonstranten aus. Ich auch. In Höhe der Edwin-Hoernle-Buchhandlung fand ich eine gute Position. Um mit der AK 8 filmen zu können, musste ich mich vordrängeln.
Eine Papprakete wurde im Festzug gefahren. Drinnen saß jemand. Er sollte einen Kosmonauten darstellen.
„Eifern wir Juri Gagarin nach!”, schallte es über die Lautsprecher. Die Stimme des Reporters überschlug sich fast: „Der neue Mensch ist in seiner reinsten Form erschaffen worden.” Hatte ich mich verhört? „Vorwärts zu den lichten Höhen des Sozialismus.”
Dazwischen tönten Siegesmeldungen von der Produktionsfront, Maurer marschierten auf, hinter ihnen rollten die farbigen Hausattrappen her. Fleischer in weißen Blusen und roten Schärpen, darunter die Lederscheiden für ihre Messer. Beide Kapitäne der Neubrandenburger Fahrgastschiffe kamen in tiefem Marineblau. Horre, sünd wie Kierls! ("Horre, sind wir doch ganze Kerle!")
Kinder mit blauen Pionierhalstüchern begleitet von Lehrern fuhren fröhlich winkend auf ihren mit frischem Birkengrün geschmückten Fahrrädern an uns und den Ehrengästen vorbei.
„Ein Lied geht um die Welt” Das Lied vom Frieden.
„Der Friede muss bewaffnet sein!”
Eine Hundertschaft Volkspolizei klapperte auf den harten Hacken ihrer neuen Stiefel mit ihren MP über das Pflaster, während aus dem Hintergrund immer neue Zehnerreihen Zivilisten
heranrückten. Unter schmetternder Marschmusik näherte sich schließlich die Blaskapelle der NVA. Ihr voran schritt fest und sicher ein Hauptmann, die stattlichste Erscheinung auf dem Platz. Er ging wie seine Männer bedeckt mit seinem straff unter dem Kinn festgeschnallten Stahlhelm in blinkend neuer, feldgrauer Uniform. Er ahnte ganz gewiss nicht, dass er den nächsten Monat nicht mehr sehen würde. Er dirigierte mit forschem Gesicht wie ein Generalmusikdirektor.
Der ungewöhnlich zeitige Frühling 1961 mit seinen häufigen Nordoststürmen verbunden mit Wasserhochstand des Tollensesees sollte uns in diesem Mai eine besondere Überraschung bescheren. Gegen die Windrichtung, aber mit der Tiefenströmung in Richtung Oberbach und Ölmühlenbach wanderten, zum ersten Mal, seitdem ich Fischer geworden war, bemerkenswert große Aalbestände ab. Zu beträchtlichen Stückgrößen herangewachsen, ließen sich die kiloschweren geschlechtsreifen Aalweibchen und die gegen sie nahezu winzigen Männchen nicht mehr halten. Der ferne Ozean lockte sie unwiderstehlich an. Beide metallenen Aalfänge, sowohl der in der Vierrademühle als auch der andere im Bereich der ehemaligen Ölmühle stehende, gut gewartet und intakt fingen in allen mondschwachen April- und vor allem Maiennächten jeweils mehrere hunderte Kilogramm. Zweihundert Zentner ("Zehn Tonen") insgesamt.
Nichts hatten wir zuvor von diesem Reichtum bemerkt, nicht einmal geahnt. Mit sicheren Instinkten ausgestattet überwindet der abwandernde Aal selbst vierzig Zentimeter hochgestellte Netzabsperrungen oder er findet längs der Vorfront zwischen den Gitterstäben, die zum System des Aalfanges gehören, seitliche Schlupflöcher. Die ungemein flinken Aale finden das kleinste Löchlein, wenn auch nicht jedes. Denn rasend schnell spielen sich die Ereignisse in der Dunkelheit ab. Der im abfließenden zuletzt vor dem Fangkasten in immer schneller strömenden Seewasser befindliche Aal hat nur zehntel Sekunden Zeit, um die winzige Chance zu Flucht zu erspüren und auszunutzen. Dennoch gelingt das erwiesenermaßen nicht wenigen. Fischer Blohm in Altentreptow, hinter diesen beiden Totalabsperrungen fischend, fing immerhin noch einhundert Zentner (sie wurden, da Fritz Blohm inzwischen unserer Genossenschaft angehörte, von unserer Buchhaltung korrekt erfasst.) Also war mindestens einem von drei Aalen gelungen das komplizierte, nur scheinbar dichte Maschenwerk aus verflochtenen ein-Zentimter-starken Eisenstäben zu überwinden. Wahrscheinlich entkam auf dieselbe Weise jeder zweite Aal. Dann müssen in diesem Jahr und Frühling 1961 mindesten vierhundert Zentner stattliche Aale den Tollensesee verlassen haben. Ein Großereignis der Binnenseenfischwelt, das in ähnlicher Weise sicherlich nur zwei- oder dreimal in einem Jahrhundert geschieht.
Der 13. August 1961
Die Nachrichten der frühen Morgenstunden dieses Tages, vom SFB verbreitet, trafen mich hart.
Krachend war um Mitternacht die letzte Tür hinter mir ins Schloss gefallen. Die Letzte... Nie wieder würde ich die bis dahin halb offen stehende Tür in den Westen geöffnet sehen!
Nie wieder!
Eine Situation und Erkenntnis , die mir schlagartig das ganze Ausmaß eines nicht wieder gutzumachenden Fehlers bewusst machte.
Gefühle der Menschen zog die entscheidungstragende Partei bei ihren taktischen Erwägungen und Aktionen selten oder nie in Betracht. Als Ausdruck dafür stand unter anderem diese überraschende Errichtung der Berliner Mauer. Wie bereits während der ein Jahr zuvor erfolgten Zwangskollektivierung der Landwirtschaft bewiesen ihre Köpfe uns, dass sie nicht daran dachten, uns jemals zu fragen, was wir dazu meinen, sondern dass sie rigoros ihre Vorstellungen, wie die Zukunft aussehen soll, durchsetzen werden.
Nicht nur mir schien, dass die Männer der Partei- und Staatsführung meinten, was sie sagten, wenn sie von ‚unseren’ Menschen sprachen. Bis Mitte August ’61 entflohen ihnen deshalb über eine Million Andersdenkender. Sie konnten und wollten mit der beängstigenden Abnahme ihrer Freiräume nicht weiter leben.
Nicht jeder war anpassungsfähig.
Ich sah während der Kollektivierungskampagne in Ballwitz den Mittelbauern J. der seine 50 Hektar Ackerland stets vorbildlich bewirtschaftet hatte. Seine Frau stand, als ich bei ihm in einer Versicherungsangelegenheit vorsprach, auf den Stufen des schlichten Wohnhauses.
Über ihr schlossen die Zweige zweier blühender, duftender Fliederbüsche. An ihrer Seite standen zwei kleine Kinder, die Muttis Finger umklammerten und die scheu zu mir aufsahen. „Ich lasse mich nicht zwingen!”, erwiderte der stattliche Dreißiger auf meine Frage wie er diese Entwicklung ertrage.
Drei Tage später stand sein Wohnhaus leer.
Tausende Mittelbauern ließen die Scholle im Stich, die ihre Vorfahren jahrhundertelang als stolze, unabhängige Bauern bewirtschaftet hatten. Undialektisch wurden diese vielen traurig Davongehenden von der gleichgeschalteten DDR-Presse obendrein als Republikflüchtige verunglimpft. Niemals lasen oder hörten wir ein Wort des Bedauerns und der Entschuldigung von denen, die diese Massenflucht verursachten. Zudem konnten nicht alle, die sich auf der Schattenseite des Sozialismus befanden, rechtzeitig fliehen. Noch einen Tag vor der Abriegelung Ostberlins gegen den Westen vertraute ich Polizeimeister Jochen Appel an, was mich an der DDR störte. Er gehörte zu den vielen Hobbyfischern, die so manche Gelegenheit nutzten, mit uns hinauszufahren.
Mich regte die innere Unredlichkeit auf, mit der sie uns nötigten, alle zwei Jahre an die Wahlurnen zu gehen. Sie führten genauestens Buch darüber, wer an den ‚Volkswahlen’ nicht teilnahm. Bei den Nichtteilnehmern konnte es sich nur um Feinde der DDR handeln. "Nur wer gegen den Frieden ist, der kommt nicht oder er benutzt die Wahlkabine.“ Hatten die ihren Verstand und Gewissen gegen Geld verscherbelt? Solche Argumentation war kein Anzeichen für Schwachsinn, sondern ihrer Gerissenheit.
Wie die zwei Prozent Mutigen es zustande brachten sich ‚gegen’ den Weltfrieden auszusprechen und trotzdem ruhig zu schlafen, ist mir immer unfassbar geblieben. Wer den Mut aufbrachte, die Wahlkabine zu benutzen, der verachtete auch die letzten Vorzüge, die ihm das ansonsten von der Partei reglementierte Leben noch bot.
Die Wochen und Monate vergingen, die Zeit milderte die Heftigkeit des unseligen Gefühls, nun lebenslänglich eingesperrt hinter der Mauer leben zu müssen.
Wir gingen Tag um Tag derselben immer neuen Arbeit des Zugnetzfischens nach. Es kam der November herauf. Wilhelm Bartel und ich wurden zum Rat des Kreises bestellt. Dort legte man uns ein Papier vor. Es handelte sich um einen Aufruf zur Planerfüllung und -übererfüllung.
“Wettbewerb für sozialistische Genossenschaften” stand da oben geschrieben.
Wenn wir die staatliche Planauflage allseitig erfüllten, dann erhielten wir die Summen oberhalb einhundert Prozent aus dem Betriebsgesamtplan steuerfrei als Nachzahlung. „Das gibt es nicht!”, erwiderte Wilhelm Bartel und steckte sich vor Schreck an der heruntergebrannten anderen ein neues Zigarillo an. Meistens unterbrach er das Rauchen nur für zehn Minuten. Diesmal nicht.
Wir fuhren mit unseren Fahrrädern wieder hinunter zur Fischereibaracke. Während wir radelten, rechnete er mir überzeugend vor, dass es uns ohnehin leider nicht betreffen würde. Wir könnten allenfalls den Finanzplan, auch noch den Konsumfischplan erfüllen und übererfüllen, aber im Bereich Feinfische blieben wir, wie üblich, weit vor dem Ziel stecken.
Schade. Wann gäbe es das wieder? Steuerfreiheit für Gewinne? Nie.
Biederstaedt bekräftigte dieses Unmöglich!
Von den geplanten 28 Tonnen Feinfischen (Edelfischen) fehlten zehn. Die Fehlmenge war, nur finanziell allerdings, durch vermehrte Anlandungen anderer Fischarten ausgeglichen worden. Im November ereignen sich keine Fangwunder mehr. Jedenfalls nicht in dieser Größenordnung. Das sei gewiss. Auch er zog die Achseln bedauernd und schüttelte den Kopf. Illusionen gäbe er sich in seinem Alter nicht mehr hin. Gegen uns drehte sich sogar der Wind. Er blies in den ersten acht Novembertagen heftig aus Ostsüdost. Der durch ihn erzeugte Tiefenstrom würde allenfalls die großen Barsche in Zugnetzbereiche treiben. Aber zehn Tonnen große Barsche gab der Tollensesee selbst in besten Fangjahren nicht her. Das leuchtete mir ein, obwohl ich erst fünf Jahre dabei war.
Vom langgestreckten Tollensesee können etwa 85% der Gesamtseefläche fischereilich nicht erfasst werden. In diesen Rückzugsgebieten bleiben die besten Fische stets ungestört.
Bartel versuchte uns zu ermutigen, dennoch das Mögliche zu tun. Die Lieps habe ihre Mengen zwar längst abgegeben. „Doch wir haben den Krickower und den Neveriner See noch nicht abgefischt.” Zusammen könnten uns die beiden Gewässer zwei Tonnen Feinfische bescheren. Wo jedoch ließe sich eine dritte, vierte Tonne Feinfische fangen?
Da zuckte er resignierend die Achseln.
Nirgendwo! Das Zugnetz und die Kähne wurden zunächst eiligst nach Neverin transportiert, wo tatsächlich, wie vorausgesagt, eine Tonne Zander gefangen wurde. Anschließend ging es nach Krickow. Phantastische Gedanken- und Zahlenspielereien zogen durch unsere Köpfe. Aber bei genauer Betrachtung kamen immer nur Minuszahlen heraus: zum Schluss werden uns mehr als sechs Tonnen fehlen.
Eifrig, begleitet vom Sausen des starken Ostwindes, setzten wir die Netzteile im steilscharigen Krickower See aus. Sofort, als wir das Zugnetz in Bewegung brachten, ging das von Plasteschwimmern an der Seeoberfläche gehaltene Netz der rechten Seite unter. Es hakte.
Die Männer, die diesen Flügel zogen, begaben sich so schnell wie sie konnten an jene Stelle der Netzwand die zuerst abgetaucht war. Dort musste ein Hindernis in der Tiefe liegen. Eine Stunde lang wühlten und stöhnten sie. Es kam nach und nach ein sonderbarer Aufbau, schließlich eine ganze komplette Kutsche zum Vorschein.
Fünfzehn Jahre lang muss das Netz günstiger ausgelegt worden sein. Der Riss, von der versenkten Kalesche verursacht, konnte schnell ausgeflickt werden, doch alle Mühe war schließlich vergebens. Denn Feinfische gab es dort nur kiloweise. Wir rochen die Frostluft. Das Ende der Saison stand uns also aus Witterungsgründen unmittelbar bevor.
Bartel zog das schiefe Gesicht wieder gerade. Er hatte es ja gleich gesagt. Er habe sich nun endgültig damit abgefunden, dass schöne Träume bleiben, was sie sind.
Nur Biederstaedt, Witte und ich wollten es noch einmal mit dem Einsatz des Zugnetzes auf dem Tollensesee versuchen. Einige beschimpften uns als Spinner. Es habe ja doch keinen Zweck. Zehn Tonnen Hechte oder große Bleie fing man nicht mehr im vorgerückten November, schon gar nicht bei Ostwind, sondern höchstens die minderwertigen Plötzen.
Wir zankten uns.
Biederstaedt hob die Hand beschwichtigend. „Lot’t uns dat doch utprobieren!” ("Lasst uns das doch ausprobieren!")
Ein denkwürdiger Tag
Dieser Novembertag des Jahres ‘61 begann trist. Nur weil es ihre Pflicht forderte zu fischen, fuhren auch die Spötter mit uns auf den See. Meine Hoffnung brannte noch lichterloh. Natürlich, manchmal gibt es nichts mehr zu hoffen und man rennt dennoch. Wir legten das große Zugnetz auf halbem Wege zwischen Neubrandenburg und Buchort vierhundert Meter von Land aus. Je zweihundert Meter parallel zum Uferstreifen. Allen Bemühungen zum Trotz fingen wir innerhalb fünf Stunden nur vier Stück Kleine Maränen. Das war noch nicht einmal ein einziges Kilogramm Fisch.
Die einen freuten sich, wir andern zogen die Mundwinkel herunter. Die Klügeren hatten Recht behalten. Enttäuschung ist wahrscheinlicher als Erfüllung.
Bösartig argumentierend könnte man sagen: der See sei bereits überfischt worden.
Die Uhrzeiger rückten auf die zweite Nachmittagsstunde vor. Winterluft wehte wieder spürbar. Der Wind blies nun aus Nordwesten. Doch so plötzlich wie er aufgekommen war, legte er sich wieder, wie das an Nachmittagen häufig üblich ist.
Selbst Biederstaedt verspürte nur noch wenig Lust, noch einen weiteren Zug anzulegen.
Sie entmutigten einander und ich gab ebenfalls auf.
Wir dachten an die uns bevorstehende Freizeit.
Also fuhren wir, die nächste Enttäuschung hinter uns lassend heim.
Der Motor brummte. Kurt Reiniger legte den Gang ein. Schäumend wirbelte des Kutters Heckwasser.
Kurt mied die gefährlichen Steine unterhalb des Steilufers von Belvedere. Er steuerte auf Augustabad zu. Dieser kleine Umstand sollte große Folgen haben. Denn da, fünfhundert Meter von Land, passierte etwas.
Da, noch einmal! Das dürfte keine Täuschung gewesen sein.
Fast unbemerkbar, wie ein Lamettafaden aufblitzt, der in der Dunkelheit der Nacht in einhundert Meter Entfernung nur kurz vom schwachen Mondlicht beleuchtet wird. Wieder! Diesmal zwei oder drei dieser winzigen nur für den Bruchteil einer Sekunde erscheinenden Silberstreifen, aber bereits nur noch sechzig, siebzig Meter von uns weg. Sie rissen mich aus der Lethargie in die Höhe.
Biederstaedt bemerkte es ebenfalls. Er legte die Hand beschattend über seine starken Augenbrauen. Wir starrten nun zu zweit. Wie elektrisiert und in Hochspannung versetzt und abwartend wandten wir unsere ganze Aufmerksamkeit der plötzlich sich völlig glättenden Wasserhaut zu.
Fritz Reiniger stieß die rechte Hand vor. „Maränen!”, rief er. Auch er erregt. Jetzt erschienen vier, fünf Silberfunken auf einmal, mehrten sich.
Alle sahen nun das sich unglaublich schnell entfaltende Bild. Immer mehr Fische sprangen aus dem Seespiegel heraus. „Maränen, Maränen! Überall Maränen.” Nur der Kutterfahrer Kurt Reiniger ahnte nichts. Er saß in der Kabine und hatte lediglich den stumpfen Turm der Marienkirche im Blick.
Purer Übermut trieb diese auf Hochzeit gestimmten Winterlaicher. Nur für Zehntel Sekunden ließen sich die Einzelexemplare blicken. Mit großer Geschwindigkeit sausten sie knapp über den schnell durchschnittenen Wasserspiegel hin. Geräuschlos für uns, noch, solange der Kuttermotor lief. Von meinem Arbeitskahn aus schlug ich mit ziemlicher Wucht und mit der flachen Seite meines Ruders auf das Dach der Fahrerkabine, unseres neuen Kutters.
Ringsherum spritzten die Silberlinge inzwischen zu Tausenden immer mutiger, immer höher hinaus, immer weiter.
Fritz Reiniger, Kurts Bruder, gab als Brigadier Weisung, er möge sofort wenden. Seinem älteren Bruder laut zu widersprechen, hätte Kurt nie gewagt. Doch offensichtlich immer noch in Zorn zog Kurt sich zurück. Ich vermutete richtig, dass er da im Motorenraum maßlos vor sich hingeflucht hat und dennoch gehorchte. Er muss das Steuerrad aus Ärger gefühllos herumgerissen haben, denn sofort schleuderten die Kähne bedrohlich scharf nach außen. So sind selbst schon höherbordige Boote zum Kentern gebracht worden. Noch befanden wir uns vier-, fünfhundert Meter von der Einfahrtsrinne zum Oberbach entfernt. Da war der See noch tief genug. Noch konnte Kutterfahrer Kurt einen Halbkreis mit Vollgas ausfahren. Das mutete er uns auch zu. Wir gerieten unnötigerweise in diese Schieflage. Lediglich Millimeter fehlten und das schäumende Wasser wäre nicht nur spritzerweise, sondern massiv in die Arbeitskähne hineingeschlagen. Wo das passiert war, da gab es bereits der Netze wegen, die dann automatisch über die Gekenterten hinweggeschleppt werden, Tote.
Dem Umkippen immer noch nahe, noch während des hitzig ausgeführten Wendemanövers wiederholte sich das Schauspiel unmittelbar neben uns. Aus den von uns verursachten Wellen sprangen nun die kostbaren Fischchen und zeigten sich jetzt in voller Pracht ihres Gruppenfluges. Das war einmalig betörend und aufregend.
Als wir auf Höhe der Linie Belvedere - (ehemalige) Torpedoversuchsanstalt ankamen, warfen wir das Netz zum zweiten Mal aus. Die Sonne färbte den Horizont bereits rötlich zu rot, dann violett zu herrlicher Farbenvielfalt.
Von der Trommelwinde fuhren wir jeweils ungefähr vierhundert Meter Drahtseil ab. Dann im flachen Seebereich steckten wir unsere Haltepfähle in den sandigen Seeboden, kurbelten die kleinen Dieselmotoren der Maschinenwinden an und warteten eigentlich eher ungewiss darauf, wann das zwar recht lange, aber nicht sehr tiefe Netz endlich auftauchen würde. Denn durch den Wasserwiderstand, der den Maschen entgegensteht, baucht das Fangnetz während der Windephase beträchtlich aus.
Manchmal ist es dann nur noch sechs Meter hoch. Reduziert um fast die Hälfte der theoretischen Stauhöhe. Solange also die Flottenleine nicht an die Seeoberfläche stieß, war den Fischen der Ausbruch durch einfaches Überschwimmen des Netzes allemal möglich. So können selbst die größten Fischschwärme bis auf den letzten Schwanz entkommen. Ihrem Instinkt folgend haben sogar die in Laichstimmung hineintaumelnden Fische stets noch ihre Fluchtchancen. Deshalb sahen wir dem Zeitpunkt des Netzauftauchens eher gelassen, als mit hochgespannter Erwartung entgegen. Zu oft hatten wir es erlebt, dass Großfische mitten auf dem ‚Zug’ im scheinbar sicher eingekreisten Bereich aus Lust oder Erregung herausplatschten und dann war es doch nicht gelungen, sie zu fangen. Die Unberechenbarkeit der stets nur teilweise eingekreisten Fische machte die Arbeit so spannend. Trotz enormen Fleißes unsererseits blieb sie ein Glücksspiel, und deshalb gewöhnte man sich nach und nach, selbst bei allerbesten Anzeichen ab, irgendeine Fanghoffnung zu übersteigern.
Doch, wo immer die ‚Springer’ ihre Anwesenheit demonstrierten, da bemühten wir uns auch, sie zu fangen.
Es geschah in diesem Augenblick bereits das nächste wunderbare Ereignis. Wie von Geisterhand bewegt flog das Netz plötzlich auf einem guten Drittel seiner Gesamtlänge, also auf einer Länge von etwa zweihundert Metern in die Luft. Wie mir schien, einen halben Meter hoch. Ein Silberrand ohnegleichen. Das war eine Sensation.
Mir ging vor Staunen der Mund auf. Noch nie hatte ich - sowie meine Kollegen - Vergleichbares erlebt. Gegen das Gesetz der Schwerkraft kann das tonnenschwere Netz sich nicht aus dem Wasser in die Lüfte erheben, nicht einen einzigen Millimeter.
Und doch war es so. Die Männer vom nebenan liegenden Boot schrieen jubelnd: „Wir haben sie.” Was war wirklich geschehen?
Es gab nur eine Erklärung: Alle Energie, die von aufgerüttelten Maräneninstinkten zur Überlebenssicherung in hunderttausenden Fischen zeitgleich freigesetzt wurde, verlor sich im gemeinsamen Anrennen gegen die Netzwand. Die Vorderen rasten mit ihren spitzen Köpfen in die Maschen, die nächsten stießen gegen die aufgeregt weiterschwimmenden, aber schon gefangenen und die letzten, meisten, taten das Übrige. So schob eine Fischwelle die andere in Panik vor sich her und verursachte auf diese Weise das sensationell sichtbare Ergebnis dieses Massenansturmes.
Unmittelbar hinter den schon kahlen Buchenkronen und der Silhouette von dem im klassizistischen Stil erbauten, tempelartigen Belvedere zog sich schon die Sonne zurück und färbte den hinter
dem Zugnetzsack liegenden Seeteil von violett zu blaugrau, strengen Frost ankündigend.
Über dem Wadensack in nahezu noch dreihundert Metern Entfernung flatterten tausend Seeschwalben und Möwen. Wie aufgewirbelte, weiße, schnell ihre Konturen ändernde Wolken wogten die Vogelscharen. Immer wieder stießen die Räuber aus der grauweißgesprenkelten Höhe herab und zerrten mehr oder weniger erfolgreich an den mit ihren Silberleibern in den Netzmaschen steckenden Fischen. Rings herum tönte dieses wilde Kreischen.
Inzwischen fuhren wir mit unseren pechschwarzen Arbeitskähnen mittig im Flachwasserbereich zusammen, um schließlich die Arbeit des Garneinholens vorzubereiten. Noch lag die von weißen Ekazellflotten umrahmte Seefläche spiegelblank vor uns, als sich plötzlich, ohne Windeinwirkung, eine erhebliche Woge auf uns zubewegte. Ozeanische Massen Maränen! Niemand konnte sie aufhalten. Jedes Stellnetz, das wir vielleicht als Sperre hätten einsetzen können, wäre von ihnen binnen Sekunden zu Boden gerissen worden. Unter dem Verlust einiger hundert Leiber hätte sich die Masse freie Bahn gebrochen. Das müssen hunderte Zentner gewesen sein. Sie erschwammen sich ihre Freiheit durch Gleichzeitigkeit ihrer Flucht. Wir sahen im niedrigen Wasser unter uns die zahllosen Fische, die Leib an Leib gedrückt schnell dahin schossen. Entzückt und zugleich von Ärger betroffen sahen wir staunend diese unglaublich großen, blauschimmernden Scharen.
Oft stand mir später dieses Bild vor Augen und irgendwann kam mir der Gedanke: Keine totalitäre Regierung der Welt, könnte ihre Grenzzäune halten, wären fluchtwillige Menschen fähig ihre Verstandeskräfte zeitgleich einzusetzen. Endlich, bei allmählich schwindendem Tageslicht konnten wir den Kreis schließen. Von dem Augenblick an, wenn die eng beieinander liegenden Fangboote das Zeug einholen, mindern sich für die restlichen, im Umfassungsraum herumschwimmenden Fische die Möglichkeiten zu entkommen erheblich. Die beiden Netzwände kamen nun wie ein silbern genoppter Teppich heran. Nach und nach, während des Zuladens des fischgespickten Garns brachte die
beiden Kähne fast zum Sinken. Wie Hirschgeweihe stießen die Vordersteven unserer Boote in die Höhe, während die Heckteile nahezu mit der glücklicherweise nun völlig ruhigen Wasseroberfläche abschnitten.
Wir durften uns kaum noch bewegen, sonst gingen wir unter.
Massenweise versuchten die verbleibenden Maränen im Wadensack Platz und Durchkommen zu finden. Da schwammen sie zwar noch, waren aber, wie die in den Maschen steckenden, endgültig gefangen. Anders wären wir der Fischmassen nicht Herr geworden.
Einhundertundsechsundsiebzig Zentner Maränen konnten wir in dieser Nacht aus den Weiten des Wadensackes herauskeschern. „Fast neun Tonnen!“ jubelte ich, - ich glaube laut.
Glücklicherweise sanken die Temperaturen in den Minusbereich.
Wir fühlten uns mehr als beschenkt. Biederstaedt schlug lachend, wuchtig und kreuzweise die steifen Hände und Arme über der Brust zusammen.
„Dat sünd de ollen Tieden!”, ("Wie in guten alten Tagen!") frohlockte er. Sein flächiges Gesicht strahlte: „Dat sünd de teigen Tunnen!” An der Möglichkeit zur Vollendung der nun unbedeutend gewordenen Feinfischmenge zur Überschreitung der so bedeutungsvollen Zehntonnengrenze gab es nun keinen Zweifel mehr.
Jeder wusste plötzlich guten Rat. Euphorisch wurde diskutiert. Da und dort ließen sich noch ‚gute’ Fische fangen. Nur noch eine knappe halbe Tonne!
Nur noch dieses Fastnichts von gut dreihundert Kilogramm Feinfischen. „Und außerdem die Maränen!”, sagte Wilhelm Bartel, krumm nach der Arbeit und der Plackerei. Das nächste aber bereits durchnässte ‚Tabakinchen’ hielt er statt eines qualmenden mit den Lippen fest. Er konnte es nicht anstecken. In die nach oben gezogene Mundecke hatte er es geschoben, wo es sonst nie saß. Das müsse doch mit dem Teufel zugehen, wenn nun nicht gelingen würde noch eins draufzulegen.
Es war nur sonderbar, dass wir während des ganzen Sommers bloß hin und wieder ein paar Silberlinge gefangen und sonst nichts von ihnen bemerkt hatten. Plötzlich schien der See von Maränen überzuquellen. Geheimnisse der Tiefe. Sie hatten sich gesammelt. Aus den Weiten der siebzehn Quadratkilometer Fläche, verteilt auf die durchschnittliche Wassersäule von sechsundzwanzig Metern waren uns die Kleinen Maränen in letzter Minute glücklicherweise entgegen gekommen. Sie hatten gezeigt, dass es sie in Massen gibt und ich erkannte, wie wenig wir vom Geschehen unterhalb der Wasserhaut wussten.
Einige dieser Verborgenheiten verraten sich durch das Echolot, andere zeigen ihre Existenz erst unter dem Mikroskop. Bewundernswert ist diese Mikrowelt der Kieselalgen, Rotatorien, Nauplien. Staunend sieht der Beobachter die Anlage des Herzens im Embryo der Fischeier. Andere Wesenheiten sind uns schon vertrauter und sogar einige Geheimnisse der Natur scheinen bereits entschlüsselt zu sein. Am beeindruckendsten erschienen mir stets die genetischen Skripte, die sich als Instinkte der winzigsten Geschöpfe äußern. Dass ungesteuerte Evolution sie geschrieben hat, halte ich für undenkbar.
In diesen Jahren vermittelten die Lehrbücher für Biologie der 12. Klassen sowie der Biologiestudenten der DDR und der UdSSR noch die verwegenen, absurden Theorien eines Herrn Lyssenko und erklärten sie für definitiv richtig, obwohl sämtliche westlichen Genetiker längst das Gegenteil bewiesen hatten.
Doch wehe dem, der im Machtbereich des Kreml lebte und Lyssenkos Lehren ernsthaft anzuzweifeln wagte.
In allen fünfziger und den ersten sechziger Jahren hatten wir Lyssenko und Konsorten, gemäß Parteidirektiven, zu glauben. Sie lehrten, dass sämtliche Fisch- oder Getreidearten, wenn man sie zig Generationen unter gewissen Bedingungen in artverwandten Monokulturen halten würde, ab der zehnten, zwanzigsten Geschlechterfolge ihre Wesensmerkmale entscheidend ändern müssten. Irgendwann wäre die Anpassung perfekt.
Lyssenkos “Beweisführung” war für die Parteitheoretiker wichtig. Weil daraus gefolgert werden sollte, dass unter sozialistischen Seinsverhältnissen bald der ‚neue Mensch”’ hervorkäme.
Vielleicht hofften einige der glaubenstreuen Kremljünger wirklich, dass der “neue Mensch” biologisch ein Übermensch sein könnte, hervorgebracht in den Ländern des Fortschritts.
Lyssenko, der Präsident der Akademie der landwirtschaftlichen Wissenschaften der UdSSR, muss höchst beunruhigt gewesen sein, als die Herren James Dewey Watson und F. Crick - nur ein Jahr nach unserem Wunderfange im November ‘61 - den Nobelpreis für ihr Modell der Erbsubstanz erhielten. Sie bewiesen damit, gewollt oder nicht, dass Herr Lyssenko, ein Scharlatan war. Doch Herr Akademiepräsident schummelte ernsthaft weiter und das mit handfester Unterstützung gewisser Philosophen. Die biologischen Gesetzmäßigkeiten sollten mit dem einen oder dem anderen Grundsatz des dialektischen Materialismus in Einklang gebracht werden.
Der deutsche Kommunist Robert Havemann schrieb dagegen an.
(„Dialektik ohne Dogma“, 1962)
(ND veröffentlichte Passagen.)
Bis zu dieser Veröffentlichung hielt Walter Ulbricht seine Hände schützend über diesen klugen Denker. Nun fühlte sich der SED-Generalsekretär kompromittiert.
Havemann wurde verwarnt, schließlich aus dem Lehrkörper der Huboldt-Universität ausgeschlossen und später unter Hausarrest gestellt. Wir konnten gar nicht anders, wir litten mit diesem Mann.
Bis 1962 gab es nur wenige Mutige wie Professor Wawilow, die sich offen gegen die Auffassungen ihres Chefs zu stellen wagten. Wawilow wurde als Anhänger des angeblich reaktionären Weiß-mannismus-Morganismus diffamiert und inhaftiert.
Unerschrocken wie Giordano Bruno trotzte Wawilow Herrn Lügenbaron Lyssenko und jener Macht, die hinter dem führenden Sowjetbiologen stand und die über Tod und Leben entscheiden konnte.
Wawilow starb in einem der Lager des Archipel Gulak.
Prof. Stubbe von der Akademie der Wissenschaften der DDR gehörte ebenfalls zu den Standhaften. Er weigerte sich zu akzeptieren, dass die Nachkommen eines Roggenkornes, gleichgültig unter welchen Bedingungen, je zu Weizensamen mutieren könnten.
Selbst wenn Roggengenerationen einer speziellen Schocktherapie unterzogen und einige Jahrzehnte lang in einem Weizenfeld aufwachsen würden, sei ein Artensprung unwahrscheinlich. Doch auf Biegen und Brechen sollte nachgewiesen werden, dass die Umgebung der das Sein bestimmende Faktor ist. Viele Jahre bewahrte ich diese Zeitungen auf, die den wissenschaftlichen Streit zu diesem Thema auf den Punkt bringen sollten. Prof. Stubbe wurde seines Unglaubens wegen öffentlich schwer getadelt.
Doch auch das änderte die Tatsachen nicht: Seitdem es identische Reduplikation gibt - und das ist seit einigen hundert Millionen Jahren der Fall - bestimmen die in der Doppelhelix untergebrachten Desoxyribonukleinsäuren, sozusagen als Buchstaben, die tatsächlich ein Bauanleitungsbuch bilden, das Sein.
So kompliziert sich das anhört, so einfach war dieser Fakt zu begreifen. Seitdem zum ersten Mal ein Einzeller einen ihm gleichen Einzeller hervorbrachte, und sei es auch nur durch Zellteilung, bestimmte die in der Doppelhelix festgeschriebene Information, was zu geschehen hat.
Der Aufwand, den ein gewöhnliches Stichlingspaar zur Pflege seiner Brut leistet, ist lediglich das automatische Abhaspeln eines außerordentlich komplexen Softwareprogramms. Die Installation solcher Programme im Kopf eines winzigen Fisches ist mindestens so bewundernswert wie ihre Sinnhaftigkeit.
Wir genossen Steuerfreiheit.
Innerhalb sechsunddreißig Stunden ununterbrochener Arbeit, hatte jeder Neubrandenburger Fischer 2600 Mark verdient. Das tröstete mich über den definitiven Verlust der Freiheit, den mit mir Millionen erleiden mussten.
Nun musste ich anerkennen, dass die Partei doch nicht immer im Unrecht war. Die beiden Bezirksfischmeister, hatten eine gute Entscheidung gefällt.
Jochen
Jochen Appel gehörte der Neubrandenburger Morduntersuchungskommission an.
Er war einige Jahre jünger als ich, wog neunzig Kilo und trug ein verschmitztes, offenes Gesicht.
Es war übrigens stockdunkel gewesen in jener ersten Nacht, die er mit mir auf dem See zu verbringen gedachte.
Er wollte sich die zwei Kilo Aale verdienen, die wir als Naturalvergütung für eine Nachtschicht aussetzten. Man konnte die Hand nicht vor Augen sehen. Als erstes zerbrach er beide Ruder, weil er glaubte, man müsste die Kähne mit äußerstem Ruck in Bewegung bringen. An Land, während die Motoren für uns arbeiteten, und nachdem ich ihn tüchtig ausgeschimpft hatte, erzählte ich ihm versöhnlich einen politischen Witz. „Was ist der Unterschied zwischen Walter Ulbricht und einer Rakete?“ ...
„Das weißt du nicht? Da ist keiner! Beide sind ferngesteuert. “
Wir lachten noch, denn niemand konnte uns gehört haben.
Er behielt diese drei Sätze zu seinem Verhängnis.
Hätte er sie doch vergessen.
Törichterweise stellte er ausgerechnet seinen Mitgenossen der Offiziersschule Aschersleben dieselbe provokante Frage.
Denn der Tag auf dem LPG Acker war langweilig gewesen. Jochen wollte sie nur aufmuntern. Schließlich hatten sie acht Stunden Rüben verzogen.
Alle lachten darüber.
„Stell’ dir vor!”, erzählte er mir wenig später, „da war ein Schweinehund drunter.” Sie beorderten Jochen ins Büro des Chefs. Augenblicklich sei ihm klar gewesen, was die Schulleitung von ihm wollte. „Wer hat ihnen diese Gemeinheit erzählt?”
Jochen schwieg, aber seine Art nicht darüber zu reden muss ihn verdächtig gemacht haben.
Sie beharrten eisern.
Sollte er mich verpetzen?
Sein Oberst, die Gnadenlosigkeit in Person, machte Jochen herunter, indem er lautstark über das Thema Klassenbewusstsein referierte: „Die Arbeiterklasse versteht keinen Spaß.”
Jochen suchte Ausreden. „Kleinen Witz nennen sie das?” Wie dann die großen aussehen sollten.
„Also, haben sie nicht die Absicht ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Ja?” In diesem kritischen Augenblick habe er, Jochen, mich vor sich gesehen, wie ich in der Kahnecke sitze und in der Bibel lese.
Auf dem See las ich eher Feuchtwanger und Gorki, als in der Bibel, obwohl auch das der Fall war.
Mitte Oktober ’62 erfuhr ich es von Jochen.
„Und jetzt?”, fragte ich zurück?
Jetzt sei die Sache erledigt. Er bleibe Polizeimeister.
„Ick künn di doch nich verroden, Jung!“ ("Junge, ich konnte dich doch nicht verraten!")
(Erst viel später erfuhr ich die ganze Wahrheit: Sie verhörten meinen Jochen noch monatelang. Nachts holten sie ihn aus dem Schlaf. In meiner Naivität ahnte ich nichts von alledem. Seine unerbittlichen Gegenspieler quälten ihn, bis er zusammenbrach und den Freitod wählte. Er ertränkte sich. Er hätte nur meinen Namen preisgeben müssen… Immer wieder stehe ich betroffen vor seinem Grab, über dessen Gedenkstein, auf dem Neubrandenburger Friedhof Carlshöhe, eine weiße Birke ragt und Schatten spendet.)
Es kam etwas hinzu: Am 22. schossen die Kubaner einen US Aufklärer ab. Ich hörte, glaube ich, die Nachricht am frühen Morgen des nächsten Tages, weckte Erika und äußerte meine Bedenken. Das lassen sich die Amis doch nicht gefallen! Und so war es.
Bereits wenige Stunden später überraschte uns die Information, sowjetische Raketenstellungen bedrohten von Kuba aus die USA. Ein Blick in den Atlas genügte. Von Santa Clara bis Miami war es nur ein Katzensprung. Anstelle des bis dahin anscheinend eher harmlosen Inselstaates Kuba, befand sie plötzlich ein mit tödlichen Waffen gespickter, unsinkbarer Flugzeugträger der Roten Armee unmittelbar vor Florida. Jeden Kommentar, den wir hören konnten, verfolgten wir angespannt. RIAS sagte: „Chrustschow droht der freien Welt ihren Untergang an.”
Von der Gegenseite tönte es ebenso hart zurück: „Provokation der US-Imperialisten!“
Tatsächlich erging von Präsident John Fitzgerald Kennedy Weisung ans Pentagon: Sofort sind die Sowjetschiffe mit Kurs Kuba im Bahamabereich zu stoppen. Er bestehe auf sofortigen Abzug der sowjetischen Raketen von Kuba, sonst... Sonst? Wer da nicht gezittert hatte, wusste nichts. Wir ahnten, dass die US Militärs von ihrem Präsidenten die umgehende Besetzung Kubas verlangten. Das hätten die Russen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln unterbunden.
Stunde um Stunde setzten sie einander und uns unter Hochdruck.
Es mag ja Menschen geben, die den Tod nicht fürchten. Doch wer am Leben hing, wie wir, der verfolgte jede Nuance im Wechsel des hochpolitischen Ränkespiels, das zwischen Moskau und Washington Zug um Zug mit äußerstem Einsatz an Willenskraft und Intelligenz durchgezogen wurde.
Ein Fehlerchen hier oder ein Fehler da, und schon verbrannte die entfesselte Atomkraft die ganze Welt.
Seit Hiroshima stand fest, wer im Besitz von Massenvernichtungsmitteln ist, der ist auch bereit sie einzusetzen.
Wird Chrustschow nachgeben? Oder wird er seiner Atlantikflotte befehlen die Bahamaroute gewaltsam offen zu halten?
Krachte es auch nur ein weiteres Mal in Fernost oder Fernwest, dann hätte das unabsehbare Folgen. Eingekreist die alliierten Truppenteile in Westberlin, draußen nur durch ein paar hundert Meter Mauerwerk und Luftlinie von einander getrennt die zig hochgerüsteten Sowjetdivisionen. Jeder einzelne Mann, Tag für Tag unter dem Deckmantel des Klassenkampfes moralisch auf dieses ‚letzte Gefecht’ vorbereitet, wäre williges und fähiges Werkzeug geworden diesen Lauerzustand in die ‚letzte’ Qualität umschlagen zu lassen. Diese entschiedenste, ausgereifteste Form des ‚Friedenskampfes’ wäre fast zur bösen Vollendung gekommen. Im günstigsten Fall binnen eines Tages, im schlimmsten Fall nach dem Tod der wenigen Überlebenden eines Atombrandes.
Vier Tage und Nächte lang zerrte die Ungewissheit an uns allen.
Nicht wenige NVA Offiziere wurden nervös, das konnten viele nicht verbergen. Sie wussten ohnehin, dass bei zunehmender Reibung gegeneinander wirkender Massen die Spannung nicht endlos zunehmen kann, sondern dass ein gewaltiges Beben die Folge sein muss.
Verrückte meinten: Je eher, je lieber!
Aber Chrustschows Militärstrategen errechneten, dass sie die heraufkommende Auseinandersetzung nicht eindeutig für ihre Seite entscheiden konnten.
Der Kremlführer gab nach. Nach der Kubakrise fiktiv befragt, welche Komponisten er bevorzugt, antwortete der Kremlführer: “Ich liebe Händel, Liszt und (K) Grieg!” Ein makabrer Unwitz, den mir einer der Doktoren des Instituts für Binnenfischerei erzählte.
Geschichte ist, wie wir sie erleben, wie wir dem Zeitgeist erliegen oder widerstehen.
Ungewöhnliche Alltage
Im Januar ’63 herrschte sehr strenger Frost. Aus tausenden Neubrandenburger Schornsteinen quoll der Rauch senkrecht in die blaue, eisige Luft. Massenweise wurden in zahllosen Stubenöfen Senftenberger Briketts verfeuert. Schnee lag wadenhoch auf Äckern und Eisflächen. Den Fischen in den kleineren Seen drohte der Erstickungstod. Gewässer, wie der Woldegker See oder die Hecht-Schleiseen im Raum Lübbenow, die uns der Rat des Bezirkes schon vor Jahren zu Bewirtschaftung übertrug, sind hochproduktiv, aber eben ausstickungsgefährdet. Denn wenn die nur metertiefe Wasserschicht erstens durch Vereisung um mehr als die Hälfte reduziert wird, und zweitens lange Zeiten der Schneebedeckung die Assimilation unterbinden, dann kommt es zur tödlichen Sauerstoffverknappung.
Andererseits können geschickte Fischer solchen Seentypen in guten Jahren tonnenweise wertvolle Speisefische entnehmen. Der Strasburger Stadtsee, nur 12 ha groß, lieferte zuverlässig und das
bei nur einmaliger Abfischung jeweils im September 8o bis 100 kg Hechte pro Hektar.
Ein Riesenertrag! Dagegen gab der ebenfalls sehr produktive Tollensesee jahrein, jahraus an uns nur zwei Kilogramm Hechte je Hektar ab. Laien und Hobbyfischer, wann immer sie die Mengen Fische sahen, die wir den kleinen Seen entnahmen, ärgerten sich regelmäßig. Sie befürchteten immer den völligen Zusammenbruch der Feinfischpopulationen. Sie redeten von ‚Raubbau’, als ob die Gewässer je leer gefischt werden könnten. Eine Annahme, die von der Fangstatistik nicht gestützt wird. Die nämlich beweist jahrzehntelange Kontinuität, vorausgesetzt, die Fänger rühren den Nachwuchs nicht an.
Wenn es in besonders harten und langen Wintern, zur Totalausstickung infolge Sauerstoffmangels kommt, geschieht in den sonst gesunden Seen anschließend das Wunder der Verzehnfachung.
In diesem Winter sollte es unsere besten Hecht- und Schleienseen treffen. Obwohl wir damals, im Januar, Februar ’63 mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehr und vieler Interessenten und Naturfreunde alles zur Rettung der Fischbestände unternahmen, fror das nur ein Meter flache Woldegker Gewässer vollständig aus. Tagelang hatten wir Schnee gefegt. Wochenlang waren die Pumpenaggregate gelaufen. Von einem in gewisser Entfernung gelegenen Eisloch pressten die Helfer das Wasser mit Luft angereichert in andere Löcher der Eisfläche. Doch alle Mühen erwiesen sich schließlich als vergeblich.
Wenn mehr als die Hälfte des Wasservolumens eines Flachsees zu einem gewaltigen Kristallpanzer zusammenfriert, der zudem mit einer Schneematte bedeckt liegt, genügt den Unterwasserpflanzen, und selbst den Algen auch die intensivste ‚künstliche Beatmung’ nicht. Wochenlang dem Dunkel ausgesetzt und somit von der Energiezufuhr abgeschnitten, sterben sie ab. Sämtliche Fische außer jenen Winzlingen, denen es gelingt im meist nur sehr flachem Wasserzulaufbereich zu stehen, ersticken. So rigoros kann ein gewissensloser Bewirtschafter sein Gewässer nicht ausplündern, wie es die “gnadenlose” Natur vermag.
In demselben Jahr der Auswinterung ist natürlich kein Ertrag zu erwarten. Aber im darauf folgenden Fangjahr gestattet ein so vernichtend betroffener See nicht selten eine vier- bis zehnfache Ernte. Jeder Fachmann weiß das. Von tausend übermächtigen Nahrungskonkurrenten befreit wächst eine vermehrte Fischpopulation heran. Auf den “Gesamtverlust” antwortet die Natur mit absoluten Spitzenleistungen.
Ich war dabei. Wir fischten im nächsten Jahr in Woldegk. Meiner Meinung nach hätten wir kein Recht gehabt, schon wieder mit unseren riesigen Netzen da einzufallen, wo der Winter, vor erst achtzehn Monaten, so hart zugeschlagen hatte. Es sollte sich aber erweisen, dass meine eigene Meinung gelegentlich keinen Pfifferling wert ist. Wir waren gewohnt, im Woldegker Stadtsee bis zu eine Tonne “gute” Fische zu ernten. Selbst das gelang nicht in jedem Jahr, weil riesige Krautbänke und ungeheure Mengen Wasserlinsen die Maschen unserer Fanggeräte verstopften. Mitunter kamen wir von unserem Ausflug über Land mit nur wenigen Fischen heim und die Kosten, die wir verursacht hatten, übertrafen die Einnahmen bei weitem.
Im November ’64 setzten wir unser Zugnetz in Woldegk probeweise aus. Der kalte Nordwind pfiff und stieß derart scharf herunter, dass er den See nicht auf übliche Weise zufrieren ließ, sondern zahllose, zehntelmillimeterstarke Eisplättchen bildete, alle nur wenig größer als die Fläche eines Daumennagels. Massenweise trieb uns dieses Gemisch aus Schnee und Eisschuppen entgegen, während wir das Zugnetz herauszogen. Zentnerweise, tonnenweise mussten wir die Menge der Eisblätter, bis zum Ende des Aufzugsvorganges aus dem Garn schütten. Wir befürchteten bereits, wir kämen aus diesem Höllenmischmasch nie wieder heraus. Man kann in solchem Medium nicht schwimmen, nicht rudern, nicht staken, nicht vorwärts kommen. Wer da hineinfällt, der ist, wenn ihm von außen keiner zur Hilfe kommt, verloren. Einmal haben wir, auf dem Tollensesee einen Rennkanuten gerettet, der sich leichtfertigerweise, anscheinend um seinen Weg abzukürzen, in den Bereich einer mehlpampenartigen Eismasse hineingewagt hatte. Dieses Teufelszeug entsteht mitunter als Ergebnis des Eisabganges unter Sturmbedingungen. Windkräfte reiben bei Tauwetterlage gelegentlich die Eisschollen gegeneinander zu einem Brei auf. Der noch unerfahrene Wassersportler befand sich nur zehn Meter von Land entfernt, als er kenterte. Zufällig waren wir in der Nähe. Eine schnell ergriffene Fangleine verhütete den Tod durch Unterkühlung des Jungen, der atemringend bis zu den Achseln im Eisgemisch stand. Er klammerte sich verzweifelt ans Seil und wir konnten ihn herausziehen. Nach zehn Minuten Kampf ums Überleben schwinden unter diesen Bedingungen die Körperkräfte rasant. In Woldegk ließ Neptun zu, dass wir unser Netz herausbekamen und uns selbst befreien konnten. Fische über Fische ernteten wir. Wir zwickten uns ins Fell. Wir glaubten den Augen nicht zu trauen. Sechs Tonnen Karauschen, alles erste Wahl, zwei Tonnen (Portions-) Schleie, eine Tonne Hechte, allerdings kleine Anderthalbpfündige, die am meisten gefragte Größe. Das war mindestens das Siebenfache einer Normaltour.
Hermann Witte sagte trocken: „Dat givt dat nich!” ("Das gibt es nicht")
Und wir ahnten, was er meinte. Acht lange Jahre hatte er den Woldegker See glücklos bewirtschaftet und war schließlich an den Tücken des Gewässers und auch wegen der nächtlichen Übergriffe einiger, wenn auch weniger, seiner so genannten Helfer gescheitert. Sie waren keine Kleptomanen, sondern ganz normale Klauer, die dümmlich lächelnd eine Existenz vernichten konnten.
(Ein besonders übler Bursche prahlte noch, Jahre später, mit seinem Geschick ‚abzusahnen’.) Fleißig arbeitend hatte Hermann immer wieder vergeblich versucht, die Pachtsummen zu erwirtschaften und darüber hinaus soviel Geld zu verdienen, um überleben zu können. Nun fielen uns zu fünft auf eben dieser Wasserfläche binnen weniger Stunden mehr Fische zu, als er insgesamt in zwei Wirtschaftsjahren fangen und in Geld umsetzen konnte.
In diesem Jahr kam Reinhardt Lüdtke zu uns. „Ich werde nie Genosse!” Das war das Zweite, was er mir anvertraute. Aber die Länge hat die Last, sagt man. Viele andere SED-Leute wollten ursprünglich ebenfalls keine Genossen werden. Auch Wilhelm Bartel schwor vor uns Stock und Bein, dass er mit ‚denen’ nie mitmachen würde. Der Leithammel, die bloß ihre persönlichen Vorteile suchten, gäbe es schon zu viele. Mir schien, dass er eigentlich einen schärferen Begriff verwenden wollte. Er hielt sich zurück. Provokationen kamen ihm vielleicht in den Sinn, aber nur höchst selten über die Lippen. Doch wenn Hermann Göck ihm wieder einmal nahe legte, sich der Partei der Arbeiterklasse anzuschließen, dann wehrte Wilhelm sich und zählte auch extreme Beispiele von gewissen Karrieristen auf. „Ne, ne, Hermann Göck, sieh sie dir doch an. Solange die Grenze offen war, haben sie montags noch die Zeitungsschau gehalten und am Dienstag saßen sie schon im Flüchtlingslager Westberlin.“ Einer seiner guten Bekannten hätte ihn schon fast überredet, den Aufnahmeantrag als Kandidat der SED zu unterschreiben, doch nur eine Woche später rief derselbe Mann von Bahnhof Zoo aus an: „Mit eurer blöden DDR könnt ihr mir gestohlen bleiben.“
„Wenn ich nicht ehrlich zu mir selber bün, bün ich ein Halunke!”, pflegte er zu sagen und sog dabei den blauen Qualm wie reine Waldluft in sich und ausatmend bekräftigte er: „Nü und Nümmer!” Daraufhin stellte Hermann Göck den Vorsitzenden zur Rede. Ob Bartel damit sagen wolle, dass alle Genossen unehrlich sind. Der vielerfahrene Mann Bartel krümmte sich wie ein Wurm. Göck schaute ihn durchdringend an.
„In der Zeit der Nazibarbarei haben zehntausende unserer besten Genossen ihr Leben in die Bresche geschlagen. Ich war einer davon! Wir Kommunisten haben aus tiefster Überzeugung der Unmenschlichkeit die Stirn geboten. Auf welcher Seite hast du damals gestanden?”
Wilhelm konnte nichts erwidern.
Ehrenfischer Göck ballte die Faust und schlug mit ihr gegen eine unsichtbare Wand: „Jawohl, so hart und klar muss die Frage gestellt werden. Noch nie in der Weltgeschichte gab es ein so bösartiges System wie das des Verbrechers Hitler und ihr habt das Maul gehalten.” Fischermeister Bartel wusste, dass der Altgenosse die Wahrheit sagte und fragte.
Wenn ihm nur nicht so vieles missfallen würde, was die Partei Lenins betrieb.
Ein Mann wie Bartel hasste die Bespitzelung und die prahlerischen Militärparaden wie die Pest.
Er habe sich in Stalingrad geschworen nie wieder einer Ideologie mit Anspruch auf Weltherrschaft zu glauben, nie wieder durfte ein Deutscher eine Waffe in die Hand nehmen.
Hermann Göck machte einen weiteren Versuch: „Mensch, Wilhelm Bartel. Du bist doch auch ein Arbeiter."
Verlockendes Angebot
Prillwitz liegt am malerisch schönen Südufer der Lieps. Dieses Gewässer ist eines der vielen blau und grün-bunt schillernden Pfauenaugen in der Mecklenburger Landschaft.
Dieter Helm, Vorsitzender der PGH “Heinrich Hertz” spielte mit seiner goldenen Posaune zum Betriebsfest der Fischer auf. Seine kleine Kapelle tönte herrlich. Aber nun schon weit nach drei Uhr morgens, an diesem Junitag des Jahres 1964, konnten selbst die schönsten Töne keinen Tänzer mehr auf das Parkett des Festsaales locken.
Ich ging langsam und nachdenklich zur blendend weiß gestrichenen Anlegestelle für die Fahrgastschiffe hinunter. Da lag die “Fritz Reuter”, das weißblaue Passagierschiff im Dunst des heraufdämmernden Tages und wartete auf uns. Ich wandte den Blick zum roten Gebäude, bevor ich als erster und allein einstieg. Es war das vielleicht schönste der Schlösser der ehemaligen Mecklenburg-Strelitzer Herzöge, das ich sah. Es schimmerte durch die Stämme und das Blätterdach einiger weniger, aber gewaltiger Platanen hindurch.
Dann sah ich beide Göcks ankommen. Auch sie erschöpft, wie man sah, aber beide in heiterer Stimmung. Hermann, hoch gewachsen und schlank, ging wie stets ein wenig nach vorne gebeugt. Sie untersetzt und von sehr fraulicher Molligkeit. Als sie eingestiegen waren, kamen sie näher und lächelten freundlich. Am Nachbartisch nahmen sie Platz. Nach ein paar Minuten der Entspannung schaute Hermann herüber: „Setze dich zu uns!” Ich nahm die Einladung an. Ich mochte beide wegen der Herzlichkeit, die sie mir immer entgegen brachten. Die Sonne, im Begriff aufzugehen, rötete den Himmel im Nordosten und seine Widerspiegelung befand sich am Horizont links über dem Areal, wo das versunkene Wendendorf Bacherswall einst gelegen hatte. „Wie geht es deiner Frau?” Es klang mir nicht nur angenehm, es war echt. Es erinnerte an die erste Begegnung, als Erika mit unserem damals zweijährigen Sohn Hartmut neben Göcks auf der Fischerinsel im Schatten der hohen rauschenden Pappeln an einer Festtafel Platz nahm. Fritz Biederstaedt hatte sie so herrlich arrangiert. Gekonnt war die aus einfachen Klapptischen bestehende, teilweise mit blendend weißen Tischtüchern abgedeckte lange Tafel dekoriert und hergerichtet worden. Die frischen Räucherfische dufteten. Die Menge der Delikatessen bot einen verlockenden Anblick. Die Gläser blitzten im Gefunkel der vom nahen See spiegelnden Sonnenstrahlen. Nicht weniger beleuchtet sahen wir die je dreißig Teller und Tassen.
Für jeden gab es einen ganzen, goldbraun geräucherten Aal.
Das sei ja unglaublich, hatte Helene Göck gerührt ausgerufen, als wir gebeten wurden ungeniert zuzugreifen.
Erika trug an jenem Nachmittag ihr schönes blaues Kostüm, Hartmut eine rotweiße Bluse.
Helene Göck nickte, als ich es erwähnte. Sie denke ebenfalls sehr gerne an diesen Tag und die Harmonie der Feststunden zurück.
Wie es Erika jetzt ginge?
„Danke für die Nachfrage!”, erwiderte ich. „Von der letzten Herzattacke hat sie sich erholt. Es geht wieder bergauf.” Hermann sagte: „Grüße sie von uns!” Dann fuhr er fort: „Wir haben Dich beobachtet.” Seine Augen blitzten auf, als er feststellte: „Du hast dich korrekt verhalten.”
Er meinte wahrscheinlich, ich hätte die Gelegenheit des Betriebfestes nicht genutzt, um mit hübschen Damen zu flirten.
Ich dachte mir meinen Teil. Die anderen kamen inzwischen den nur etwa einhundert Meter kurzen Weg vom Schloss zur Anlegestelle herunter. Hermann Witte paffte eine Zigarre. Er trug einen braunen Schlips zu seinem hellen Anzug und machte ein Gesicht wie ein kerngesunder VEB-Direktor, jedenfalls war er auffallend runder geworden. Wenn er so ging, die Beine nach außen aufsetzend und dabei langsam, genussvoll den Rauch seiner Kubazigarre in die Luft blasend, signalisierte das, sein Glück sei vollkommen. Er trat auf, als hätte er schon Besitz von der halben Erde genommen, zumindest von halb Alt Rhäse. Immerhin standen nun mehr als zehntausend Mark auf seinem Konto. Er besaß ein neues Motorboot und hatte sich einen Bungalow in schöner Uferlage gebaut. Von Woldegker Zeiten, als Fischkisten dreiviertel seines Wohnzimmermöbiliars ausmachten, war keine Rede mehr, ja nicht einmal einen einzigen Gedanken verlor er daran.
Immerhin war ihm im Ausstickungswinter die Idee gekommen, mittels einfacher Stalllaternen, die er an die Eislöcher stellte, die taumelnden nach Sauerstoff ringenden Fische anzulocken um sie mit den vielen vom ihm speziell konstruierten Senken zu fangen. Sonst wären sie verreckt.
In einer einzigen Nacht war ihm gelungen, fast dreißig Zentner hochwertiger Schleien zu überlisten. Augenblicklich gefroren die Schleien zu Stein. Das tötete sie nicht, nicht alle jedenfalls. Denn vierundzwanzig Stunden später, begannen einige der noch in hölzernen Fischkisten im Sortierraum stehenden Fische wieder zu zappeln. Ganz allmählich waren sie aufgetaut.
Hermann Witte schuftete immer, sobald er sah, dass es sich lohnen würde. Sein Pflichtbewusstsein hätte Faulheit gar nicht zugelassen.
An diesem Morgen nach durchfeierter Nacht muss ihm der Gedanke zu Kopf gestiegen sein, dass er nun wer geworden war.
Der Motor des Fahrgastschiffes begann beruhigend zu schnurren. Das Boot legte ab und nahm eine Kurve beschreibend langsam Fahrt an.
„Wie wäre es, Gerd Skibbe, wenn du den Vorsitz in der PwF übernimmst?” Obwohl mich dieses Angebot Hermann Göcks nicht wirklich überraschte, schmeichelte es mir. Er war Mitglied der Bezirksleitung der SED und hätte die Macht gehabt, mich im Verlaufe der nächsten Monate an die Stelle des gesundheitlich doch schon recht angeschlagenen Wilhelm Bartels zu setzen.
Mittlerweile erreichten wir den Alten Graben, den sechshundert Meter langen Kanal zwischen Tollensesee und Lieps.
Was beide Göcks eigentlich wissen mussten: ihre wenn auch unausgesprochenen Bedingungen, konnte ich nicht akzeptieren. Andererseits machte mich diese Versuchung ziemlich nachdenklich.
Durch die Scheiben schaute ich hinaus, sah die Birken, die den Wall der schmalen, gerade wieder ausgebaggerten Wasserverbindung säumten, und dachte, nun bist du fünfunddreißig. Das ist ein guter Zeitpunkt noch mehr aus deinen Möglichkeiten zu machen. Hermann Göck könnte dich nach vorne bringen. Ich käme meinem Ziel, einen Studienplatz an der Fischerei-Ingenieurschule in Hubertushöhe zu bekommen, näher.
Zudem ging es in der DDR sichtlich voran. Wer es sich leisten konnte, fuhr ein Auto, zumindest einen P50. Die Schließung der Grenze lag jetzt drei Jahre zurück und je länger ich das Eingesperrtsein erlitt, umso mehr gewöhnte ich mich an diesen Dauerschmerz, der immer mehr abnahm.
Nachdem ich mir ersparte, immer wieder bewusst dem Verlust der Freiheit nachzutrauern, konnte ich ganz gut mit den Verhältnissen leben. Schließlich bedeutete mir meine Frau und meine beiden Söhne das höchst denkbare Glück.
Göcks betrachteten mich geduldig. Ich bemerkte, dass sie mich wieder beobachteten. Ihnen war klar, dass es mich reizte, ihr Angebot anzunehmen: „Du kannst doch mehr als Fische zu fangen. Komm zu uns in die Partei! Wirf deine Bedenken einfach über Bord.”
Bis jetzt hatte ich mich ziemlich eng an Polonius guten Rat gehalten: „Sei dir selber treu!” Und das hat seine Konsequenzen: „Daraus folgt wie Tag der Nacht, du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen.”
Zwanzig lange Propagandajahre hatte ich mich aus meinen Gründen gegen den auch mich gelegentlich nicht wirkungslos anfallenden Atheismus gestellt.
Kaum eine andere Sache hatte mich mehr beschäftigt als die dazu gehörenden Fragen. Mein Fazit war, dass meine Mitmenschen nicht als Folge von Bemühungen Atheisten geworden waren, sondern nach meiner Erfahrung ist es umgekehrt.
Der Atheismus ist ein Naturgewächs. Es entspringt unserem Wesen und diesem Wesen entspricht, dass wir wie Wasser den Weg des geringsten Widerstandes suchen. Kulturgeschöpfe aber, wie der Glaube, unterliegen dem Zerstörungstrieb der menschlichen Natur. Gegen diese Natur bedarf es der Anstrengung, nicht zu zerfließen.
Schlimmer! Meinem Verständnis nach war und ist der allgemeine Atheismus, eben weil er natürlich ist, das Einfallstor für Opportunismus und inneres Chaos. Viele Genossen waren Opportunisten, auch wenn sie das vehement bestritten. Wenn ich sie an dem maß, was sie mir sagten, glaubten die meisten ihrer Partei nicht.
Sie ordneten sich ihr nur aus taktischen Gründen unter. Sozialismus war für sie und mich dasselbe. Nämlich als Realität, einem überstrengen herrschsüchtigen Vater vergleichbar, der neben seiner eigenen, keine andere Meinung gelten ließ. Es gibt keinen Menschen, der das mag.
Mit dieser Absicht balancierten seine Cheferbauer frech am Rande des Untergangs der Menschheit.
Was er uns sonst anbot, waren pure Versprechungen. Dieselben nämlich, die seine Verteidiger und vorgeblichen Verehrer den in Saus und Braus lebenden Kirchenfürsten vergangener Epochen ankreideten. Es war wie diese Vertröstung der Kirchen aufs Jenseits: Wenn wir erst den Kommunismus verwirklicht haben! Dann!
Von den Kanzeln wurde es seit urdenklichen Zeiten herabgepredigt: die Ewigkeit müsst ihr im Blick haben, nicht die Gegenwart.
Während ich an diesem herrlichen Sommermorgen in der Ecke der blaugepolsterten Sitzbank auf dem blinkend neuen Fahrgastschiff saß und die bunten Bilder der bezaubernd schönen, sich ständig verändert darbietenden Landschaft in mich aufnahm, wankte ich, und fragte mich, ob ich richtig dachte und ob ich der Wirklichkeit mit solcher Beurteilung gerecht wurde.
Wir fuhren nun der gleißenden Sonne entgegen.
Der Tollensesee hatte uns wieder.
Das Seewasser rauschte wieder kräftiger. Das Fahrgastschiff nahm große Fahrt an.
Beide Göcks recht ermüdet sagten übereinstimmend: „Lasse dir Zeit, Gerd. Überlege es dir.” Ich überlegte ernsthaft. Wenn ich mich an diesem frühen Morgen nach Hause begeben würde, müsste ich an mindestens zwölf Schrifttafeln vorbeigehen, alle gefüllt mit den jeweiligen Parolen der Partei der Werktätigen des Landes. Die erste Botschaft würde mir bereits auf der Anschlagtafel am letzten Bootshafen begegnen.
Ich würde sie nicht aufmerksam lesen, doch ich kannte den Text längst auswendig. Ihre Gedankentropfen würden mich treffen, ob ich wollte oder nicht.
Dann rückte bereits am Haus der ‚Gesellschaft für Sport und Technik’ der zweite SED-Spruch, einigen Quadratmeter groß, in mein Blickfeld. Es war die Aufforderung, den Frieden wehrhafter zu machen.
In der Lessingstraße empfing mich dann die dritte Losung.
Zwei weitere würden meine Aufmerksamkeit schon wenige Schritte später beanspruchen. Sie hingen an der Frontseite der EOS (erweiterte Oberschule). Die „Ewige, unverbrüchliche Freundschaft mit der Sowjetunion” beschworen sie, und die Behauptung, dass die Bonner Ultras auf Kriegskurs sind.
In meiner Aufzählung, die ich schweigend vornahm, kamen nun die beiden an den Gebäuden des Wehrkreiskommandos.
Da hieß es, dass der Weg zum Sozialismus gesetzmäßig sei. Was da nicht niedergeschrieben stand lautete: - notfalls mit der Waffe - .
 Zwei weitere Plakate hingen im Kinobereich. Der wahre Zweck wurde verdeckt:
Zwei weitere Plakate hingen im Kinobereich. Der wahre Zweck wurde verdeckt:Ich musste an den Bahnhofsvorplatz denken. Auf der rechten Seite, neben dem HO-Kleidungsgeschäft befanden sich zwei große Holztafeln. Auf einem der beiden Schilder stand bereits monatelang Weiß auf Rot: „Die SED ist die höchste Form der gesellschaftlich-politischen Organisation der Arbeiterklasse, die führende Kraft der sozialistischen Gesellschaft. Die Partei gibt diesem Kampf Richtung und Ziel.”
Unentwegt fielen diese Tropfen. Sie bildeten in unseren Hirnen Kalkstein. Niemand entkam diesem Einfluss. Wie die Luftfeuchtigkeit war der Parteigeist allgegenwärtig. Es war die Machtfrage: Wer wen?
Fortschritt durch Diktat! Jedes Menschenhirn empfand diese Kombination als grundfalsch, weil unzumutbar.
Wo bewirkten Zwang und Indoktrination jemals Gutes?
Nicht wenige Genossen hatten mir ihre Aversionen enthüllt.
Oder waren das nur die Spötteleien von Menschen über ihren herrschsüchtigen Vater, den sie trotz alledem liebten?
Als wir anlegten am Steg vor dem Badehaus und von Bord gehen wollten, umfasste Hermann Göck mit seiner Rechten meine Schulter. „Bleibe ruhig. Sage mir, wenn du soweit bist!”
Seiner Überzeugung nach hing mir eine überholte Denkweise an, wie einem alten Galeerensträfling eine verrostete Kette. „Du musst dich befreien!”
Ihm war auch nicht annähernd klar, was er forderte. Allein seine Vorstellung, dass Erkenntnisse fesselnde Funktionen haben sollen, verwunderte mich. Er war unfähig zu erkennen, dass mir die Freiheit des Denkens so viel bedeutete.
Wenige Wochen später trat Wilhelm Bartel überraschend der SED bei. Im Rausch, eben weil er fast nie trank, müssen ihm kurz zuvor ungeheure Beleidigungen führender Genossen über die Zunge gerutscht sein. Es war nicht Bartels Art, Menschen anzugreifen oder zu kränken. Er gehörte zu den Friedlichen. Einer der Stasioffiziere, die als Freizeitfischer bei uns verkehrten, wollte es angeblich gehört haben. Er nahm den kleinen Vorsitzenden beiseite. Er müsse Hermann Göck unterrichten.
Bartels Verunglimpfungen hätten ein Nachspiel. Er sei immerhin der Vorsitzende einer sozialistischen Produktionsgenossenschaft.
Ich meine: Wilhelms Argumente gegen die Partei können nur pragmatischer Art gewesen sein. Ihm konnte allenfalls das Missgeschick unterlaufen sein, sich mehrdeutig ausgedrückt zu haben.
Aber wie wollte er seine Unschuld beweisen?
Er soll auch gesagt haben, Hermann Göck sei selber schuld daran gewesen, dass er ins KZ kam. Göck wäre ein Übertreter.
Ein fataler Fehler.
Wilhelm gab zu erkennen, dass er außerstande sei, sich an irgendetwas zu erinnern. Aus der Angst, in die sie ihn versetzten, sowie aus der Befürchtung heraus, er könnte seine innere Sicherheit verlieren, auch aus Reue und getrieben von dem Wunsch die Kränkungen wieder gut zu machen, die er angeblich Männern wie Hermann Göck zugefügt hätte, bat Wilhelm Bartel um Aufnahme in die Partei.
Anders glaubte er seine Loyalität, wie er plötzlich befürchtete, nicht mehr belegen zu können. Ich sah ihn unmittelbar nach dem gewichtigen Gespräch in dem ihm vorwurfsvoll gesagt wurde, wozu er sich habe hinreißen lassen.
Grau und reuevoll in sich gekehrt sah Wilhelm aus, wie einer, der im Zustand der Volltrunkenheit Vater und Mutter erschlagen hat.
Ihm sollte Biederstaedt folgen.
Doch wie Fritz Biederstaedt es mir erklärte, verblüffte mich.
Wenn es hochkommt, war das Leben ein Traum
Ende Februar ‘65 ernteten wir Rohr. Neben Fritz Biederstaedt lief ich den zwei Kilometer langen Weg zu den Neubrandenburger Torfwiesen. Unsere Sicheln in der Hand marschierten wir und tauschten unsere Gedanken aus, die sich zunächst nur auf die Arbeit bezogen. Ein Rohraufkäufer bot uns für je drei Stunden Schinderei fünfunddreißig Mark. Für je ein Schock Rohr sollten wir diesen Betrag erhalten. Sechs Stunden konnte man täglich die Qual solcher Anstrengung durchhalten. Zwei Paar solide Halbschuhe ließen sich dann für diese siebzig Mark erwerben. Das war viel.
Rohrschnitt bedeutete, mit einer auf halbe Sensenlänge gestutzten Schnittfläche Rohrhalm für Rohrhalm möglichst bodennah abzuschneiden.
Wir zogen unsere blauen Wattejacken aus und begannen. Je einen Arm voll Rohr nahmen wir und ratschten, was wir so festhielten, mit unseren Kleinsensen ab.
Fritz wandte sich bald nach links, ich in die andere Richtung. Nach mehr als zwei Stunden rückten wir wieder aufeinander zu. Wie eine Erntekombine, die mitten durch ein Maisfeld fährt, schufen wir Schneisen und Räume, die sich ständig veränderten. Seine braune Schiebermütze schief aufgesetzt, mit seinen schwarzen hochschäftigen Lederstiefel im Morast patschend sah ich ihn in dreißig Meter Entfernung eifrig rackern. Plötzlich hielt er inne. Fritz drehte mir sein großes Gesicht zu. Er hatte bemerkt, dass ich ihn beobachtete. Seine Rechte umklammerte den ellenkurzen Sichelstiel. Er kam auf mich zu. Der schwarze Torf spritzte. Seine braunen Augen funkelten. Ihm war anzusehen, dass er mir Wichtiges mitteilen wollte. Fritz presste einen knappen Satz heraus: „De Partei will uns de Sääl ut den Liev rieten!” ("Die Parti will uns die Seele aus dem Leib reissn!") Er lächelte, wog den Kopf. Sofort wusste ich, was er meinte. Natürlich, das war ja mein Grund mich zu widersetzen. Ich kam nicht dazu ihm beizupflichten, denn er vollendete, morgen werde er den Antrag stellen, Kandidat der SED zu werden. Mir schien er hätte mich und sich kopfgestellt. Nein, es war alles in Ordnung. Äußerlich jedenfalls.
Ich sah eine Szene, die er mir bereits früher schilderte. Ich sah ihn als jungen Diener im Hause seiner Herrschaft, wie er in einem Streitfall vor Wut kochte und dennoch pflichtbeflissen lächelnd dastand.
Auf dem letzten Teil des Hermarsches hatte Biederstaedt bereits unentwegt auf Ulbricht und Anhang mehr geflucht als geschimpft.
Nun erklärte er mir: Diese Leute würde er dennoch ab sofort seine Genossen nennen. Mir verschlug es die Sprache. Ich stotterte hilflos und war verwirrt: „Fritz! Wenn du so denkst, kannst du doch nicht ...!”
Er schüttelte den kaum ergrauten Kopf. Mit der Wahrheit käme man nicht weit. Ich betrachtete seine helle, fliehende Stirn und fragte ihn und mich. Wohin willst du gehen, wenn nicht auf die nächste, bessere Erkenntnis zu? „Wenn du wat warn wisst, denn mösst du dat!” 166, erklärte er kurz und bündig. Er sei nun neunundfünfzig geworden und für die letzten vor ihm liegenden Lebensjahre hätte er sich noch viel vorgenommen. „An de twintig Johren hew ich noch!” 167 War das mein guter, alter Biederstaedt? Wir schauten einander an. Aber weder er noch ich sahen weit genug. Jedenfalls seinen Todesengel, der ebenfalls mit einer Sense bewaffnet, direkt hinter ihm auftauchte gewahrten wir nicht. Wir ahnten gar nichts. Genau 146 Lebenstage lagen noch vor ihm.
Anfang Juli warf ihn ein schwerer Schlaganfall aufs Sterbelager.
Als die Sargträger Biederstaedt mit seiner letzte Behausung in die Grube nieder senkten, überkam mich ein Gefühl der Wehmut.
Er war ein unerschrockener Kämpfer gewesen. Nicht immer konsequent und oft gewillt, auch das offensichtlich Falsche zu tun, nur um der Illusion zu folgen, schneller glücklicher zu werden. Seine eigene Logik hatte er niedergerungen und trotzdem gehofft, das letzte Größte sei auch für ihn erreichbar.
Fand ich mich nicht in ihm wieder? Fanden wir uns nicht allesamt in ihm wieder? Stachelte mich nicht viel zu oft etwas an, gegen meine Einsichten zu handeln?
Über den blaugrünen Omorikafichten, die sein Grab beschatteten, dehnte sich ein ungeheurer Himmel. Sachte trieben die Wolkengebirge über uns dahin. Das ganze Leben ist voller Widersprüche. Es gibt kein Leben ohne Gegensätze.
Meinen bunten Nelkenstrauß versuchte ich behutsam auf den in der Grube dunkel schimmernden Deckel seines Sarges niederfallen zu lassen. Drei Sekunden lang, während weicher, weißer Sand durch meine Finger rieselte, versprach ich ihm, ihn niemals zu vergessen. Er und ich, wir hatten zu viel erlebt, um nicht zu wissen, dass die Wahrheit sich nicht nach unseren Wünschen richtet. Irgendwie wussten wir, dass sie etwas unbeugsam Ehernes an sich ist, wie eine unendliche Gerade. Die Wahrheit rankt sich nicht um uns. Sie kann sich niemals anpassen. Wir müssen es. Deshalb sind wir ihr bis zur Todesstunde verpflichtet.
Wir beide wussten es. Jeder Lüge folgt die unsichtbare, gnadenlose Hand, um ihre Zinsen für den scheinbar freigebig gewährten Kredit einzufordern.
Reuig oder nicht, wir haben den Preis zu entrichten.
Als alle davongingen, wandte ich mich noch einmal nach seinem Ruheplatz um. Uns will scheinen, dass der Lauf der Welt sich ändert, wenn ein Freund von uns geht.
Es geschieht tatsächlich. Wenn wir nachdenklich in uns gehen, verändert uns selbst ein letzter Abschied ein wenig mehr zum Guten.
Karpfenwiederfang mit Hindernissen
Fritz Biederstaedt hatte ein Jahr zuvor noch mit den meisten anderen gegen mich gestimmt. Deshalb wurden einige Landseen intensiv mit Karpfen besetzt. Ich hielt es für eine Verschwendung von Zeit und Getreide, in natürlichen Gewässern wie in Teichwirtschaften zu operieren. Die Camminer Seenkette, namentlich der Gramelower und der Camminer See, wurden geradezu mit Karpfensetzlingen gespickt. Geplant war eine Steigerung der Karpfenproduktion um dreihundert Prozent auf mindestens dreißig Tonnen jährlich. Sechzig Tonnen Futtermittel, Weizen oder Mais müssten zugefüttert werden.
Die Vorstellung, dass zwei Männer im Bereich der herkömmlichen Produktion fehlen und das Bild von den Kornmengen, die ins Wasser geschüttet würden, gefielen mir gar nicht.
Immerhin, es ging nach Beschlusslage, die noch vom Bezirksfischmeister Ernst Stöckelt eingebracht worden war.
Frühestens Mitte November sollten die geplanten 12 Tonnen Weihnachtskarpfen auf dem Gramelower See gefangen und in speziell gefertigte, geräumige Holzhälterkästen bis zum
Festtagsverkauf gesetzt werden.
Aber Planung und Leben sind natürlich zweierlei. Exakt Mitte November 1965 brach vorzeitig der Winter über das Land herein.
Eisiger Sturm fegte über Wälder und Seen. Nun war nur zu hoffen, dass die Gewässer, wennschon - dennschon richtig zufroren, damit wir tragfähige Eisflächen bekamen. Die ersten fünf Zentimeter Eisstärke wuchsen in zwei Nächten heran. Der Wetterbericht sagte anhaltenden Frost voraus. Hoffentlich hielt die Natur, was die Meteorologen versprachen. Am fünfundzwanzigsten maßen wir erst zehn Zentimer Eis, trotz der enormen Kälte. Die tiefen Seen wie der Tollensesee zeigten noch nicht die Spur von Wirkung, ihre Wärmeschichten wurden nur langsam abgebaut und ausgetauscht. Erst wenn die Wassersäule durchgehend vier Grad Celsius erreicht, beginnt die Winterstagnation, dann kann der Frost die Wassermoleküle zwingen kristalline Strukturen anzunehmen. Bis dahin sinken sie immer wieder die Tiefe ab. Selbst kleinere Gewässer weisen bei vorzeitigem Wintereinbruch noch beachtliche Wärmekapazitäten auf und die Eisbildung erfolgt deshalb im Spätherbst verzögert.
Endlich am 1. Dezember durften wir es wagen, den Gramelower See mit schwerem Geschirr zu belasten. Auf gewohnte Weise kippten wir die Schlittenfuhre ins “Inlett”. Stets unterstand der linke Flügel mir. Auf ‚meiner’ Seite arbeitete sich Hermann Witte mit der Stoßaxt schnell voran. Wir konnten ihm nicht folgen. Natürlich ging es zu langsam. Erst die Hälfte des Fanggeschirres hatte die parallel zum Ufer verlaufende Strecke zurückgelegt. Beide Flügel müssen sich unter dem Eise ausbreiten wie zwei Arme, die sich nach und nach möglichst schnell ausstrecken. Die Vorderstücke des insgesamt zweimal vierhundert Meter langen Netzes sollen eigentlich ohne großen Kraftaufwand jeweils an die entgegengesetzt liegenden Eckpunkte befördert werden.
Dorthin zieht man diese Wadenstücke, wenn genügend Kräfte zur Verfügung stehen, normalerweise mit bloßen Händen.
Aber wir mussten sie an diesem Morgen mit Gewalt heranwinden. Sofort, als sich diese Unnormalität bemerkbar machte, hätte ich handeln müssen. ‚Etwas’ stimmte nicht und dieses Etwas war von mir verursacht worden. Auf meine Weisung hin wurden gegen den Rat des erfahrenen Witte zu wenige Steine von der Unterleine abgebunden. Noch war ich starrsinnig. Es musste auch so gehen, meiner Meinung nach.
Am anderen Flügel schien es ebenfalls zu hapern. Die kämpften mit ähnlichen Schwierigkeiten. Das sah man.
Gruß und die Reinigerbrüder waren doch auch keine Neulinge.
Wiegenden Schrittes, aber schon in Eile, kam Hermann schließlich auf uns zu, nachdem er bereits die Hälfte des knapp fünfhundert Meter langen Weges vom Ost- zum Westufer in den geforderten Zwölffußschritt-Abständen durchlöchert hatte und wir uns immer noch am Umlenkloch aufhielten. Ihm war klar, woran das lag. Jede seiner Bewegungen verriet, dass er zunehmend in Wut geriet. Hermann schaute mich aus zusammengekniffenen Augenlidern an und knurrte: „Dat möt ännert warn!” 168
Zweimal schlug er heftig die Arme über Kreuz.
Mit verzerrtem Gesicht und ohne mich zu fragen handelte er. Er nahm die Eisaxt und vergrößerte das Eisloch vor unseren Füßen ums Doppelte auf sechs Quadratmeter Fläche. Ich wusste, was er vorhatte. Es war in dieser Situation richtig und ich biss mir auf die Zunge. Wenn die übermäßig beschwerte Grundleine des Zugnetzes an wahrscheinlich sogar mehreren Stellen in den weichen Seeboden einschneidet, dann gibt es nur eine Konsequenz: Steine abbinden!
Da ich noch zögerte, riss Hermann mir abrupt die Oberleine des Zugnetzes aus der Hand. Er presste die schmalen, blauen Lippen zusammen, haspelte sich bis an die Unterleine, nahm sein Messer, schnitt den ersten Wadenstein ab, dann den nächsten und so fort. Er fluchte. Ich fluchte zurück.
Durch einen Schicksalsschlag verbittert, war ich zu hart geworden.
Mein Vater nahm sich vor erst sechs Wochen das Leben und ich musste mit dem Selbstvorwurf fertig werden, versagt zu haben. Hätte ich doch mehr Zeit verwandt, um ihn aus seiner tiefen Depression herauszureißen. Mir war es ja fast gelungen. Aber immer ging die Arbeit vor.
Hermann begann sogar die vorderen Wadenstücke zurückzuziehen, ohne meine Mithilfe und Mitsprache zuzulassen. Pure Übertreibung war das. Klafter um Klafter holte er die Unterleine heraus, legte sie aufs Eis, hielt sie mit dem Fuß fest, und, ratzbatz schnitt sein Messer.
Als wäre ich Luft für ihn handelte er, als wäre er und nicht ich für diesen Flügel des Gesamtnetzes verantwortlich. Zum Überfluss beorderte er ein paar jener Helfer, die sich immer einstellen, um ein für sie so seltenes Ereignis wie die Eisfischerei mitzuerleben, zum fünften Eisloch in etwa vierzig Meter Entfernung. Dort sollten sie von Hand die acht Millimetervorderleine soweit ziehen, wie möglich, bis nämlich der meterlange Buttknüppel, der dem ersten Stück vorangeht, sich quer vor das nur waschschüsselgroße Eisloch legt.
Ich fühlte mich mehr als angestachelt die Initiative wieder an mich zu nehmen. Noch war ich nicht der Fangleiter, noch kein Brigadier, aber dieser Flügel war ‚meiner’. Was suchte er überhaupt auf meiner Seite?
„ Hau ab!”, fauchte ich ihn an.
Wir bellten uns an, wie zwei Straßenköter. Der aufkommende scharfe Morgenwind sauste und fegte Eispartikel über die stellenweise bloßliegende graublaue Eisfläche. Der Schnee knirschte unter unsern Gummistiefeln. Von der Sonne und angenehmeren Temperaturen keine Spur. Grau in Grau der abweisende Himmel. Die jungen Männer zogen das bereits von fast allen Zugnetzsteinen befreite Buttstück weiter. Wir aber befanden uns dreihundert Meter von ihnen entfernt auf halbem Weg zwischen Wadensack und der Umlenkstelle. Hermann vergrößerte immer noch ein Loch ums andere laut schimpfend, zerrte, zog, schnitt. Da platzte mir der Geduldsfaden, ich entriss Hermann die Leine. Im Begriff sein scharfes Messer, das auf dem Eis lag ins Loch zu stoßen, richtete er sich im Zorn auf, griff augenblicklich zum Stiel seiner in die Eishaut hineingedroschenen Axt, die griffbereit dastand weil er sie ins Eis, wie in einen Haublock hinein geschlagen hatte.
Die Axt machte mir keine Angst. Zuschlagen würde ein Hermann Witte nicht. Nicht er und schon gar nicht hier.
Wirklich nicht?
Ich schaute ihn ebenso grimmig an wie er mich. „Hau bloß ab!”, entfuhr es mir erneut und scharf. Da warf er die große, langstielige Axt mit einem Ausdruck von maßlosem Hass von sich, als schleudere er einen Knüppel weit über die Eisfläche. Das Eisen surrte über das Glatte in eine Schneewehe hinein. Er kehrte mir danach den Rücken zu und ging, stürzte, den Kopf wie ein Wildkater nach vorne gestreckt, immer schneller, lief davon, raffte seine geflickte Wattejacke auf und rannte dem Festland zu in Richtung Camminer Bahnhof.
Ich rief hinter ihm her, bereute meine Reaktionen. Aber er ließ sich nicht aufhalten. Mit uns Idioten wolle er nichts mehr zu schaffen haben.
Mir legte sich eine zusätzliche Last auf den Brustkorb. Aber es musste weitergehen. Am anderen Flügel in einem halben Kilometer Entfernung unternahmen sie anscheinend dasselbe, was Hermann zuvor auf meiner Seite getan hatte. Der Grund des Gramelower Sees war zu weich für unser grobes Geschirr. Dieses Gewässer bewirtschafteten wir erst seit kurzem. Uns fehlte die Erfahrung, soweit es seinen Seeboden betraf.
Mittlerweile hatten wir das Netz im Halbkreis unter der Eisdecke auf voller Länge ausgebreitet. Wilhelm Bartel, der immer noch scheinbar gleichmütig am Einlassloch neben dem Wadesack stand und aus der Ferne winzig wirkte, winkte plötzlich. Er gab das Zeichen: Jetzt bewegt ihr die Hökelsteine, alles in Ordnung! Wir wussten, was sich da tat. In halbem Schritttempo rutschte nun der riesige Garnbeutel in die Tiefe.
Nun ging es ums Ganze.
Allerdings war, wie sich noch herausstellen sollte, erst die halbe Arbeit geleistet und immer noch zu wenig Rundsteine entfernt worden.
Schon waren statt der üblichen zwei Stunden bereits fast vier vergangen. Die bereits am anderen Seeufer windenden Männer stöhnten und schwitzten. Sie drehten an den Knüppelwinden als hätten sie schwere, hochbeladene Ackerwagen aus einem Lehmloch herauszuwühlen.
Plötzlich krachte es wie Karabinerschüsse. Nahezu gleichzeitig waren auf beiden Flügelseiten die Sechszehnmillimeterseile geplatzt. Ächzend hatten sie solange die Windenschlitten an Land festgehalten. Rechts und links des Schlittens flogen die uns helfenden fremden, ahnungslosen, kräftigen langen Kerle wie von Kinderhand geworfene Zinnsoldaten zur Seite und zu Boden. Als wären sie Pappkameraden.
Die Windenschlitten waren fünf, sechs Meter in Richtung See katapultiert worden.
Böse Folgen hätte das haben können. „Ist ja nichts passiert”, beruhigte ich mich.
„Es hätte aber auch Schwerverletzte, wenn nicht Tote geben können”, konterte mein Verstand. Aus einigen Metern Entfernung war ich nur Zuschauer gewesen. Eigentlich durften wir nicht zulassen, dass Fremde sich einschalteten. Aber wir waren ja froh, wenn sich Leute fanden, die ohne lange zu fragen mitmachten. Etwa zehn Männer, zur Zeit tätigkeitslose LPG-Traktoristen, halfen uns mittlerweile.
Fast mehr als wir fieberten sie dem Fangerfolg entgegen.
Sie gaben sich nicht so schnell geschlagen. Die Kerle mit ihren schier überschäumenden Körperkräften, die froh waren sich regen zu dürfen, rappelten sich schnell wieder auf, wollten ungestüm weitermachen. Deshalb machten sie sich wieder an dieselbe Arbeit.
Nein!
Wahrscheinlich war sich keiner der Gefahr bewusst, in der er sich befunden hatte. Jetzt hieß es, sich vor Hermann Wittes Einsicht zu beugen: „Sämtliche Steine ab!” Wenn das Zugnetz in voller Länge durch den Seeboden schneidet, dann lässt es sich zwar noch eine Weile vorwärts bewegen, aber der Gesamtwiderstand wächst unaufhörlich. Ein Fischer schrie den anderen an.
Wilhelm Bartel hatte es angemahnt, sich aber nicht durchsetzen können. Wozu bedurfte man in einem flachen Gewässer der Beschwerungen an den Unterleinen? Die Steine sollen ja lediglich dem Zweck dienen in Seen, die tiefer sind als das Netz, den Schwimmern an den Oberleinen entgegen zu wirken. Denn von Ausnahmefällen abgesehen, soll das Zugnetz ‚Grund halten’.
Jetzt galt es, das unregelmäßig ausbuchtende Netz unter der undurchsichtigen Eisdecke zu finden und es dann partiell aus dem Morast zu heben. Wir wussten, dass auch dieser Befreiungsversuch nicht ungefährlich sein würde. Denn die überbeanspruchten Unterleinen schießen erfahrungsgemäß, wie starke bis zum Reißen gedehnte Gummiseile augenblicklich vor, sobald sie auch nur teilweise aus der Tiefe des Morastes gezogen werden.
Den übereifrigen Traktoristen mussten wir einschärfen, dass sie unter keinen Umständen das unter Hochspannung stehende Garn festhalten dürfen. Jederzeit muss es reibungslos aus den Händen gleiten können. Eben wie der unberechenbare Netzdruck das erfordert.
Ein ostpreußischer Wadenmeister war ertrunken, weil sich eine einzige Masche des Netzes unbemerkt an seine Eiskrampe geheftet hatte. Ihm war es widerfahren, dass ihn ein jäher Netzruck plötzlich davonschießender Leinen zu Boden warf und ihn mit hineinriss ins große Inlett, wahrscheinlich gleich einige Meter weit unter das Starkeis. In solchem Fall gibt es keine Rettung.
Nachmittags nach drei Uhr, nach weiterer vierstündiger Arbeit, hatten wir zehn Fischer und unsere zu allem entschlossenen Helfer, den Eispanzer an achtzig bis hundert Stellen aufgebrochen und schwer schuftend das gewissermaßen eingeklemmte Zugnetz im Wesentlichen befreit. Mehr als einmal riss mir bei dieser Arbeit der Gegendruck das Netz gewaltsam aus der Hand. Hoffentlich war uns gelungen auch den letzten der insgesamt dreihundert Wadensteine zu finden und abzuschneiden.
Hier und da schlängelten sich Aale im Schnee und auf dem nackten Eisboden, die auf erheblich unsanfte Art aus ihrem Winterquartier ans Tageslicht befördert worden waren. Unsere fleißigen Hilfsfischer freuten sich, als wir jedem erlaubten, zwei Aale einzusacken. Nur wenige Männer hatten vorsorglich einen Fischbeutel mitgebracht. Aber das sprichwörtliche ‚Not macht erfinderisch’ half ihnen. Einer zog seine Strümpfe aus und fuhr mit den Socken zurück in die Stiefel, ein anderer band die Hosenbeine seiner Oberhose zu. Endlich, als es bereits dunkel geworden war, spürten wir, dass unser Zugnetz sich wieder bewegen ließ.
Die zerfetzten Schlittenleinen hatten wir längst provisorisch verknotet, das Drahtseil wieder aufgerollt. Wenn auch nur dezimeterweise, es ging voran. Schließlich erschienen im Aufzugsloch über dem sehr flachen Wasser die Buttstücke. Endlich war klar, dass wir es schaffen konnten, ohne erneut an diversen Stellen das Eis aufzubrechen, um nachzuhelfen.
Nie wieder würde ich mich leichtfertig über die Meinung eines Mannes hinwegsetzen, der über mehr Berufs- und Lebenserfahrung verfügte, als ich. Selbst bester Wille kann zwei von Enttäuschungen erfüllte Jahrzehnte nicht ersetzen. Vielleicht ist das der Sinn unseres Lebens, dass wir durch bittere Erfahrung klüger werden. Anderthalb Stunden später sprudelten unsere meist zweieinhalbpfündigen Weihnachtskarpfen im Wadensack sowie eine stattliche Anzahl großer Zander, Hechte, Barsche und - was wir erst dreißig Stunden später bemerkten, nachdem wir auch den letzten Zentner Fische verladen hatten - fast vierzig Stück Aale. Die hatten wir ausgepflügt.
An jenem späten Abend ahnten, hofften wir nur, wir hätten tatsächlich die Hauptmenge der gesuchten einhundertundzwanzig Dezitonnen Karpfen gefunden und gefangen.
So verlangte es der Plan von uns.
An Land, unterhalb des graudüsteren Wiesenhanges, loderte ein noch eher kleines Lagerfeuer auf der Viehkoppel. Inzwischen allerdings transportierten die teilweise mit ihren Traktoren vorgefahrenen LPG-Männer große abgestorbene Erlenbäume herbei und bald erhellten die prasselnden Flammen das Gelände in einhundert Meter Umkreis taghell. Zwölf Stunden abenteuerlicher Geschäftigkeit lagen hinter uns und vor uns stand die Arbeit der Verladung und des Transportes der ersten Fuhre Karpfen, um sie in die bereitstehenden Fischbehälter im Oberbach einzusetzen.
Ein neuer Trecker kam durch die Nacht polternd mit einem Hänger angefahren, wir kümmerten uns naturgemäß nicht um ihn und das, was die Männer trieben. Plötzlich jedoch bemerkten wir, was vor sich ging. Die sorglosen Burschen warfen eine Anzahl übermannshoher Treckerreifen mit Schwung vom Fahrzeug ins Feuer hinein. Wenig später begannen die lichterloh brennenden Reifen zu krachen. Sie nährten ein Feuer wie ich es nur einmal, in meinen Kindertagen in Wolgast bei einem von Wind forcierten Brand einer randvoll mit Stroh gefüllten Scheune gesehen hatte. Zur Buße meines Verhaltens Hermann gegenüber auferlegte ich mir, die Nachtwache zu halten. Mir war allerdings klar, wenn ich Herr der Lage sein wollte, mussten erst die Helfer völlig zufrieden gestellt werden, dann ebenfalls angemessen anteilig die Nachzügler, die von den drei Dörfern Cammin, Gramelow und Riepke vom Licht magisch angelockt worden waren, um beim Verladen der Fische zu helfen.
Der Mann, der sich die Hosenbeine zugebunden hatte, damit ihm die durch seine Körperwärme lebhafter gewordenen Aale nicht entwischten, stand unauffällig im Halbschattenbereich, bis er aufgefordert wurde einen Bottich Fische zu tragen . Er zögerte, doch seine Mittraktoristen machten ihm Beine.
Während er unbeholfen ein paar Schritte ging, platzte das Band. Er bewegte sich gerade in diesem Augenblick mitten in die hellste Lichtzone hinein, als sich sein Raub selbständig machte. Drei Zander und zwei Aale kamen zum Vorschein. Aller Blicke wurden durch einen Aufschrei von einem der Helfer auf das nun wie im Rampenlicht dastehende Mannsbild gelenkt. Unleugbar, er hatte sich gegenüber allen anderen erhebliche Vorteile verschafft. Niemand hätte ihn getadelt wäre er mit zwei Zandern und zwei Aalen zufrieden gewesen. Aber das andere, noch luftballonartig aufgeblähte Hosenbein verriet seine durch nichts zu entschuldigende Unverschämtheit. Das prall ummantelte Bein gemessen an dem nun so unglaublich dünnen anderen, stempelte ihn in aller Augen zu einem gemeinen Dieb.
Die stämmigen Treckerfahrer regelten das untereinander.
Der da hatte eine unsichtbare Grenze überschritten. Bloß einen großen Karpfen und einen Aal ließen sie ihm. Von Halunken hielten sie gar nichts. Sie jagten ihn weg und setzten damit das Recht wieder in seine natürliche Funktion ein. Als ich nach der Mitternachtsstunde allein am lodernden Feuer saß, während ich mir einen Hecht über dem Extrafeuer aus Erlenstämmen briet und räucherte, stellte ich zufrieden fest, dass es ganz ruhig um mich herum geworden war.
Wie ich ohne die Regelung, die seitens der Männer untereinander erfolgt war, die lange Nacht ohne Übergriffe überstanden hätte, wagte ich nicht auszudenken.
Zwei Jahre
später erlaubten meine Kollegen nicht, dass ich an der Fischerei-Ingenieurschule ein Fernstudium aufnahm. Sie waren vom Grundsatz der Gleichheit dermaßen durchdrungen, dass sie es ablehnten. Sie hatten nicht studiert, ich hätte es ebenfalls nicht nötig. Außerdem wäre mit Reinhard Lüdtke bereits ein Überstudierter da. Gegen ihren Willen sei er auf bezirkliche Weisung als Diplomfischwirt in den Betrieb eingestellt worden. Wie sie glaubten, war das bereits allzu viel der unguten Schlauheit.
„Nö”, verweigerte auch Bartel sich, der über das Thema Qualifizierung zwar anders dachte als sie. Er habe dasselbe wie ich vier Jahre zuvor gewollt und ich hätte mich ja auch gegen seine gute Absicht ausgesprochen.
Das entsprach den Tatsachen. Ich hielt ihn für zu alt und wollte selbst vorwärts kommen.
Doch Reinhardt Lüdtke, der sich inzwischen Respekt erworben hatte, setzte sich vehement für mich ein und so begann ich, inzwischen siebenunddreißigjährig das langersehnte Fernstudium.
Vor und nach unserer Moskaureise
Gegen Ende meiner Ausbildung kam mir die Idee, es müsste doch möglich sein, ähnlich wie wir Hechtbrütlinge in Plasterinnen vorzustrecken begannen, Maränenbrut groß zu ziehen.
Im letzten Studienjahr betrachteten wir Neubrandenburger Binnenfischer dieses Vorhaben zwar gemeinsam, aber auch ziemlich kritisch. Brütlinge dieser Art verlangten gewiss besondere Sorgfalt. Andererseits lag die Verlustrate unter natürlichen Bedingungen in den meisten Jahren sicherlich weit über 97 %. Was verloren wir also, wenn uns gelingen sollte, die winzigen Maränen mit selbst gefangenen Zooplanktonten in den für die Hechtanzucht bereits genutzten Plasteaquarien anzufüttern und so viele wie möglich vor dem frühen Hungertod zu schützen? Denn genetisch besitzen sie allesamt dieselben Überlebenschancen.
1971 versuchte ich das Experiment. Dreihunderttausend Stück frisch geschlüpfte Kleinmaränen setzten wir in etwa sechshundert Liter Wasservolumen ein. Das Neubrandenburger Leitungswasser erfüllte glücklicherweise die erforderlichen Voraussetzungen, zumal wir es über eine kleine Kaskade von Brettchen laufen ließen, um es so mit Sauerstoff anzureichern. Die schnell und problemlos angefertigten großen Planktonnetze aus Müllergaze fingen Hüpferlinge in Massen.
Wir verkannten allerdings einen entscheidenden Punkt, nämlich dass der Anteil der für uns interessanten Kleinkrebse, die sich noch in ersten Häutungsstadien befinden, zu gering war. Es kam deshalb trotz großer Futtermengen zu einem Massenmaränensterben. Allmorgendlich lagen mehr und mehr tote Fischchen auf den Böden unserer je vier Meter langen Rinnen.
Erst der Biologe Dr. Manfred Taege, genannt Männe, ein Verehrer des legendären Che Guevara, Tiefseetaucher und persönlicher Freund des Bruders Fidel Castros, Buchautor und Mitarbeiter des Institutes für Binnenfischerei Berlin-Friedrichshagen fand heraus, dass wir kleineres Lebendfutter fangen und fortan sieben müssten.
Ehe wir allerdings die Erfolge erzielen konnten, von denen ich in meiner Staatsexamensarbeit zu reden gewagt hatte, wäre ich um Haaresbreite aus der Genossenschaft ‚geflogen’.
Das kam so: Mit unseren Ehefrauen planten wir einen 5-Tageausflug nach Moskau.
(Früher wurden Unsummen in Getränken angelegt. Jetzt floss das Geld des Kulturfonds in andere Richtungen.)
Gewisse Umstände oder Zufälle sollten einen großen Krach heraufbeschwören.
Hermann Göck übernahm die Rolle des Reiseleiters und das mit einer seinerseits überspannten Erwartungshaltung.
Zumal er Ehrenmitglied der PwF “Tollense” geworden war, lag es nahe, ihm das Vergnügen zu gönnen, für ein paar Tage unser Herr und Meister zu sein, aber nicht mehr.
Der geradlinige Altkommunist hielt allerdings die Zeit für gekommen, endlich den Rest von Vorbehalten unsererseits gegen seinen geliebten Arbeiter - und Bauern - Staat auszuräumen. Er hoffte und glaubte, wir würden Moskau mit seinen Augen sehen und anschließend wünschen, seiner Partei beizutreten.
So stand Hermann Göck am Morgen des Tages der Abfahrt auf den breiten Stufen des “Hauses der Kultur und Bildung” und ermahnte uns, in der Weltmetropole des Kommunismus als würdige Vertreter der DDR aufzutreten.
Wir landeten in Scheremetjewo 1 und das gegen Abend.
Um zu unserem Hotel in Ostankino zu gelangen mussten wir mit einem Bus quer durch Moskau fahren.
Natürlich hatten wir uns oft gefragt, wie die Menschen in der SU lebten. Eigentlich glaubten wir, dass wir in Moskau ein Stück sozialistischer Zukunft erkennen würden. Moskau werden sie als Schaustück hergerichtet haben, als Modell der Zukunftsplaner, dachten wir.
So wie den Moskauer Menschen jetzt, könnte es uns später einmal im Kommunismus ergehen. Wie in einem Spezialfilm erhielten wir während der späten Busfahrt Einblicke in eine Vielzahl Wohnungen. Wir sahen die Winzigkeit der überwiegend unverhüllten, von sehr schlichten Lampen erhellten Stuben, die Armseligkeit der Ausstattung der Räume. Die ganze Atmosphäre, in die ich auf diese Weise hineintauchte, wirkte beklemmend. Ein Tisch, ein Wohnzimmerschrank, einer wie der andere gleich, vier Stühle, ein Fernsehgerät. Diese elenden Löcher in den Massenquartieren sollten der Gipfel der Errungenschaften sein?
Aber was hatten wir denn erwartet? Ich konnte es nicht in passende Worte fassen. Das jedenfalls nicht.
Du hast es immer gewusst: Das Individuum tritt vor der Masse Menschen in den Hintergrund. Der Einzelne ist den führenden Kommunisten gleichgültig.’ Mir war die Ungeheuerlichkeit solcher Anklage zwar bewusst, doch ich fand sie hier bestätigt. Hermann Witte, der neben mir saß, stieß mich unentwegt an.
„Süh di dat an!” ("Sie dir das an!") Seine Art und der Rhythmus, in dem er mir seinen Ellenbogen in die Seite rammte, hieß, „hesst du di dat so vörstellt?” ("Hast du dir das so vorgestellt?")
Trotz vieler Negativberichte die ich mit der Zeit erhielt, hatte ich diese Primitivität in ihrer Gesamtheit nicht erwartet.
Gemessen an der Formensprache durch die tempelartigen Hausriesen, die ich von Bildbänden her kannte, war die individuelle Wohnkultur kläglich.
War, was ich sah, der ganze Ertrag von zwei Generationen Kampf und Arbeit und Tränen? Natürlich, dazwischen war der Krieg gewesen. Was dagegen gelang den Kapitalisten in diesem Vierteljahrhundert aus den Ruinenstädten Westdeutschlands zu machen? Bereits am zweiten Tag unserer Anwesenheit erhielt Hermann Göck die auch ihm peinliche Information, dass wir am nächsten Tage abzureisen hätten. Moskau richte gerade einen internationalen Ärztekongress aus. Es fehlten Hotelbetten und Verpflegungskapazitäten. Unglücklicherweise saß ich am Morgen des rücksichtslos vorverlegten Abreisetages neben einem Holländer, der mich angesprochen und in ein Gespräch verwickelt hatte. Ich verabschiedete mich von ihm. Er stutzte, stellte Nachfragen. Ich antwortete wahrheitsgemäß.
„Wir haben nichts zu wollen. Uns ist nur mitgeteilt worden, dass wir vorzeitig heimfahren müssen.”
„Das gibt es nicht! Ihr habt doch einen Vertrag!”
„Vertrag hin, Vertrag her. Was sollen wir machen?” Im unpassendsten Augenblick, als ein mir nicht gut gesonnener Kollege an uns vorbeiging äußerte der Niederländer: „Dann müsst ihr eben streiken!”
Er hatte schon immer gute Ohren gehabt und mir bereits früher vorgeworfen, ich hätte ihn schon oft beleidigt.
Sofort ging mein neuer Mitfischer P. zu Hermann Göck. Seine Frau saß an Göcks Tisch und er hätte ohnehin zu ihm gehen müssen. Doch ich fand, dass er sich sehr beeilte. Ich sah, wie sie miteinander tuschelten. Meinem Eindruck nach redeten sie ziemlich intensiv über mich. Hermann Göck würde nicht nur erfahren, dass und wie ich mit einem westlichen Ausländer über einen Streik in der DDR gesprochen habe, sondern auch von andern Übertretungen, die ich mitunter beging.
Ich sah, wie sie nebeneinander hockend wiederholt zu mir herüberschielten. Mir schien, ich könnte Hermann Göcks Ärger sogar verstehen. Er war mit dermaßen großen Wünschen hierher gekommen und nun sah er seine Hoffnungen rapide schwinden. Er liebte dieses Land, diese Menschen und das System, glaubte nun, ich würde alles verachten.
Aber ich missachtete weder Land noch Leute.
Im Gegenteil.
Ich mochte nur nicht, wie in diesem Land mit Menschen umgesprungen wurde, was die kommunistische Führung ihnen zum Leben übrig ließ, was sie ihnen zumutete. Er hatte gehofft, wir würden von seinem Moskau begeistert sein und so fühlte er sich nun verspottet. Ich spürte, dass Hermann den Zorn aus maßloser Enttäuschung kaum noch unterdrücken konnte.
Doch er fraß den Ärger vorläufig in sich hinein.
Er schwieg und grollte.
Ich musste ihm ja bald, wenn wir erst wieder daheim angelangt waren, über den Weg laufen.
Wir besuchten noch den Fernsehturm Ostankino, fuhren hinauf und bewunderten die ingenieurtechnische Leistung. Denn die Kuppel dreht sich einmal in der Stunde um die Achse und bot einen herrlichen Ausblick über die riesige Stadt und das sich weithin ausbreitende Grün.
Dann hieß es, wir dürfen Lenin sehen.
Ich jedenfalls wünschte es.
An kilometerlangen Menschenschlangen vorbei wurden wir bevorzugt zum Leninmausoleum geleitet. Einige tausend Kirgisen, Kasachen, Mongolen, Russen harrten geduldig aus und rückten
kaum vorwärts, weil Privilegierte wie wir, an ihnen vorbei, auf kürzestem Weg zum Ziel gelangten.
Auch Stalins balsamierten Leichnam hätte ich gern gesehen. Aber einige Jahre nach Chrustschows Geheimrede 1956 war der zum Verbrecher erklärte Tote an der Kremlmauer beigesetzt worden. Dort sahen wir nur die Grabstelle und die vielen frischen Blumen, die seine Verehrer, wie wir hörten, täglich erneuerten. Nur die Büste Stalins zu sehen, brachte mir nichts. Ich empfand weder Abscheu noch Kälte, als ich später unmittelbar vor ihr stehen blieb. Er war mir in dieser Situation nur gleichgültig. Anders bei Lenin. Gegen besseres Wissen empfand ich immer noch eine gewisse Bewunderung für die Leistung des genialen Staatsmannes Uljanow. Die kaiserlichen Deutschen ließen ihn im Herbst 1917 in ziemlich böser Absicht in einem verplombten Sonderwaggon aus seinem Exilort in der Schweiz nach Russland schaffen. Sie versprachen sich offensichtlich von Lenins Auftritt und Wirken eine Vergrößerung des russischen Chaos zu Gunsten der entkräfteten deutschen Ostfront.
Lenin aber gelang es, das Chaos allmählich in eine Art militärische Ordnung zu verwandeln, allerdings auf brutalste Weise. Vielen vermochte er dennoch glaubhaft zu versichern, mit ihm komme die neue gerechte Weltordnung herauf.
Als ich ihn plötzlich da vor mir im gläsernen Sarkophag liegen sah, war es aus mit meiner Restsympathie für Wladimir Iljitsch Uljanow. In diesen Sekunden erlangte ich eine noch deutlichere Vorstellung vom Ausmaß der negativen Kraft, die durch diesen unbeugsamen, asiatischen Despoten zur Geltung kam. Mich schauderte während ich seine zur Faust geballte Linke sah. Ich sah Lenins Kommissare mit der Pistole und dem Strick agieren.
Hermann Göck dagegen zeigte sich ergriffen. Wir zogen nach kurzem Stocken an der Ikone Lenin vorbei, konnten an seinem Glassarg nicht stehen bleiben.
Helene Göck, die wahrscheinlich einen Versuch zur Versöhnung unternahm, sprach mich draußen an. Im Hintergrunde die Basilius-Kathedrale, vor uns das Kaufhaus GUM.
Sie wünschte zu erfahren, was ich empfinde.
Ahnst du nicht, was ich fühle und denke?
Natürlich war ich stets bemüht zu differenzieren. Ich meinte, ich könnte mich in die damalige Situation hineinversetzen. In diesem riesigen Land musste damals, 1917, zugunsten der tatsächlich Unterdrückten etwas Entscheidendes geschehen. Eine Clique gnadenloser selbstherrlicher Gutsbesitzer, Zaristen und Pfaffen übte die absolute Vorherrschaft aus und forderte frech die Gerechtigkeit heraus.
Unheiliger konnte eine Dreifaltigkeit kaum sein.
Viel zu lange schon verlief die Grenze zur Unmenschlichkeit mitten durch das zaristische Russland, das sich und ihren Oberen gestattete noch im 20. Jahrhundert Menschen wie du und ich quasi als Leibeigene zu halten.
Noch nie, in den letzten eintausend Jahren, verfügten dort die Einzelnen über Möglichkeiten zu freier Gewissensentscheidung. Ob ein Grundsatz richtig oder falsch war, entschied seit je der Zar als Haupt der ‚rechtgläubigen’ Kirche. Mich hatte es schon immer geschüttelt, sobald ich daran dachte, wie oft diese russische Institution, die sich herausnahm Kirche (Dach für Bedrängte) zu nennen, in den vergangenen Jahrhunderten davon zu sprechen wagte, dass ihr und dem russischen Zaren allein die Krone zur Weltherrschaft zustünde. Ihr heiliges Russland sollte schon immer Modell der Welt von morgen sein.
Bei Ignaz von Döllinger hatte ich das bestätigt gefunden. In seinem Buch “Papsttum” belegt der Kirchenhistoriker, dass der Heilige Synod zu Moskau bereits 1619 in einer Urkunde dem Zaren Iwan dem Schrecklichen - Iwan dem Wahnsinnigen - , der Feinde von Hunden zerreissen ließ, der den eigenen Sohn erschlug, feierlich die Weltherrschaft zusicherte, „dass er der einzige Herrscher auf der ganzen Erde werde.”
Diesen anmaßend rigorosen Panslawisten, denen nahezu alle Nichtrussen als Irrgläubige galten, standen die späteren fanatisch kommunistischen Kommissare in nichts nach.
Wie ihre engherzigen Blutsbrüder wähnten nur sie sich im Besitze einer Wahrheit, die um jeden Preis durchzusetzen ist.
Immer noch vor dem Leninmausoleum stehend dachte ich es mit Beklemmung: Wenn dieser anspruchsvolle Herrentyp jemals zur unumschränkten Weltherrschaft gelangen sollte; sei es als kommunistischer Kader seiner Partei oder als Fürst einer Kirche, die beide nichts gelten ließen, als das, was ihresgleichen für gut und wahr erklärten, dann lohnte es sich nicht mehr zu leben. Minutenlang lag es für mich auf der Hand: Eintausend lange Jahre hindurch haben sie bewiesen, dass der blutige Imperator Konstantin, des vierten Jahrhunderts, den sie zum Heiligen erklärten, ihr Vorbild ist. In seinem Sinne praktizierten sie ihr von den alten gold- und machtsüchtigen Byzantinern überliefertes total entstelltes, ins buchstäbliche Gegenteil verdrehtes Christentum. Deshalb wurden sie die Erben religiöser Unduldsamkeit und die Väter der Pogromhetze. Gnade den Juden die sich an Karfreitagen auf ihren Straßen blicken ließen!
Sie duldeten zugleich das Unrecht der Freiheitsberaubung und ein weithin verbreitetes Analphabetentum. Angesichts der Eindrücke, die sich mir längst aufdrängten, stellte ich mir die Frage, ob der von eben diesem urrussischen Triumvirat übertrieben verehrte Jesus von Nazareth die Spur einer Chance gehabt hätte wäre er 1800 Jahre später und in Moskau geboren worden. Hätte er sich herausgenommen, sie zu kritisieren, wäre er sehr wahrscheinlich von seinen jetzigen ‚Anbetern’ sofort gelyncht worden.
Leo Tolstoi jedenfalls, wurde wegen Nichtigkeiten um 1900 vom Heiligen russischen Synod in Bann und Acht getan.
Vielleicht war ich angesichts meiner innern Bilder ungerecht, wenn ich mir sagte, es sei derselbe finstere Geist, der einerseits die Kreuzesverehrer und andererseits die Stalinisten inspirierte. Aber andererseits gab es hinlänglich Anzeichen dafür, dass die Enkel der alten Rus, lediglich die Symbole geändert hatten, kaum aber die Methoden und keineswegs das Ziel: Weltherrschaft.
Der Geist der Intoleranz und der lieblosen Arroganz bewegte sie und stieß uns ab. Wie die einen so die anderen. Ihren Ausschließlichkeitsanspruch begehrten die Orthodoxen wie die Kommunisten mit äußerster Härte gegenüber Andersglaubenden durchzusetzen. Lenin war es zwar gelungen eine
Tradition zu brechen, aber nur um eine ebenso widerliche zu etablieren. Das war es aber auch, was mir Lenin so unsympathisch erscheinen ließ. Er kultivierte lediglich eine andere Variante der Willenseinschränkung.
Aber Menschen sind ausnahmslos freiheits- und liebebedürftig.
Helene Göck gegenüber drückte ich meine Gedanken nicht so scharf formuliert aus.
Hermann Witte dagegen ließ seinem Unmut auf der Rückreise freien Lauf. Er schimpfte und spottete darüber, dass sie sich herausgenommen hatten, Vertragsbruch zu begehen und uns, mir nichts dir nichts abzuschieben und wegzujagen wie Geschmeiß.
Hemmungslos beklagte Witte, dass es in einer Weltmetropole kein Bier gab, jedenfalls nicht für sein Geld, dass es dort für Rubel nichts Billiges zu kaufen gab, außer Brot und Salz und Kofferradios. Die Schuhe und diese Preise, die Möbel. Tausend Tische in einem Riesenladen, aber einer wie der andere. Hundert Wohnzimmerschränke, alle gleich, so gleich wie die Partei, die von ihr regierten und dirigierten Menschen machte. Hermann Witte war einer von der Art Leute, die, wenn sie zu lästern beginnen, nicht wieder aufhören können. Wie ein alberner Schulbengel reizte er mit dem scharfen Gegluckse seinen Lehrer. Vor allem während der Fahrt von Berlin zurück nach Neubrandenburg hörte man im D-Zugwagen seine durchdringende Stimme quäken und dröhnen: „Wenn dat de ganze Kommunismus is, denn führt ji nächstes Mol alleen, lot mi man an Land.” ("Wenn das der ganze Kommunismus ist, dann könnt ihr nächstes Mal ohne mich dahin fahren. Lasst mich an Land!")
Helene und Hermann Göck schwiegen und schämten sich. Nachdem wir wieder daheim angelangt waren und unmittelbar bevor wir uns voneinander verabschiedeten, kündigte Hermann Göck für den kommenden Montagabend seinen Besuch in unserer Fischereibaracke an. Er wünsche mit allen Männern zu reden.
Der Montag kam und ich wünschte am Morgen, dass es schon Abend und alles vorbei wäre. Schließlich saßen wir da.
Er kam, begrüßte jeden, lächelte sogar ein bisschen. Das bleiche lange Gesicht mit der Thälmannfalte verhieß wirklich nichts Gutes. Reinhard Lüdtke, der neue Vorsitzende, eröffnete die
Zusammenkunft. Das Unbehagen war ihm anzumerken.
Blond und beherrscht jedoch saß der dreißigjährige Vorsitzende.
Wie wir, sah er voraus, dass gleich die Fetzen fliegen würden.
Da war nichts abzuwenden. Er gab dem Gast, der kein Gast, sondern stets als gleichberechtigtes Mitglied behandelt sein wollte, das Wort. Hermann Göck dankte. Zunächst grummelte es nur verhalten aus seiner erregten Seelentiefe hervor. Der alte Vorsitzende Bartel, seit Jahren Mitglied der Partei, senkte den Kopf. Auch er hatte seine Lektionen erst bei dem Ehrenfischer Göck lernen müssen.
Der fragte nun Hermann Witte, ob es ihm selbst nicht peinlich gewesen sei, so furchtbar kindisch auf die Sowjetunion zu schimpfen und herumzulamentieren. Im Zug, vor fremden Ohren, die glauben müssten, er wäre in Moskau miserabel behandelt worden.
Solche faustdicken Lügen!
Unerhört. Ob er nicht hervorragend verpflegt worden sei.
Hermann Witte saß den Buckel gewölbt, schuldbewusst und schweigend da. Den kräftigen Kopf mit den auffallend großen wasserblauen Augen nach vorn ausgestreckt, steckte er die Rüffel ohne Widerrede ein. Rot war er angelaufen. Natürlich leuchtete ihm längst ein, dass er überzogen hatte.
„Kein Bäär, kein Bäär!”, versuchte Göck sich in Wittes unnachahmlichem Tonfall. „Mensch kein Bäär! Säufst doch auch sonst nich jeden Tag Bäär!” Betroffenheit breitete sich aus, erfasste auch die Unschuldigen. Unser Reiseleiter und Ehrenmitglied ließ nicht nach. „Da ist wohl noch viel Unkraut und mancherlei reaktionäres Zeug in den Köpfen einiger! ... Du, Hermann Witte, hast...”
Von mangelndem Ehrgefühl und nicht dem geringsten Empfinden für Takt und Anstand war die lange Rede.
„Ich hätte mehr von dir gehalten!”
Ob Hermann Witte klar war, dass die Schelte ihm nur in zweiter Linie galt?
Ich wusste, Hermann Göck meinte mich. Sein weißes Gesicht bekam Farbe.
Dass ich mit einem Westdeutschen oder einem Holländer offen DDR-feindlich geredet habe, hielt er sicherlich sowohl für erwiesen wie auch für die Spitze denkbarer Bosheit. Ich war der Hauptverderber dieser in mehrfacher Hinsicht misslungenen Reise. Ich ahnte es nicht nur. Dass seine volle Wut eigentlich gegen mich zielte, spürten alle, obwohl seine Blicke mich noch mieden.
Ich konnte nicht mehr abwarten.
Was er mir sagen wollte, solle er denn auch direkt an mich richten.
Sofort, als ich ihn so aufforderte doch unverblümt zu sagen, was ihn in Wahrheit bedrücke, brach es mit elementarer Gewalt aus ihm hervor. Krachend flog der Vulkankegel weg. Hemmungslos schrie er mich an und spuckte minutenlang Feuer und Lava. „Beleidigung der Sowjetmenschen. Hast du überhaupt einen blassen Schimmer, was diese Menschen gelitten haben... du... Streik... Rausschmeißen aus der Genossenschaft. Boykotthetze...Reiseverbot für ewige Zeiten.”
Seine Liebe für Menschen, Land und vor allem zu seiner Partei trieb ihn in diesen Irrtum, aber auch seine bedingungslose Hingabe an die große Idee, die ich in Frage zu stellen wagte. Ich, der Erdenwurm, hatte mir erlaubt sein Heiligtum zu besudeln.
All das war eins für ihn.
So viele Jahre hatte er vergeblich um mich geworben.
Seine Bitterkeit schmeckte auch mir wie Galle. Er konnte und wollte nicht tolerieren, dass ich seine sozialistische Staatengemeinschaft nicht wertschätzte. Besseres als sie konnte es nicht geben für ihn. Da war es wieder, was ich hasste, diese Unterstellung, wer seine Partei und die Sowjetunion nicht liebte, der sei ein Volksfeind.
Er goss seinen Zorn in neue, stärkere Worte. Er beschuldigte mich weiterer Vergehen. Alles sehr laut und im Brustton grenzenloser Empörung. Was er nun sagte, ich achte die Sowjetfrauen nicht, war ihm ebenfalls geflüstert worden. Eindeutig!
Nur einem bestimmten Mann aus meiner Nachbarschaft, hatte ich, einen Tag nach der vorzeitigen Rückkehr aus Moskau geschildert, wie ich, bei unserem Ausflug in die Leningedenkstätte Gorki, bei einem Schrankenstopp gesehen hatte, dass acht Frauen eine mächtige Eisenbahnschiene schleppten. Tapfer hielten sie das Hebezeug und sie gingen Schritt für Schritt über den Schotter. Ich konnte spüren wie diese Trägerinnen sich aufeinander absolut verlassen konnten, wie ruhig sie nämlich arbeiteten.
Nur, rechts und links der Schwerlastträgerinnen befanden sich zwei Männer, die jeder mit einem Signalhorn bewaffnet seelenruhig mitanschauten, wie die Mütter und Ehefrauen sich abquälten.
Genüsslich indessen bliesen die beiden Herren der Schöpfung den Zigarettenqualm in die blaue Luft. Diese Selbstverständlichkeit auf beiden Seiten hatte mich ziemlich schockiert.
Jetzt hörte ich von Hermann Göck, ich wäre ein Feind der großartigen Idee von der Gleichberechtigung der Frauen. Mir wäre es ein Gräuel zu sehen, dass die Männer für die Sicherheit im Schienenverkehr sorgten. „Das sieht dir ähnlich!”, schimpfte er. Ich hätte auch kein Recht, mich über die Preise einfacher Schuhe aufzuhalten.
„Botten!”, sagte er höhnisch. Ich hätte sie ‚Botten’ genannt statt Schuhe. Das stimmte! Aber woher wusste er das?
Jetzt war ich gänzlich sicher. Nur S.H. gegenüber, unserem Nachbarn, der an sehr verantwortlicher Stelle im Rat des Kreises Neubrandenburg saß, war ich, am Tage der Heimkehr, so offen gewesen, sowohl die Schwerstarbeit durch Frauen, wie auch die ungeheuren Preise für so grobe ‚Botten’ zu beklagen.
Dieser Opportunist S.H. hatte mich also bei Hermann Göck angezeigt.
S.H. war nicht ehrlich. Als Staatsfunktionär durfte er keine Westpakete erhalten, auch nicht indirekt. Diese gingen, da er sie illegal empfangen wollte, an die Adressen seiner Verwandtschaft auf dem Lande. (Über Kindermund war diese Tatsache an meine Kinder bereits seit Jahren ausgeplappert und an meine Ohren getragen worden: „Ätsch! Unsre Sarotti kriegen wir doch! Die holt Papa immer von unserer Oma ab!”)
Diesem S. H., der nach außen hin so glatt und rot war, und so tat, als würde er von allen der Linientreueste sein, als habe er die Weisheit löffelweise gefressen, hatte ich mit diesen beiden Schilderungen lediglich eine gewisse Frage gestellt: Ob er nicht manchmal Mitleid empfände mit den in der SU lebenden Menschen, die sich in erster Linie für das ungeheure Rüstungsprogramm des roten Imperiums abschuften mussten. Hätte er mir daraufhin nicht eine sachliche Antwort geben können und mir ruhig erläutern können, wie er das sieht? Statt hinzurennen ans Telefon und wutentbrannt die Göcksche Nummer zu wählen?
Ich gebe zu, ganz unschuldig an dieser Verpetzung war ich nicht.
Als ich nämlich am Samstag nach der Rückkehr aus Moskau einem meiner Hausmitbewohner erzählte, dass ich S.H. mit gewissen Tatsachen konfrontiert und mit heiklen Fragen attackiert habe, lachte dieser und erzählte mir ebenfalls eine uns beide erheiternde Geschichte über S.H., der auch ihn schon einmal auf so arrogante Weise behandelt hatte. Während wir herausfordernd über ihn lachend im Vorgarten beieinander standen und hinaufschauten zu einem gewissen Fenster in der Nachbarschaft, erschien zufällig das Gesicht des Mannes im Fenster, auf dessen Kosten wir uns amüsierten. Wir beide wussten nämlich die Sache mit den Westpaketen, die S.H. klammheimlich empfing.
S.H., obwohl er kein Wort gehört haben konnte, musste es erspürt haben, dass wir ihn auslachten. Daraufhin ist er hingegangen, um mich bei Hermann Göck anzuzeigen. Dass es so war, lag nun auf der Hand. Denn Hermann Göck erwähnte zu alledem, nämlich in seiner anhaltenden Schimpfkanonade, ich wäre ein verbohrter großer Esel, der nicht begreifen will, dass die gigantischen sowjetischen Rüstungsanstrengungen den Menschen dort nicht weh täten und dass niemand sie deshalb bemitleiden müsste. „Jawohl! Aber wer sozialismusfeindlich eingestellt ist, wird das nie verstehen können...”
Ich wollte ihm nun in die Parade springen, kam jedoch nicht zu Wort.
Mir schien, ich dürfte nichts auf mir sitzen lassen, dem auch nur der Geruch von Unrecht anhaftete.
Er habe mir ein für allemal verständlich zu machen, was ich anscheinend nicht begreifen wollte: „Millionen haben im Befreiungskampf gegen den Faschismus ihr Leben verloren und du, du ...”
Viele Worte prasselten weiterhin auf mich und uns herunter.
„... endlose Opfer... verbrannte Erde...”
Wie durch einen Lautsprecher dröhnte er und alle andern saßen wie versteinert.
Hermann erklärte, ich sei unwürdig Genossenschaftler zu bleiben.
Das war der Augenblick, an dem es für mich gefährlich wurde.
Zwei, drei wirkungsvolle Sekunden lang stand seine Forderung wie ein Ausrufungszeichen im kleinen ‚Kulturraum’, mit immer noch demselben Radio aus der Frühzeit der Genossenschaft.
Mich packte ein ungeheures Gefühlsgemenge aus Wut und Mut, aus Angst und Stolz. Zehn Dezibel lauter als er, gab ich meine Gegenerklärung ab:
„Ich bin maßlos enttäuscht, wenn das, was wir gesehen haben, das ganze Ergebnis von sechzig Jahren Kommunismus ist. Das will ich dir sagen, Hermann Göck, auch wenn du das anders hinstellen möchtest. Mich dauern all diese zahllosen durch willkürliche Eingriffe zerstörten Familien, es tut mir weh zu sehen, dass in Kriegs- und Friedenszeiten Abermillionen für ein fast Nichts an Verbesserungen ihr Leben hingegeben haben und jetzt für den Weltfrieden immer noch zuerst Panzer und Kanonen bauen müssen, müssen, müssen. Ich weiß auch um die guten Sachen im Sozialismus. Aber die decken nicht die Mängel und die Wunden zu. Ich kann die Menschen dort nicht beneiden.” Weil ich unnatürlich laut und viel redete war meine Wortwahl nicht gerade die beste, feinste. In Wahrheit schrie ich, nur weil ich meine Bedenken zu überwinden hatte, ich käme zu spät zu Wort.
Er setzte zu einer Erwiderung an.
Es sei unerhört, dass ich nicht reuig in mich ginge.
Nun aber ließ ich ihn nicht zum Zuge kommen. Entschlossen mich zu behaupten riss es mich hin zu behaupten: „Deine niederträchtigen Informanten kenne ich!”
Er stutzte.
Ich nannte ihm beide Namen.
„Dieser S. H. und dein P. hatten beide nicht den Mut, mit mir Auge in Auge ins Gericht zu gehen! Da haben sie dich vorgeschoben! Das ist Feigheit vor dem Feind.”
Ich wiederholte dröhnend die beiden Namen und exakt das, was er nur von dem einen und was er von dem anderen vernommen haben konnte.
Viel lieber als mich so meiner Haut zu wehren, wäre ich in ein Mauseloch gekrochen. Doch ich blieb fest, ich würde keinen Millimeter von dem, was ich geäußert hätte, abweichen.
Meine Kollegen schauten mich betroffen an. Reinhardt Lüdtke rutschte auf dem harten Stuhl hin und her. Ihm fiel nichts ein, die Richtung der immer noch unberechenbaren Auseinandersetzung zu beeinflussen. Reiners Augen rollten, als wollte er mir bedeuten sofort den Mund zu halten. Mein Trotz würde alles nur verschlimmern.
Mir blieb aber keine Wahl. Mir blieb nur übrig, mich mit Hilfe der Wahrheit zu verteidigen.
Meine Tatsachen hatten ihre Wirkung auf meinen hocherregten alten Freundfeind nicht verfehlt. Sie verschafften sich Gehör und Raum. Ihn beeindruckte offensichtlich, dass ich immer noch zu dem stand, was ich gesagt hatte: „Der Sozialismus hat bessere Seiten als die von mir kritisierten.”
Nun konnte ich ruhig hinzusetzen und erklären, was mein Intimfeind nicht richtig verstanden, aber dennoch an ihn weitergegeben hatte: „Von einem Streik, Hermann Göck, habe nicht ich, sondern der Holländer gesprochen. Ihr habt doch für fünf Tage bezahlt, lasst euch das nicht gefallen. Das ist doch wohl ein Unterschied wie Tag und Nacht!”
„Aber das hättest du dem fremden Mann ja auch nicht auf die Nase binden müssen.”
„Darum geht es ja gar nicht!”, hielt ich dagegen, „ich bin genau so traurig wie du!“ Er schaute mich nun aus großen Augen an, wie ich ihn.
Seine, meinerseits befürchtete endgültige Erwiderung blieb erstaunlicherweise aus. Er wiederholte betroffen und mit auffallender Verwunderung den Namen S.H.
Deshalb schwenkte er um.
Er sagte plötzlich, aber wieder in normaler Lautstärke: „Ich werde S.H. fragen, warum er vor dir gekniffen hat.” Er kratzte ein Ohr. „Den kaufe ich mir!”, erwiderte er. Er werde ihm den Marsch blasen! – „Ich! … ” So heftig wie die Aussprache begonnen hatte, so jäh endete sie. Plötzlich war von seinem Antrag auf meinen Ausschluss aus der Genossenschaft keine Rede mehr.
Die ungeheure Macht der Partei, die hinter ihm stand, bedrohte mich nicht mehr direkt. Dass S.H. ihn vorzuschicken gewagt hätte, nahm er ihm übel. Wort für Wort hatte ich in dieser Zusammenkunft unter zehn Zeugen offen gelegt, was ich S.H. gesagt habe und wie hinterhältig er reagierte.
Die Westpaketgeschichten gehörten hier nicht her und so vergalt ich es ihm nicht.
Mir lag daran, die Situation weiter zu entspannen. Ziemlich behutsam äußerte ich deshalb, dass mir stets gewisse Bilder vor Augen stünden.
Darum ginge es. Alles andere sei mir gleichgültig.
In riesigen primitiven Arbeitslagern hätten unschuldig inhaftierte russische Menschen jahrzehntelang hausen und darben müssen. Fernab ihrer Familien mussten sie sich aus einem einzigen Grund zu Tode rackern. Nämlich um Workutas Straßen zu bauen. Alles wegen Stalins Größenwahn. Sogar in unserer DDR-Presse wurde der Wahnwitz, als „Personenkult“ bloßgestellt. Wortwörtlich konnte ich aus seinem “Neuen Deutschland” zitieren.
Ihm aber weitere Grobheiten ins Gesicht zu schmettern, nahm ich mir nicht heraus.
Man muss ja nicht unentwegt im Klartext formulieren. Inmitten der Worte schwingen ohnehin die Töne des echten Gefühls. „Ja, der verfluchte Krieg!”, erwiderte Hermann, und ich war froh, dass er es so deutete. Als er schließlich davongegangen war, ebenso mattgekämpft wie ich, klopften mir Witte, Fritz Sack und andere Kollegen auf die Schulter. Dem hätte ich es aber gegeben.
Das war nicht meine Absicht gewesen. Es ging um mehr.
Äußerlich erschien ich wahrscheinlich gelassen, doch meine Knie zitterten und auch mein Gemüt bebte nach. Dass es Verleumder gibt, ist eine Tatsache, dass man mit ihnen leben muss, ist schwer.
Mir wäre eine ruhige Auseinandersetzung auch lieber gewesen.
Die Angst der Ungewissheit blieb eine Weile bei mir.
Mein Glück, dass Mitfischer P. an diesemTag elend genug zumute war und sich in dieser Versammlung nicht sehen ließ.
Erst einige Wochen später sah ich Hermann Göck wieder. Mir schien, er ginge gebeugt. Langsam setzte er seine langen Beine. Er kam aus Richtung des Krankenhauses in der Külzstraße. Ich wich ihm nicht aus, sondern ging auf ihn zu.
„Lenchen liegt im Koma!” teilte er mir mit und streckte mir die Rechte hin. Die innere Erschütterung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Seine Frau war stets nur freundlich zu mir gewesen. Ich wusste, wie sehr beide aneinander hingen. Unter den Blättern und hängenden Zweigen einer bereits herbstlich eingefärbten Birke stand er mit seinem weißen, sorgfältig gescheitelten Haar. Ein gebrochener Mann. Unerwartet muss ihn die Härte der Erkenntnis getroffen haben, dass uns allen Grenzen gesetzt sind.
Als alte Freunde, die ihren Streit längst vergessen hatten, redeten wir miteinander. Es war auch ihm, denke ich, angenehm, dass wir einander nichts nachtrugen, sondern damit leben konnten, wenn unterschiedliche Menschen grundsätzlich andere Denkansätze hegten.
Coregonus lavaretus oder nasus?
Unmittelbar nach der Moskaureise entwickelte sich aus der Idee, Kleine Maränen vorzustrecken, der Gedanke, eine neue Fischart einzubürgern.
Erika, meine Frau, äußerte ihre Bedenken. Vor allem wegen der Art, wie ich es tun wollte.
Ich aber schwärmte von den Möglichkeiten, die sich uns böten.
„Du musst dir vorstellen, dass der Seeboden des Tollensesees, das Profundal, mit Zuckmückenlarven rot übersät ist. Wo immer der kleine Greifer einen Ausschnitt der Bodenoberfläche aus der Tiefe heraufbeförderte, zählte man zehnmal mehr Chironomiden als auf anderen Seen.”
Das ganze Jahr hindurch ist somit der Tisch für die ‚Friedfische’ überreichlich gedeckt. Nur, es ist da unten zu kalt für die meisten Fischarten. Deshalb wird diese Kinderstube dieser nichtstechenden Mückenart kaum aufgesucht und ihre Bewohner werden deshalb nicht dezimiert.
Deshalb staunt der bootsfahrende Beobachter und Naturfreund, wenn im Mai, der sonst überwiegend blaue See plötzlich schwarz aussieht, obwohl die Sonne scheint und die Himmelsfarben sich auf ihm spiegeln müssten. Abermilliarden vier, fünf millimeterlanger Larvenhüllen schwimmen auf der Wasserhaut und dazwischen bevölkern ebenso viele, ebenso lange schwarze Geschöpfe die riesige Fläche. Ehe sich die aus der Tiefe aufgestiegenen Insekten in die Lüfte erheben können, stehen sie mehrbeinig auf der Seeoberfläche und lassen sich vom Wind leicht dahintreiben. Ihre verhältnismäßig großen, sehr unterschiedlich gestalteten, gefiederten, büschelartigen Fühler dienen ihnen dabei als Segel.
Seeschwalben und Möwen stürzen sich zu Tausenden auf die soeben ins Tageslicht aufgestiegenen Zuckmückenmassen. Sie picken sie als Delikatesse auf oder vielleicht ist es nur Notnahrung, was sie da als winzige Häppchen aufnehmen. Sobald die Sonne etwas höher kommt, surrt es in den Lüften. Wie wehende Rauchfahnen stehen die Zuckmückenschwärme ab der elften Tagesstunde über den Wipfeln der ufernahen Bäume und halten Massenhochzeit. Im Fluge paaren sie sich und wenig später treibt sie der Wind und ihr Instinkt über die Seefläche hin, dann werfen sie ihre befruchteten Eier aus der Höhe ab. Ein neuer Kreislauf beginnt. Dreimal im Jahr vollendet sich dieser Kreis, aber nur einmal, im Frühling, in dieser Pracht und Fülle. Von allen in Europa vorkommenden Wildfischen ist nur die Große Maräne, die Bodenrenke, geeignet, da in die kalte Tiefe hinabzutauchen und die Larvenbestände abzuweiden.
Zwei Typen gibt es unter den Maränen, erstens die im freien Wasser lebenden Kleinmaränen und zweitens die großen bodenständigen, chironomidenfressenden. Letztere wollte ich in den See einsetzen. Lüdtke unterstützte meine Idee.
Wo aber gäbe es die Brut dieser Spezies Edelmaränen? Und würden wir einen Weg finden, sie zu erwerben?
Die Antwort kam aus unserem Nachbarbetrieb in Prenzlau. Am Madüsee, in der Nähe Gollnows, das jetzt Golienow heißt, gibt es eine leistungsfähige Fischbrutanstalt. Sie stünde unter der Leitung des Szczeciner Landesanglerverbandes.
Herr Marczinski sei der Chef.
Aber haben die polnischen Kollegen auch Edelmaränen aufgelegt, das war die Frage und würden uns die Polen zu vertretbarem Preis Brütlinge verkaufen?
Kurt Reiniger sprach fließend polnisch und ich besaß außer der Lust aufs Abenteuer einen Trabantkombi. Wir wollten einfach hinfahren und sehen, was sich machen lässt.
Lediglich Geld benötigten wir noch.
Mit Reiner Lüdtkes Einverständnis versuchte ich unseren Buchhalter Alfred Voß, Adi, zu überzeugen. Mit Adi konnte sich niemand erzürnen. Er war gerade Altersrentner geworden, aber noch im Dienst. Er schaute mich freundlich nachdenklich an. ‚Schwarze Kasse?’ Er schmunzelte: „Wozu schwarze Kasse? Wenn die Sache ok ist, gibt es keine Probleme.” Nun ja, die Polen wünschten, wie wir aus Erfahrung wussten, Bargeld ohne Quittung und Belege.
Ob ich auch dazu Reiners Genehmigung hätte.
„Ich will ihn da nicht in diese Geschichte verwickeln.“
Irgendwie sei es doch eine Art von Spitzbüberei, was wir vorhatten, eine Nacht- und Nebelaktion. Eigentlich hätten wir erst Anträge stellen müssen, Zertifikate für den grenzüberschreitenden Tiertransport besorgen, lauter bürokratische Hürden nehmen müssen und dann vertagte sich unser Anliegen um Wochen. Doch in einigen Wochen gibt es keine Großmaränenbrütlinge mehr, sondern gerade jetzt. Außerdem stünden die Plasterinnen seit der Beendigung der Aalbrutüberwinterung zur Verfügung. Besser sei, Reiner als Vorsitzender bliebe ‚außen vor’.
Adi schmunzelte und dieses sonderbare, stets überlegen wirkende Schmunzeln aus seinen Augenwinkeln und aus seinen immer freundlichen Gesichtszügen heraus war harte Kritik für mich. Es besagte, was würdest du dazu sagen, wenn du der Vorsitzende wärst und würdest auf diese Weise überfahren? Muss er nicht schließlich alles wissen, was im eigenen Betrieb passiert? Er zog die Augenbrauen nur um ein Winziges in die Höhe. Das war seine Art zu kritisieren. Durch Mienenspiel, Stirnrunzeln dirigierte er uns. Ich konnte mir gut vorstellen, wie er es damals, als Frontsoldat auf Urlaubsfahrt in die Heimat der schönen Wienerin erklärt hatte, dass ein Mann wie er immer nein sagen wird, wenn sein Gewissen auf dieses Nein besteht. Übrigens, als Buchhalter Adi Voß uns anderthalb Jahre später, im September ’73 verließ, überreichte er uns unter anderem einen alten Briefumschlag. Das war die in zwei Jahrzehnten gefüllte, nie angetastete, niemandem außer ihm bekannte ‚Kaffeekasse’, Geld von Kunden, die berechtigt waren, Kleineinkäufe vor Ort zu machen und die Pfennigbeträge nach oben aufrundeten. Der Inhalt waren 312, 73 Mark.
Nie gab es in seinen Bilanzen echte Differenzen. Ehrlichkeit ist bares Geld, pflegte er zu sagen, dabei zeigte er seine kräftigen Zähne. Das war seine tiefste Überzeugung: Ohne Ehrlichkeit geht die Welt zum Teufel.
Reiner nickte, als ich ihm beichtete, sofort Zustimmung: „Wie viel Schwarzgeld benötigst du?”
„Schätzungsweise eintausendzweihundert!”
Eine Stunde später hielt ich die zwölf Hunderter in meiner Hand.
Gemessen an unseren Preisen hatte ich mir ausgerechnet und vorgenommen, dafür eine viertel Million Brütlinge zu bekommen und diese schwarz über die Grenze zu schmuggeln.
Reiner meinte, dass wir wahrscheinlich nur angebrütete Eier erhalten würden. Dieser Hinweis war wichtig. Wir mussten also Zugergläser aufstellen. Versehen mit einigen großen Plastetüten fuhren wir am nächsten Tag nach Szczecin. Die Zeit drängte. Für den Nachmittag würde Herr Marczinski uns zur Verfügung stehen. Mehr wollten wir fernmündlich nicht vereinbaren. Denn wir waren es gewohnt, stets daran zu denken, dass Telefonate abgehört wurden. Wer weiß, zu welchen Schlüssen die Horcher gelangt wären, wenn sie zufällig unsere Absprache mitbekommen hätten.
Szczecins Anglerpräsident Marczinski saß in seinem gelblich eingetönten Büro an seinem ebenfalls gelb schimmernden Schreibtisch unter einer präparierten riesigen Madümaräne, die auf einem gewaltigen Bücherschrank einen zentralen Platz einnahm. Acht Kilogramm oder mehr muss dieser Fisch einst gewogen haben. Kurt und ich waren sehr beeindruckt. Immer wieder gingen unsere Blicke dahin. Genauso große Fische, der Art Coregonus lavaretus, wünschten wir uns.
Ich wunderte mich laut darüber, dass Madümaränen zu so stattlichen Exemplaren heranwachsen könnten. Marczinski nickte, während Kurt übersetzte. Zwei- dreimal erwähnte er, mich unterrichtend oder berichtigend: „Coregonus lavaretus nasus.”
Nasus, nasus, dachte ich, das ist eine Spezies, die wir nicht haben wollen.
Marczinski wies mit dem Daumen nach oben, hinter sich: Ostseeschnäpel! Oje. „Keine Ostseeschnäpel, die benötigen zum Gedeihen Brackwasser.“
Ein Schwall anscheinend wohlmeinder Worte fiel in Polnisch über uns her. „Sie können sogar in Teichen, in Süßwasserteichen! mit Nasus wirtschaften!”
Ich glaubte ihm nicht. Kurt zuckte die Achseln.
Da saßen wir nun, mit unserem Tausender. Was tun?
Ich konnte Marczinski aber auch nicht das Gegenteil beweisen.
„Probieren wir es? Kurt?”
Kurt, der Mann mit der großen Stupsnase nickte. Aus dem vielfach gekerbten Gesicht, das in hohem Maße der Ausdruck seines von vielen Nackenschlägen durchkreuzten Schicksals war, kam das schulterzuckende Einverständnis. Marczinski nahm ein Stück Papier zur Hand und rechnete schnell. „Dreihunderttausend Eier erhalten sie dafür. Schlupfreife!” Es sei höchste Zeit.
Hatte Reiner also Recht.
Wir müssten denn sofort aufbrechen, um nach Goleniow zu fahren. Da es noch März war, begann es früh zu dunkeln. Mir schien, die vierzig Kilometer würden nie enden. In einer dunklen Waldecke
angekommen, lauteten die Weisungen rechts fahren, rechts, na prawo, na prawo. Was ist, wenn ich viermal rechts herum fahre?
Überall nur Bäume wie es schien. Mattes Scheinwerferlicht erhellte nur den Sandboden, indessen schimmerten die Gehölze an den Seiten umso dunkler, wie schwarze Wände. Plötzlich zeichneten sich neue schwarze Konturen gegen den sich öffnenden Nachthimmel ab.
Kurt übersetzte: „Die Brutanstalt!” Jemand musste die winzige Hofbeleuchtung angeschaltet haben. Eine nicht große, leicht gebeugte Gestalt erschien. Ob die Person männlich oder weiblich war, ließ sich noch nicht sagen. Wir stiegen aus. Völlige Stille umfing uns. Der gebeugte Mensch schritt auf Herrn Marczinski zu. Ich erkannte, dass es ein alter Mann war, ein kleiner Mann mit fester Hand und weicher Stimme. Als er bemerkte, dass ich außer dobri vetschor nichts verstand und auf Kurts Dolmetscherdienste angewiesen war, wechselte der sympathische Alte in einwandfreies Deutsch. Er drückte sich sehr gewählt aus. Siebzig Maränenarten gäbe es auf der nördlichen Erdhalbkugel, vielleicht noch mehr, wer könne das noch auseinander halten? Vom Omul im Baikalsee bis zu der kurioserweise im Sommer laichenden Spezies in den Feldberger Tiefseen, der Coregonus albula baunti, reiche das Artenspektrum.
Mein Problem bestand darin, dass ich auch ihm zunächst nur schwer glauben konnte. Sollte der Ostseeschnäpel das von uns begehrte Objekt sein? Dass dieser Wanderfisch, der schwach salziges Wasser bevorzugt, in Seen und Teichen ausgesprochen gut zu halten sei, bezweifelte ich. Allerdings hatten wir den Kauf bereits perfekt gemacht. Eine große dunkle Tür öffnete sich vor mir und das vertraute Wasserrauschen ließ sich vernehmen. Da plätscherte es aus den Zugergläsern. Je sieben Liter Wasser befanden sich in je einer dieser vielleicht siebzig überdimensionierten Kopf stehenden Seltersflaschen, die in mehreren Reihen in Gerüsten aufgestellt dastanden. Fortwährend wälzten sich in jeder der unentwegt überlaufenden Flaschen zehntausende bernsteinfarbener Maräneneier. Alle nur etwas größer als Stecknadelköpfe. Mit einer Pipette entnahm der alte Herr ein paar dieser vor dem Lampenschein goldschimmernden Coregoneneier. Er hielt sie mir dicht vors Gesicht. Deutlich sah ich die Zuckungen der Ungeborenen, dann die schwarzsilbernen Embryonenaugen, den Dottersack mit dem Fettauge, das dem Ei die Farbe gibt. Immerzu drehten und wanden sich die noch in ihren Umhüllungen gefangen gehaltenen Schnäpelchen. Mit dem Zählglas literte der alte Mann uns dreihunderttausend Maräneneier aus, und zwar ziemlich genau wie wir später bemerkten. Wir kannten nur das Zählverfahren für Brütlinge.
Sprudelndes Wasser füllten wir in die auf Reißfestigkeit geprüften fünfzig Liter fassenden Plastesäcke und entließen dahinein die je einhundertundfünfzigtausend Eier.
Obenauf, beim Vorgang des Schließens der Tüten, gaben sie uns einen Schuss reinen Sauerstoffs aus einer Pressluftflasche.
Dann machten wir uns schleunigst auf den Heimweg.
Die Stimmung war gut.
In Szczecin wollten wir Herrn Marcinski absetzen.
Kurz bevor wir die Stadtgrenze erreichten ging es zwischen Kurt Reiniger und unserem Geschäftspartner laut zu. Ich spitzte die Ohren. Was mochte der Streitpunkt sein? Mir schien, dass ich den Begriff Katyn wiederholt vernahm. Mich einzumischen wäre unhöflich gewesen. Teilnahmslos dazusitzen und nur Gas zu geben unmöglich. „Was ist los, Kurt?”
„Er wirft mir vor, ich wäre ein Überläufer gewesen! Kann doch nischt dafür!”
Ich ahnte, um welchen Vorwurf es ging. Hatte ich ihn doch einmal auf einem Foto als jungen Mann in polnischer Uniform gesehen. Es lag alles weit zurück, über dreißig Jahre.
Die Emotionen gingen auf beiden Seiten hoch. Für beide Männer schien der Sprung über eine fast vierzigjährige Epoche nur ein winziger Schritt zu sein. Sie erregten sich sehr. Kurt Reiniger war tatsächlich auf polnische Fahnen eingeschworen worden, 1939, und bald darauf, nach der großen polnischen Niederlage, von der Deutschen Wehrmacht auf Gestellungsbefehl eingezogen worden. Ein Schicksal, das er mit Tausenden teilte, die damals im Raum Bromberg gewohnt hatten. Dass sein Familienname Reiniger lautete, deutsch war, ließ Marczinski nicht gelten. Den Polen ginge es immer um die Ehre ihrer Nation!
Das zu verstehen, sei Kurt Reiniger wohl nicht gegeben.
Kurt war wirklich gekränkt. Immer hackten sie auf ihm herum. Wenn es nicht dies war, dann jenes, das ihnen an ihm missfiel.
Den einen trank er zuviel, den andern zu wenig.
Es ging um Katyn! Und um Marczinski Bruder. Das ließ ich mir übersetzen. Wenn sie sich schon zankten dann wollte ich auch wissen, warum. Der Bruder des Anglerpräsidenten habe zu jenen tausenden polnischen Offizieren gehört, die durch Stalins Heimtücke in sowjetische Gefangenschaft geraten waren. Eine Schande an sich. Sie hätten sich entschieden geweigert, ihre Pistolen und Ehrenabzeichen an sowjetische Schergen auszuliefern. Die Russen seien der Republik Polen 1939 zugunsten Hitlerdeutschlands brutal in den Rücken gefallen, auch weil diese „verfluchten Kommunisten“ Landräuber allergrößten Stiles wären. Finnland hätten sie beklaut, das ganze Baltikum sich einverleibt, Moldauer Gebiete, Ostpolen. Vor Verrätern wollten sich die Gefangenen in Katyn nicht demütigen. Schließlich seien sie ausnahmslos erschossen worden. Ich hatte richtig gehört. Marczinski verfluchte den russischen NKWD als faschistische Mörderbande. Hitler hätte mit den Sowjets, damals, als Kurt in die Deutsche Armee übergelaufen sei, gemeinsame Sache gemacht. Mich interessierte das Thema brennend. Im letzten Urlaub hatten wir mit Freunden das Verbrechen von Katyn sehr konträr diskutiert. Es ging ganz einfach um die geschichtliche Wahrheit, und die Frage, ob Hitlers Männer oder die Kommunisten die nichtaufständischen, wenn auch sturen polnischen Kriegsgefangenen massenweise erschossen hätten? Mich wunderte damals, im Usedomer Strandsand liegend, dass es überhaupt Zweifel an der sowjetrussischen Täterschaft gab.
Sogar mein Bruder Helmut war der Auffassung, dass es eher Hitler als den Russen zuzutrauen gewesen wäre, das Massaker anzurichten.
Für uns war es ohnehin eine ungeheure Vorstellung, dass Menschen so miteinander umgehen können. Mit Fanatismus habe das nichts mehr zu tun, sagten wir damals, sondern nur mit den atavistischen Neigungen degenerierter Kerle, die von dem einen oder dem anderen System bewusst gefördert wurden.
„Ich kann es Ihnen nachfühlen, Herr Marczinski.”, erklärte ich, wusste aber nicht, was Kurt übersetzte.
Ziemlich böse äußerte Marczinski: „Rückfälle haben immer schlimme Folgen.“
Auf meine Nachfragen reagierte er leidenschaftlich. Diesen Angriff auf die Blüte der polnischen Nation werde Polen den Sowjets niemals verzeihen. Das werde niemals verjähren. Daran möge ich mich später erinnern.
„Sie wollten die polnische Intelligenz und damit die Seele der Nation ausrotten! Nicht mehr und nicht weniger. Die Sowjets fürchten immer noch ein starkes Polen, so wie sie es früher zu Zeiten des Zaren hassten.” Beide Seiten hätten deshalb gemeinsame Sache gemacht um Polen von der Landkarte zu tilgen.
Marczinskis Gefühle in allen Ehren. Warum war er wütend auf uns, warum auf mich?
Ja, die Preußen! Gemeinsam haben die Preußen Polen mit den Österreichern und Russland 1772, 1793 und schließlich 1795 in Stücke gefetzt.
Feuer eines Hochofens loderte: „Sehen Sie sich an, was die mit uns anstellten: Ausrottung, Löschung jeder polnischen Existenz.”
Marczinski erklärte mir die Landkarte Polens, während der von ihm erwähnten Teilungsjahre: Zuerst nahmen die Preußen den Polen den Bromberger Raum bis Danzig weg, die Österreicher kamen bis vor die Tore Krakaus, das zaristische Russland nahm Wittebsk. Ein Jahr darauf einverleibte Russland sich Minsk und Pinsk, die Preußen Posen und Thorn. Und schließlich verschwand das Land Polen 1795. Der Funke sprang zu mir über. Das viertel Teil Slavenblut in mir erhitzte sich.
Ich erinnerte mich in verschiedenen Napoleonbiographien gelesen zu haben, dass auch der große Bonaparte die Polen zwar als Elitesoldaten in all seinen Feldzügen an den schwierigsten Kampfabschnitten einsetzte und dass er sie stets mit neuen Versprechen zu höchsten Mutleistungen zu motivieren vermochte, doch dass er wahrscheinlich niemals ernsthaft daran gedacht hatte, Polen mit jener Souveränität auszustatten, welche die hochherzigen Söhne des jahrhundertelang immer wieder in Abhängigkeiten gestürzten Landes so heiß begehrten. In dieser Märznacht 1972 fragte ich mich erneut, ob dem Kreml jemals die Integration, der so genannten Volksrepublik Polen, in ihren Herrschaftsbereich gelingen könnte. So viel unverhüllt ausgedrückten Unmut und Widerstand, wie ich ihn von Seiten Herrn Marczinskis gegen den Sozialismus spürte, hatte ich bisher nur selten erlebt.
Kurt übersetzte, während wir den Stadtrand Stettins erreicht hatten, fleißig und wie ich annehmen durfte, auch einigermaßen präzise.
Herr Marczinski ließ mir sagen, wir wären angelangt. Ich stoppte und schaltete den Motor ab. Er drückte mir die Hand und sagte zum Abschied: Wie er dächten und empfänden alle Polen: „Wir werden frei sein oder tot!”, und dann erklärte er etwas, das Kurt mir lachend mitteilte: „Noch ist Polen nicht verloren.”
Herr Marczinski sang es und Kurt stimmte ein.
Unser Partner stieg nun an dieser unbelebten, recht trostlos erscheinenden Straßenecke aus. Er winkte, wir winkten zurück und fuhren langsam davon. Mich beschlich, als wir ihn zurückließen, wiederum das ungute Gefühl, dass wir schlechten Zeiten entgegen gingen. Jeden Tag, jeden Abend überschütteten uns die östlichen wie die westlichen Sender direkt oder indirekt mit Verdächtigungen, die andere Seite plane den großen Krieg.
Manchmal schien es uns, es gäbe gar keine anderen Themen mehr. Schließlich war die Gefahr, dass der so verheerend in Vietnam tobende Krieg, aus denselben Gründen, auch in andere Erdteile getragen werden könnte, sehr real. Noch lagen der Süden Afrikas, Angola, und der November des Jahres 1975 scheinbar in weiter Ferne. Sechzehn lange Jahre hindurch sollten dort jedoch die sowjetisch-kubanischen Interessen und die südafrikanischen Absichten tödlich kollidieren. Millionen Afrikaner sollten Flüchtlinge werden, hunderttausende Unschuldige würden den vollen Preis zu entrichten haben für die Leidenschaft der Großmannssucht beider Seiten.
Der Ausbruch größerer Feindseligkeiten musste auch im süd- und mittelamerikanischen Raum erwartet werden. Dies alles wegen des allgemeinen Konfliktes zwischen Ost und West. Hatte Beier-Red es nicht per Zeichnung prophezeit? Auf diesem Globus kann nur eins der beiden Systeme überleben.
Noch waren auch die Tage fern, in denen die DDR Presse ausführlich über die blutigen Grenzgefechte zwischen den sozialistischen Bruderarmeen Nordvietnams und der Volksrepublik China berichten würde. Noch ahnten wir nicht, dass die Pekinger Kommunisten beweisen würden, dass es ihnen ernst war mit ihrer Betrachtungsweise, Atombomben wären ja bloß Papiertiger. Wie wenig ihnen das Einzelwesen bedeutete, zeigten sie nicht nur während ihrer Kulturrevolution, in der es sogar bei Strafe der Verbannung verboten war, Schach zu spielen oder eine westliche Sprache zu erlernen, oder sogar gebildet zu sein. Die Minenfelder ihres südlichen Feindes ließen sie auf ihre höchsteigene Art und Weise räumen. Sie befahlen ihren Soldaten anzutreten. Schulter an Schulter laufend opferten die Söhne chinesischer Mütter ihre Gliedmaßen und ihr Leben. So schonte Mao die teure Technik.
Die Stasioffiziere Kindler, Zachow, Zander, Plauschinat und andere, die als Hobbyfischer in unserer Baracke am Oberbach aus- und eingingen, waren verlegen, wenn ich sie fragte, wer begreifen kann, was die chinesischen Marxisten trieben.
Müde und in Gedanken versunken, die nur wenig mit unserem Vorsatz der Einfuhr einer neuen Fischart in den Tollensesee zu tun hatten, näherten wir uns der Grenze. Obwohl mir bewusst war, dass selbst millionenfache Friedenswünsche gar nichts am großen Geschichtsverlauf ändern können, stand mir deutlich vor Augen, dass wir andererseits selbst entscheiden, ob wir innerlich frei und sicher mit mühsam gesuchten eigenen Einsichten bleiben, oder ob wir uns verlocken lassen den Weg des geringsten Widerstandes in die Verstrickung zu wählen. Außer durch die Zollbeamten, die möglicherweise doch einen Blick in unser Auto werfen würden und dann nach den nicht vorhandenen Zertifikaten fragen könnten, stand für uns und das Wohlergehen der Coregonen nicht viel zu befürchten. Natürlich war es verboten, was wir taten.
Falls sie unbequeme Fragen stellen sollten, wollten wir den polnischen und den deutschen Zöllnern weismachen, es handele sich unserer Auffassung nach nicht um Tiere sondern um Laichprodukte und das Wasser aus der polnischen Brutanstalt mische sich in der Ostsee ja sowieso mit dem deutschen, noch innerhalb der Grenzen. Ganz schön frech war unser Plan, der darauf baute, dass die gerade von beiden Regierungen beschlossenen Freizügigkeiten im Grenzverkehr auch funktionierten.
Daheim würde dank Reiner Lüdtkes Hinweis alles vorbereitet sein.
Beide komplikationslos ans Stadtleitungsnetz angeschlossenen Zugergläser konnten und sollten unsere ungefähr 300 000 Eier aufnehmen. Zudem hatten wir unsere Gläser in zwei der knietiefen Plasterinnen gestellt. Es war wohl um Mitternacht, als wir am Zollkontrollpunkt ankamen.
„Was wünschen Sie auszuführen?”, fragte der polnische Offizier in Deutsch. Er leuchtete mit seiner Taschenlampe nach hinten und betrachtete die auf dem Hintersitz meines Trabant-Kombi und auf der Hutablage liegenden und anscheinend vom harten Stopp noch erheblich nachbebenden Fünfzigliterplastesäcke. Beide waren bedeckt von zwei dünnen Wolldecken um die Temperatur konstant zu halten. „Jaikas!”, sagte Kurt. „Jaikas!” erwiderte der Zöllner und in seiner Stimme schwang das Schüttern mühsam zurückgehaltenen Gelächters. Er dachte wohl an zerdepperte Eierschalen. „Eier! Na, denn winsche ich guutte Fahrt!” Im Rückspiegel sah ich, wie er sich amüsierte. Die Vorstellung von Rühreiern muss ihn schier überwältig haben. Jungs, so eine große Pfanne haben nicht mal die Berliner!
Auch die deutschen Grenzer behandelten uns großzügig.
Gegen zwei Uhr morgens, wenige Minuten, nachdem wir sie in unsere Zugergläser gegeben hatten, schlüpften die Großmaränen. Die zweifache Umstellung auf neuartige Verhältnisse binnen weniger Stunden löste wahrscheinlich diese “Frühgeburtssituation” aus. Über die an die Gläser geschlossenen Kopfringe und Abflussstutzen samt Gummischläuchen strömten sie zu zehntausenden in die neue Welt.
Der zweite Akt ging somit erfolgreich zu Ende.
Wichtiger als alles andere war nun, die kostbare Brut mit Lebendfutter zu versorgen. Mit Schleppnetzen aus Müllergaze und getrieben von Kutterkraft siebten wir bereits acht Stunden später einige tausend Kubikmeter Tollenseseewasser aus. Hüpferlinge mussten wir fangen, Kleinkrebse, Cyclops.
Am ersten Tag ihres Fischlebens visierten unsere “Nasus”- Maränen die vor ihren Mäulern herumschwimmenden Krebschen nur an und probierten lediglich, wie sie denn zuschnappen könnten. Aber schon vierundzwanzig Stunden später ging die wilde Hatz los.
Drei-, viermal nehmen sie Anlauf, beugen den Schwanz wie ein Hecht und schießen dann, ihre Muskeln streckend, mit weit geöffnetem Rachen auf ihr Opfer zu. Eine größere Nauplie - ein im vorletzten oder letzten Häutungsstadium befindliches Kleinkrebschen oder auch schon ein ausgewachsener Hüpferling verschwindet zwischen den Kiefern der kleinen Fresserin wie eine handlange Plötze zwischen den Zähnen eines Hechtes. Drei lange Wochen ging alles problemlos, verlustlos vor sich. Nicht wie bei unseren vorherigen Versuchen mit den Kleinmaränen, die während der ersten Vorstreckphase zu hunderttausenden verreckten, obwohl sie inmitten von Wolken zuckenden, springenden Futters standen. Ehe wir damals dank “Männe” Taeges Untersuchung erkannten, dass unsere Kleinkrebse die maulgerechte Größe bereits weit überschritten hatten, war es für die meisten unserer Kleinmaränenbrütlinge bereits zu spät.
Großmaränen sind da von Anfang an im Vorteil. Als Brütlinge sind sie nur etwa zwei Millimeter größer, aber das reicht zum Überleben aus. Wie eine Armee hüben und eine andere drüben standen sich in unseren beiden Futterrinnen die Fronten im klaren Wasser gegenüber. Hier die geübten, verwöhnten, überlegenen mittlerweile bereits zwei Zentimer groß gewordenen “Nasus”, da die vor den unersättlichen Fressern zurückweichenden Hüpferlinge, die instinktiv zusammenhalten wie Schafe, die von Hunden umkreist werden.
Da sie sich so im Schwarm bewegten, gab es keine Schwierigkeiten, die Plasterinnen sauber zu halten. Ganz anders als bei den einzelgängerischen Hechten erwischte der Abfallsauger fast nie eine der geschickt ausweichenden Maränen. Blitzsauber konnten wir so die Vorstreckaquarien halten.
In der vierten Woche passierte es.
Wir waren bereits hochmütig geworden.
Bis zum Nachmittag des 22. April kamen sie, die Berliner, Prenzlauer, Warener Kollegen, auch die Nichtfachleute von der Bezirksleitung SED Neubrandenburg. Alle klopften uns auf die Schultern und lachten, wenn wir ihnen vom Husarenstreich erzählten, wie wir die langatmigen Prozeduren der Beschaffung von Zertifikaten umgangen hatten. Wir prahlten schon, dass wir die Fische fingerlang machen könnten, ausgedünnt natürlich unter Inanspruchnahme mehrerer Rinnen. Denn über die verfügten wir ja. Es waren nämlich vier weitere da, und das Futter fiel uns in jenem Jahr fast von selbst zu. Wir hätten mit wenig Aufwand täglich hundert Kilogramm Nauplien fangen können.
Unsere Maränen fraßen wie die Scheunendrescher und sie gediehen prächtig, bis zu jenem schwarzen Aprilmorgen des 23., an dem wir achtzig Prozent tot vorfanden. Die Stadtwerke hatten das Leitungswasser mit Chlor behandelt!
Anruf!
„Nein! Chloriert wurde nicht!” Was dann? Die Taumelbewegungen der überlebenden zwanzig Prozent Nasus zeigten an, dass auch sie nicht überleben würden. Wie ein Blitz schlug die schlechte Nachricht im Institut für Binnenfischerei in Berlin- Friedrichshagen ein.
„Los! Der Fischseuchendienst des VEB Prenzlau muss sofort nach Neubrandenburg fahren. Ursachenermittlung! Vorsorglicher Einsatz von Trypaflavin in für Aufzuchtbecken üblichen Konzentrationen! Neue Weisungen für gezielten Medikamenteneinsatz abwarten.”
Wir hatten alle guten Voraussetzungen übermütig als gegeben hingenommen.
In je zehn Minuten Kutterschleppnetzeinsatz hatten wir Unmengen Zooplanktonten gefangen. Wir konnten mit dem besten Futter der Welt aufwarten. Unsere Rinnen waren perfekt sauber. Das Leitungswasser wies ideale Parameter auf. Und nun ordnete das Institut eine Überprüfung an, ob Großalarm für die Ostseeküste ausgelöst werden müsste. „Wahrscheinlich sind die in den Großhälteranlagen stehenden Forellenbestände gefährdet, durch Einschleppen einer noch unbekannten Krankheit. Jedenfalls ist ein Übergreifen auf sämtliche Lachsartigen im Territorium nicht auszuschließen.”
Deshalb müsse festgestellt werden, was die Zertifikate besagen.
Für ein paar Stunden herrschte Hektik und Kopflosigkeit hoch drei.
Zertifikate? Das wusste selbst die Putzfrau des Institutes, dass wir die „Nasusmaränen” schwarz über die grüne Grenze geschmuggelt hatten.
Nun sollte nachgedacht werden, inwieweit die Polen wegen möglicher Nichtbehandlung ihrer an uns ausgelieferten Laichprodukte zur Verantwortung gezogen werden könnten.
Einer der Übereifrigen meinte, man müsse den Hauptverursacher hinter Gitter bringen. Das war nur der Ausdruck ihres schlechten Gewissens. Sie wussten, dass es eben nicht richtig gewesen war, sich köstlich zu amüsieren über die Nichteinhaltung einer gesetzlichen Vorschrift.
Noch, trotz des ungeheuren Verlustes, hatte ich wegen der Gesamtaktion ein ruhiges Gefühl. Es war doch alles Quatsch. Ein Seuchenerreger fällt nicht vom Himmel herab. Reine Nervensache ist das.
Das Trypaflavinbad muss geholfen haben.
Zwar lag am nächsten Morgen abermals die Hälfte der Überlebenden am Boden, doch es schien, dass es dem Rest der Fische besser ging.
Ich wollte noch abwarten. Unter dem Mikroskop hatte niemand im toten Gewebe Krankheitserreger gefunden, sondern nur Parasiten im Kiemenbereich der Fischchen. Natürlich, man konnte mit bloßem Auge erkennen, dass die Kiemen der Nasus angegriffen worden waren. Kiemennekrose!
Mit dem Lebendfutter mussten wir uns Schädlinge eingeschleppt haben. Wir hätten das Futter in einer Salzkonzentration baden müssen.
Hätten, hätten...
„Ihr wusstet, in solchen Fischkonzentrationen auf engstem Raum könnte solche Unterlassung verheerende Folgen haben.”
Plötzlich waren wir von lauter schlauen Leuten umgeben.
‚Männe’ (Dr. Manfred Taege) riet mir, die Übriggebliebenen sofort auszusetzen.
Keine Widerrede meinerseits. Wenn wir jemals nach Jahren, Großmaränen mit unterständigem Maul fangen würden, dann wüssten wir mit absoluter Sicherheit, dass wir keine bereits im Keim erkrankten oder infizierten Brütlinge eingeführt haben konnten.
Weit weg von Neubrandenburg fuhren wir sie in den Tiefwasserbereich vor Alt Meiershof und entließen dort ungefähr achttausend Stück vorgestreckte Nasus in die Freiheit. Wie gern hätten wir angegeben: Verlustlose Aufzucht von Großmaränen auf Anhieb gelungen. Verzwanzigfachung des Ursprungsgewichtes. Wie gern hätten wir geschrieben: 300 000 Mv ausgesetzt.
Der Ärger der Oberen legte sich. Denn an der Küste passierte nichts, was sich zuvor nicht auch ereignet hätte und die möglichen Beobachtungsobjekte waren von der Bildfläche verschwunden.
(Vier Jahre später fingen wir mit unseren Netzen die ersten zehn Stück Nasus und später immer mehr. Einskommafünf Kilogramm wogen die ersten. Dann fingen wir Dreikilogrammexemplare. Sie entlasteten uns nachträglich.)
Nicht nur ich behaupte, dass die “Nasus” zu den Delikatessfischen gehören. Geräuchert gehören sie zum Besten, was uns die Nahrungspalette zu bieten vermag.
Außerdem bereichern sie als Laichfische das genetische Potential in Seen mit Kleine-Maränenpopulationen durch Einkreuzen, auch wenn diese Vermischung leider immer nur über die Eier der größeren Art erfolgt.
‚Männe’ ging zurück nach Berlin und Wilhelm Bartel starb kurze Zeit später.
Ein besonnener Mann, der nie auch nur einen einzigen Pfennig veruntreut hätte.
Jürgen
1974 kamen Wolfgang Sittig, Gunnar Tews und Jürgen zu uns. Der erste als Lehrling, der zweite als Diplomingenieur für Fangtechnik/Hochseefischerei, der dritte als Gehilfe, der sich in der Ausbildung zum Meister befand. Gunnar, 24-, und Jürgen, 30jährig, brachten großen Elan mit. Künftig mit den dreißig Quadratkilometern Wasserfläche experimentieren zu können, würde ihnen einen Riesenspaß bedeuten.
Aber es sollte alles ganz anders kommen.
Gunnar war bei einer früheren Operation mit Hepatitis B verseuchtem Blut infiziert worden.
Jürgen dagegen trug einen anderen Keim mit sich, der ihn schon in seinen jungen Jahren extrem halsstarrig machte.
Jürgen, größer als einsneunzig, mit einem Gesicht wie ein Senator, eindrucksvoll fest von Charakter, wie es schien, entschlossen im Verfolgen seiner Ziele, geriet sehr schnell mit den ihm unterstellten älteren Kollegen in Konflikt. Er mochte insbesondere Horst Gruß nicht. Beide ähnelten einander in ihrer Arbeitsweise. Sie konnten sehr geschickt mit Nadel und Messer umgehen und schneller als alle anderen Männer die Fanggeräte herstellen.
Eines Tages beorderte Jürgen, Horst Gruß, der wie erwähnt wie ein Sinti aussah, an eine bestimmte Stelle im Kastorfer See, der aufgrund seiner Geometrie eine besonders große Uferzone bot. Wir bewirtschafteten dieses Gewässer zum ersten Mal. Der Rat des Bezirkes hatte uns die etwa 80 ha Wasserfläche übertragen.
„Hier baust du die Kastenreuse ein”, wies Jürgen den zwanzig Jahre älteren Fachmann an.
Horst tat, was ihm aufgetragen wurde.
Jürgen arbeitete in ungefähr dreihundert Metern Entfernung mit Gruß um die Wette.
Den großen Kerlen zuzusehen, wie sie mit den teilweise sechs und acht Meter langen Reusenpfählen umgingen, war ein Vergnügen.
Anderthalbe Stunden dauerte das durchschnittlich für die Schnellen, wenn sie wollten. Beide wünschten es einander zu beweisen. Sobald sein Fangeschirr stand, kam Jürgen angerudert. Elegant mit über Kreuz gefassten Griffen an den Rudern, wuchtete er mit seinen langen Armen den kleinen grünen Plastekahn voran.
Als er den jungen Mann ankommen sah, ahnte Gruß schon, er würde kritisiert werden. Jürgen verzog sein Gesicht. Er schüttelte den Kopf missbilligend.
„Die Reuse steht schief!”
Gruß nahm die Zigarre, die er sich gerade angesteckt, ruhig aus dem Mund und blies den Rauch sehr langsam aus. Diese Frechheit riss seine Seele aus der Verankerung. Er war außer sich. Er hätte brüllen können. Seine Reuse stand exzellent da und exakt an dem ihm zugewiesenen Platz. Kein Fisch käme an ihr vorbei. Jürgen kommandierte. „Ausbauen?”, fragte Gruß ungläubig. Seine verwirrten, braunen Augen schauten genau hin um herauszufinden, wie viel Spott da im Spiel sein mochte.
Schon zweimal waren sie aneinander geraten. Das erste Mal, als sie gemeinsam mit der Handelektrode und mit dem tragbaren Stromaggregat unterwegs gewesen waren, um Aale zu fangen. Da hatte Jürgen sich ebenfalls angemaßt, ihn ungerechtfertigt zu rügen. Er sei nicht schnell genug. Man müsse den eiligst aus dem Spannungsfeld fliehenden Aalen die Stange mit der Anode schneller hinterher stoßen um sie zu lähmen und anzuziehen.
Stets entkam ohnehin mindestens die Hälfte aller Fische dem Stromkreis und zwar von denen, die nicht bereits vor den ihnen ja bekannten, nahenden Geräuschen die Flucht ergriffen hatten.
Beim zweiten Mal ließ Gruß sich zu einem Fehler hinreißen. Er wagte es Jürgens Vater zu tadeln.
„Gewiss! Den Murks baust du wieder aus.”
Gruß zögerte eine Weile. Schließlich gehorchte er, wenn auch zähneknirschend, weil Jürgen ihn beim Vorsitzenden Lüdtke noch schwärzer malen könnte.
Er drehte und zog und wuchtete die mehr als einen Meter tief in den Seegrund gerammten Reusenpfähle wieder ans Tageslicht. Stück für Stück. Dreißigmal dieselbe Last und Plage, dieselben gestöhnten Flüche.
Es ist allemal eine ungeliebte Arbeit Großreusen ausbauen zu müssen, weil sich damit keinerlei Fängerhoffnungen verbinden.
Horst Gruß wusste, das war auch die Rache für den Streit, den er einige Zeit zuvor vom Zaune gebrochen, indem er den Genossenschaftsvorsitzenden wüst beschimpft hatte, weil der in sein Fangrevier eingefallen war.
Jürgen stand an jenem Tage noch in voller Manneshöhe hinter seinem Vorgesetzten. Was Lüdtke geschehen war, das konnte ihm passieren. Dem wollte er vorbeugen. Hier sollten ein für allemal die Weichen und Signale gestellt werden.
Definitiv wollte er die Macht- und Rangfrage entscheiden.
Dabei herrschte ringsherum tiefster Friede. Still wie ein Spiegel lag der schöne See. Aller Lärm der Straßen und Plätze rauschte fernab. Rings um sie herum breiteten sich die Bilder mit den weißstämmigen Birken, den Erlen, Eschen und den friedlich grünenden Büschen aus.
Wer die beiden Männer so gesehen, hätte meinen müssen, gegen solche Harmonie könnten sich Vernunftbegabte nicht stemmen. Gruß, der sodann zum zweiten Mal das Geschirr in den See stellte, bemerkte, dass Jürgen ihn beobachtete.
Noch einmal dürfte der ihn nicht kritisieren. Das Maß war voll.
Getraute er es sich dennoch, dann spränge er dem Lulatsch an die Kehle.
Nach genau anderthalb Stunden kam Jürgen erneut angerudert. Mit denselben Bewegungen, mit eben demselben aufregend abweisenden Gesichtsausdruck.
Na, Freundchen, mach’ dich nicht unglücklich.
Gruß glaubte zu ahnen, was sich im Innersten des jüngeren Mannes abspielte. Er spannte sich.
Erkannte sein Brigadier nicht, dass er zurückschlagen wird?
Nein!
Der wollte seinen Kopf durchsetzen.
Als Jürgen den erfahrenen Altgesellen Gruß abermals anmeckerte, stieß der seinen Arbeitskahn jäh vorwärts, um das in seine Nähe vorgerückte kleinere Boot mitsamt dem hochmütigen Menschen zu rammen. Jürgen wich diesem Angriff geschickt aus. Mit zwei kleinen aber kräftigen Ruderzügen drehte er das Wassergefährt auf der Stelle.
Grußens Angriff stieß ins Leere.
Damit war die endgültige Feindschaft zwischen ihnen erklärt.
Für Horst Gruß hatte Jürgen sein Konto weit überzogen.
Gruß, der gewiss zur Hälfte ein Sinti war, bekam Rückenwind, mit Ausnahme von Willi Krage und Reiner Lüdtke. Gruß war nicht irgendwer, sondern eine Persönlichkeit mit großem Kredit bei den andern Kollegen.
So bildeten sich innerhalb der Genossenschaft zwei Parteien.
Wenig später stellte sich auch Dieter Giesa auf Jürgens Seite.
Hermann Göck rang die Hände hilflos, als er irgendwann bemerkte, wie die Dinge sich entwickelten. „Wie ist das möglich?”, klagte er. „In einer so kleinen Truppe, da muss doch Einigkeit herrschen.”
Es herrschte die Unausgewogenheit. An Stelle des kühlen Verstandes, herrschten die hitzigen Gefühle vor.
Jeden Morgen, jeden Abend gab es fortan ohrenbetäubenden Krach.
Nichtigkeiten wurden aufgebauscht, Worte wie Waffen benutzt.
Jürgen hätte erkennen müssen, dass sich niemand jemals völlig unterwerfen lässt. Wer sich die Köpfe und Herzen nicht geneigt machen kann, der zerbricht eher die letzten Brücken, als den Willen eines Menschen. Um das zu wissen war er noch zu jung und zu hart.
Die nächste größere Auseinandersetzung musste kommen. Sie kam sehr schnell. Es ging zunächst nur um eine Frage, die Gruß seinem Brigadier stellte. Der verstand sie falsch, glaubte, er wäre wieder
einmal attackiert und gekränkt worden. Er fühlte sich herausgefordert.
Vielleicht hatte Gruß die Frage ausgeklügelt.
Jürgen sollte umgehend Auskunft geben über den aktuellen Stand der Aalplanerfüllung.
Bekannt war, dass Brigadier Jürgen seine Zahlen nur ungern preisgab. „Albern“, fanden das selbst seine besten Freunde. Denn jeder konnte die Summen, wenn auch ein wenig aufwendig, zusammentragen. Ein Wort gab das andere.
Gruß sagte, Jürgen könne wohl nicht bis drei zählen. Jäh in Wut geraten, griff der große, junge Mann unbeherrscht zu. Er zog Horst Gruß an seinem ohnehin langen Hals in die Höhe.
Das war unerhört, und es war gefährlich. Wollte er ihm das Genick verrenken oder die Halswirbel auseinander reißen? Empört berichteten mir Horst Gruß und der immer streitbare Werner Hansen, ein Choleriker ersten Grades, (dabei von voller Männergröße und mit Pfoten die schon mehr als einen ausgewachsenen Keiler aus dem Gebüsch zur Straße geschleppt hatten,) was vorgefallen war. Ich kam gerade aus dem Kühlhaus und war über siebzehn leger dastehende, mit Karpfen gefüllte, Fischkisten gestolpert.
Beide Männer empfingen mich mit hochroten Gesichtern.
Jürgen musste kurz zuvor diese zehn Zentner Karpfen auf die Leichtkühlfläche gestellt haben, statt sie tiefzufrosten. Wer sonst?
Das kann man für eine Nacht machen. Aber nicht drei Nächte und Tage hindurch. Denn es war ein Freitagnachmittag, an dem sich alles zusammen ereignete.
Mir oblag es, das Kühlhaus zu kontrollieren, und da Reiner sich im Urlaub befand, musste ich handeln.
Hier ging es um Gedeih und Verderb von hochwertigen Nahrungsmitteln, für deren Behandlung es einen Katalog von Vorschriften gab.
Und es ging nun auch um Gedeih und Verderb der Genossenschaft.
Jürgen zog sich gerade an. Er streifte sein weißes Hemd über den Kopf, als ich ihn zur Rede stellte.
327
Sofort gereizt erwiderte er, was ich mir erlaube, ihn vollzunölen. Er wüsste sehr wohl, wer mich vorschickte. Jetzt nütze ich die Gelegenheit aber aus, den amtierenden Vorsitzenden zu spielen, wozu ich ja sonst nicht käme.
Alt genug und demzufolge hinlänglich einsichtig, hätte ich mich von ihm nicht provozieren lassen sollen. Seelenruhig hätte ich ihm sagen müssen, er möge, obwohl bereits umgekleidet, die Karpfen in den Tiefkühlteil stellen und betreffs des körperlichen Angriffs auf Horst Gruß bekäme er von mir einen schriftlichen Verweis.
Aber mich juckte es, den arroganten jungen Mann anzufahren.
Denn knapp zwei Wochen vorher hatte er mich blamiert.
Was ein Hermann Witte sich erlauben durfte, mich meiner religiösen Grundeinstellung wegen, lächerlich zu machen, das nahm er, der fast zwei Jahrzehnte Jüngere, für sich nicht ungestraft in Anspruch.
Hermann Witte hatte den Zuschauern beim Fischfang in Strasburg, dem wahrscheinlich gesamten Kollektiv des Landambulatoriums, detailliert mitgeteilt, was ich für ein Sonderling sei. Er brachte die Lacher damit natürlich auf seine Seite.
Nur Jürgen musste noch eins obendrauf setzen und erklären, „Sonderling” sei wohl nicht der rechte Ausdruck, ich sei ein Worteverdreher. Das traf mich hart. Es klang nicht nur so, er meinte, ich lüge wie gedruckt.
In der Öffentlichkeit wollte ich damals diesen Streit nicht austragen. Aber jetzt kam ich unklugerweise darauf zurück.
Ich sprach nicht gerade ausnehmend höflich mit ihm.
Da fiel er in seinem unbeherrschten Zorn lautstark über mich her, glaubte wir seien unter vier Ohren und er wäre der mir ohnehin Überlegene.
Ungehemmt bezichtigte er mich der Unlauterkeit. Jürgen schrie mich aus der Turmhöhe an, ich könne ihm den Buckel kreuzweise herunterrutschen.
Es musste ihn jemand, der Rang und Namen besaß, gegen mich aufgewiegelt und ihm den Rücken gestärkt haben.
Es so zu formulieren war der Gipfel der Unverfrorenheit.
Überhaupt, was ging ihn mein religiös motiviertes Engagement an? Was hatte das mit den 500kg Karpfen zu tun?
Da betraten seine beiden Kontrahenten den Umkleideraum.
„Aha!”, höhnte er, raffte seine Siebensachen und verschwand ins Wochenende.
Da wir die zehn Zentner Karpfen nicht verkommen lassen konnten, brachten wir die gefüllten Fischkisten in den Tieffrostraum. Mühsam beherrscht schrieb ich den Verweis und händigte ihm das Schreiben am Montag aus. Den Fetzen Papier würde er nie und nimmer anerkennen. Gruß hätte ihn verdient. Am Dienstag, nach seiner Rückkehr, versuchte Reinhardt Lüdtke wieder Ruhe in den zerfahrenen Haufen zu bringen, indem er Jürgen nur unter vier Augen ermahnte und Horst Gruß sowie Werner Hansen beschwichtigte. Damit war ich nicht einverstanden.
Gruß kündigte. Satt vom Gezänk, erwog auch ich ernsthaft das Kapitel Binnenfischerei aus meinem Leben zu streichen. Da verunfallte Reinhardt Lüdtke, während er sich auf dem Weg zu einer Fischereifachtagung befand. Im Gegenverkehr raste er mit seinem Wartburgkombi unter den Anhänger eines W 50. Durch die Wucht des Aufpralls riss sein Auto des Anhängers Achse aus der Verankerung. Lüdtkes Fahrzeug wurde in diesem Vorgang die Kabine komplett weggeschnitten. Sie haben den Schwerverletzten, der wie ein zusammengestauchtes Bündel dalag, mühsam aus dem Pedalraum herausziehen müssen. Die Gesichtshaut war ihm vom Kinn an bis in Augenhöhe gerissen worden.
Wäre er angeschnallt gewesen, hätte Reiner den Unfall nicht überlebt.
Zufällig war ich nur wenige Stunden später an der Unglücksstelle vorbeigefahren. Verwundert bemerkte ich die Trümmer eines Anhängers und eines Autos, die verstreut im Straßengraben lagen. Ahnungslos, um wen es sich handelte, dachte ich: Das war ein tödlicher Unfall.
Sofort, als ich davon erfuhr, beeilte ich mich, ihn im Krankenhaus in der Pfaffenstraße zu besuchen.
Als sie mich, am dritten Tag zu ihm ließen, sah ich nur die Kissen,
die weißen Binden und eine kleine Öffnung um den Mund herum und seine Augen.
Er sprach langsam, war jedoch klar bei Bewusstsein.
Reiner sagte mir an jenem Tag etwas, das ihm wichtiger als alles andere zu sein schien. Er sprach zwar leise und langsam, doch mit gewissem Nachdruck. Es betraf erstaunlicherweise nicht das innerbetriebliche Klima. Es ging um seine Einstellung zur SED.
Er habe keine Wahl. Beitreten werde er der Partei wohl müssen: „Aber mache dir keine Gedanken!”, setzte er hinzu.
„Eingestiegen bin ich dennoch nicht. Sie haben es versucht.” Redete er von der Stasi?
„Ja, davon. Sie wollten, dass ich mit ihnen zusammenarbeite.” Er stockte: „Nein. Da waren sie bei mir an der falschen Adresse.”
Reiner atmete schwer. Leise setzte er hinzu: „Sei versichert, dass aus mir nie ein Kommunist wird!”
Natürlich begriff ich, was er meinte.
Nachdem er noch mehr dazu gesagt, schwieg er und ich saß eine Weile ratlos. Immerhin galt für mich, er dürfte sich nicht aufregen.
Im Begriff aufzubrechen gab er mir ein Zeichen.
Er möchte mir noch etwas mitteilen.
Es dauerte, bis Reiner wieder reden konnte. Er zögerte auch. Natürlich, da war es wieder. Diese Beklemmung derer, die den Wunsch hegten, sich mir anzuvertrauen. Es gab Themen, die enorm vorsichtig behandelt werden mussten. Man konnte nie wissen, was sich aus einem einmal geäußerten Wort entwickelte. Jede, auch die kleinste Kritik am Regime konnte sich zu einem Ungeheuer auswachsen. Aber das Umgekehrte gab es ebenfalls. Lautstarke Attacken auf den Staat DDR verhallten manchmal auch folgenlos.
Mochten solche Tatsachen von Zufällen abhängen oder Taktik sein, die furchteinflößende Ungewissheit spielte ihre Rolle in jedem Falle wirkungsvoll. Man konnte nie wissen...
Ich kannte einen Oberst, der wurde eingesperrt und musste danach lange einsitzen, nur weil er sich herausnahm, während der Tage des Prager Frühlings, Alexander Dubcek einen tapferen Mann zu nennen. Ein anderer teilte mir mit, welche Arbeit er im Kurierdienst zwischen kommunistischen Bundesbürgern und ‚der Firma’ (dem Staatssicherheitsdienst) leisten sollte, und dass er es strikt abgelehnt hätte, seinen guten Namen als Deck- und Briefkastenadresse herzugeben. Danach fiel er in Panik, weil er sich plötzlich fürchtete, mir gegenüber allzu offen gewesen zu sein.
Kaum jemand war mit seiner SED-Mitgliedschaft glücklich.
Viele, die im Verlaufe der Jahre der Partei beitraten, glaubten eine Möglichkeit zu sehen, sich durch diese Zugehörigkeit in verschiedene Prozesse einmischen zu können. Danach jedoch quälte sie das Gefühl, damit direkt oder indirekt einer Sache zu dienen, die nicht sauber war. Einige Genossen gaben unumwunden zu, dass sie immer wieder mit sich selbst im Hader lagen, ob und wie weit sie sich mit der SED einlassen durften und ob sie die Herrschaft eines Systems stärken durften, das wahrheitsgemäße Differenzierung wie die Pest mied, das nur die Farben Schwarz und Weiß kannte, und Weiß bedenkenlos für sich allein beanspruchte.
Reiners Bedenken gingen ebenfalls in diese Richtung. Er hasse die Bespitzelung und erst recht diesen Geist der Unredlichkeit, in dem die Partei Berichte fälsche, um ihre Wirtschaftspläne wenigstens auf dem Papier zu erfüllen.
Zu jedem schäbigen Trick würden sie greifen um ihre Führungsrolle zu sichern und zu rechtfertigen. Reiner verurteilte die Privilegiensuche nicht weniger maßgeblicher Genossen und distanzierte sich von solchem Benehmen. Dann machte er eine vorsichtige Handbewegung und setzte hinzu: „Ich will versuchen sauber zu bleiben, aber ich komme nicht umhin Genosse zu werden. Ich wollte dir nur sagen, dass ich deshalb nicht blind bin.”
Trotz der Umstände kamen wir an jenem denkwürdigen Nachmittag noch einmal auch auf unsere betrieblichen Probleme zu sprechen.
Den Zank zwischen Gruß und Jürgen habe er nicht verhüten können. „Du musst wissen, Gerd, dass da Dinge gelaufen sind, von denen du nichts weißt. Gruß reizte ihn vor der Kastorfer Geschichte, wo er konnte, heimlich. Man sollte beide Seiten hören, ehe man urteilt. Das weißt du doch. ”
Von meinem Ärger wegen der Hochfahrenheit Jürgens sagte ich nichts.
Reiner erwähnte, dass Gruß lediglich versucht habe vor sich selbst wegzulaufen, wie Leute, die immerzu nur reisten, um sich selbst zu entkommen. „Löst das etwa unsere Probleme, wenn man sich ihnen entzieht?”
Ich schämte mich, weil auch ich erwogen hatte wegzurennen.
Wir und der §5, Landbauordnung
Trotz erzwungener Beteiligung an Fischveredlungsprojekten des Kooperationsverbandes “Qualitätsfisch der Mecklenburger Seenplatte” dem wir anzugehören hatten, war uns gelungen trotz Überweisung von sechshunderttausend Mark, bis 1975 weitere achthunderttausend Mark anzusparen.
Diese Summe hätte ausgereicht, um ein mittleres Wirtschaftsgebäude hinzustellen sowie zusätzlich eine neue Spundwand rammen zu lassen, die wir ebenfalls dringend benötigten.
Aber Geld ist nicht alles. Es floss nach der zweiten Agrarpreisreform reichlich. Nur wir konnten dafür nicht kaufen, was wir wünschten oder benötigten. Wir mussten unsere finanziellen Mittel in zwei Kategorien teilen.
Es gab dem Grunde nach verfügbares und nicht verfügbares Eigenkapital.
Wir hätten zehn Millionen auf dem Betriebskonto haben können, solange sie nicht in den Bilanzen der zuständigen Kreis- oder Bezirksverwaltungen vorkamen, entsprach ihr effektiver Wert Null. Das war seitens der Obrigkeit gewollt.
Sämtliche auf dem Akkumulationsfonds geparkten betrieblichen Finanzen konnten erst nach und durch einen vor dem Finanzministerium der DDR zu verteidigenden Gesamtplan zum Zahlungsmittel befördert werden.
Statt wie früher für eine Tonne Kleine Maränen 1700,-Mark einzunehmen, erhielten wir nun über 9100,-Mark. Das war mehr als das Fünffache.
Anstelle von früher 3,50 Mark je Kilogramm Karpfen, bekamen wir 14,00 Mark und das unter Beibehaltung der Endverbraucherpreise (EVP).
Selbstverständlich konnte das nicht gut gehen. Niemand dreht an der Preisschraube willkürlich und zugleich ungestraft.
Günter Mittags Finanzwissenschaftler, die gehofft hatten ihre Agrar- und Industriepreisreform sei die rettende Idee, forcierten damit lediglich die bereits angelaufene, sich verselbständigende, sozialistische Inflation.
Wir erhielten jedenfalls, trotz unserer guten Finanzlage keine Baukapazitäten vom Rat des Bezirkes. Es gab zwar Versprechungen, weil wir so nicht weiterhausen konnten, aber eben keine Planziffer dafür.
Wir fertigten unsere Reusen und Fanggeschirre immer noch in derselben alten Bretterbude an, durch die der Wind pfiff.
Der Dachdecker und Bauingenieur Jürgen Krüger gab mir, als wir wieder einmal gemeinsam zur Nacht fischten, den guten Rat: „Baut doch nach §5, Landbauordnung.”
„Und das wäre?”
„Ihr baut in Eigeninitiative!” Beim Rat des Bezirkes wurde unser Antrag positiv gewertet. Sie gaben uns grünes Licht. Die Ratsleute freuten sich über jede Eigeninitiative.
Das war ja bekannt, einer der will, kann zehnmal mehr erreichen als der, den sie antreiben müssen.
Zunächst musste einem von uns der Hut aufgesetzt werden. Ich wollte ihn unbedingt haben und bekam ihn auch.
Dann berieten wir im Vorstand, wie viel Aale ich zur Beschleunigung des Vorhabens, Bau einer Betriebsstätte, zur freien Verfügung hätte.
Falls es partout nicht weiterginge, beabsichtigte ich mit Räucheraalen nachzuhelfen. Rigoros wollte ich das kuriose Geschäft betreiben, allerdings in keinem Falle anders, als ausschließlich zugunsten des Betriebes. Ich wollte vom Sozialismus nicht betrogen werden, also betrog ich ihn auch nicht. „Hundert Kilo höchstens.“, sagte Reiner. Mir schien ich käme mit fünfzig hin.
Schließlich sollten es zweihundert werden.
Das erste Problem bestand darin, dass ich niemanden fand, der umgehend die zum Zweck der Baugrunduntersuchung erforderlichen Bohrungen auf unserem Torfgelände ausführen würde. Wir vermuteten, wir stünden über ungefähr fünf Meter Torf.
Hier und da gab es Achselzucken. Dann ging ich zu einer Firma in der Katharinenstraße. Wieder hing das Kinn des Zuständigen tief herunter. Das kannte ich schon. Sie waren ausgebucht.
Deshalb lamentierte ich nach Kräften: „Wir haben es satt in der Hütte am See zu sitzen und Wintertags zu frieren.”
„Andere Leute frieren mitunter auch!”
Mutig schoss ich hinterher: „Aber ich habe Räucheraale zu bieten!”
Kopfrucken. „Wie bitte?”
„Na, ja, wir fangen welche, wenigstens die Grünen...”
Der betreffende Brunnenbauchef schaute mich noch einmal an, und ich hielt dem argwöhnisch prüfenden Blick stand.
Kess lachte ich ihm ins runde Gesicht: „Für jeden Mann ein Kilo Räucheraale gratis.”
„Moment mal!”, lautete die nicht unfreundliche Erwiderung. „Ich muss mal in den Kalender sehen... tja da haben wir,... da hätten wir,... sagen wir nächste Woche...”
Sie bohrten von Hand, primitiv wie vor hundert Jahren und stellten fest, dass wir sogar über sechs Meter Torf bauen mussten. Die Bohrkerne mussten analysiert werden.
In einem Labor im Industrieviertel gab es freie Kapazitäten.
Ebenfalls kein Problem die fünfundvierzig Stück, zehn Meter langen Stahlbeton-Rammpfähle zu kaufen. Rammkapazitäten standen uns desgleichen zur Verfügung, wenn auch nicht sofort.
Auch die Eisenbieger mussten nicht überredet werden, da wir zur Ausführung der Flechtarbeit die Genehmigung erhielten, Fachleute für die Feierabendtätigkeit zu werben und sie leistungsgemäß zu entlohnen.
Aber dann stellte sich uns das erste größere Hindernis in den Weg. Beton erwies sich als Engpass. Denn wir benötigten 180 Kubikmeter in einem Ritt. Alle Lockungen mit Räucheraalen halfen nicht.
In der ganzen Umgebung gab es keine Mischanlage, die uns außerplanmäßig den Beton für die Fundamentplatte liefern konnte. Der April des Jahres ‘78 verging, der Mai und der halbe Juni. Keine Aussicht. Hartmut Wißmann vom Tiefbaukombinat machte mir dann wieder Hoffnung, zugleich winkte er verächtlich ab. „Du mit deinen Räucheraalen!”, kritisierte er scharf. „Soll ich mir die 200 Kubikmeter aus den Rippen schneiden? Ende Juli eventuell.”
Wenn die neue, aus dem Westen kommende Mischanlage getestet würde, dann... vielleicht.
Ich rechnete. Wir hassten es, daran zu denken, dass wir noch einen Winter in der Holzhütte zubringen sollten. Im Juli, das ginge noch. Wir könnten es schaffen, im Januar ins neue Gebäude zu ziehen.
Im Juli erkrankte die Großmutter des Mannes, der die Westtechnik installieren sollte. Im August wurde desselben Mannes Nichte krank. Im September gab es noch ein Problem.
Mir leuchtete durchaus nicht ein, dass von der Gesundheit unbekannter Westnichten und Westomas unser Wohlergehen abhängen sollte.
Hartmut Wißmann ärgerte sich ebenfalls.
So sei das mit den Abhängigkeiten von BRD-Importen.
„Hast du denn schon die Steine und die Fensterrahmen? Hast du die Dachbinder und die Klempner-, die Elektriker- und Fliesenlegergewerke sicher?”
„Ich habe Zusagen.”
„Zusagen sind keine Steine. In Eggesin kann man gelegentlich Hohlbetonsteine erwerben.”
Telefonate.
„Ne, sie kommen in diesem Jahr zu spät. Wo denken sie hin? Steine sind Goldstaub!”
Ich schluckte. „Aber sie haben mir doch gesagt...”
„Gesagt, lieber Mann, gesagt habe ich gar nichts, nur mal nachgedacht, wie ich ihnen helfen könnte.”
„Ich habe Räucheraale!”
„Mögen wir gar nicht. Aber wenn sie Zeit und Leute mitbringen, dann produzieren sie sich die Steine selber.” Mir stockte der Atem.
„Reiner, wir müssen mit ein paar Mann nach Eggesin fahren und Steine machen.”
„Ihr habt Fische zu fangen, ... aber wenn’s denn durchaus sein muss...” Wir setzten uns zu viert in meinen kleinen Trabantkombi und fuhren nach Eggesin, in fünfzig Kilometer Entfernung. Dort schütteten sie uns den Fertigbeton auf ein Freigelände hin.
Von Hand schaufelten wir die Mischung in die Formen am Fuß der von uns gemieteten Rüttelmaschine. In jeweils ungefähr je fünf Minuten stellten wir vier Hohlblöcke her, die nur noch abbinden und trocknen mussten. Das Gerät schüttelte uns genauso zusammen wie das leblose Material. Noch im Schlaf spürten wir die Rüttelei.
Am letzten Tag, an dem wir die noch fehlenden dreihundert Stück fertigen wollten, ließ sich plötzlich mein Trabantgetriebe nicht mehr schalten. Immerzu, sooft ich es versuchte, es rastete der vierte Gang nicht ein.
Telefonate hin und her. Wir mussten uns beeilen. Schließlich mussten wir ja auch unseren Fangplan erfüllen. „Im Augenblick haben wir keine Ersatzteile!”
„Auch nicht für Räucheraale? Naja! Zwei, drei Kilogramm hätte ich übrig.“
„Tut mir leid.”, erläuterte Werkstattmeister Roland. „Zwei Kilo kostet mich schon die Überredung im Hauptlager.”
Mit Ach und Krach gelangte ich bis zur Reparaturwerkstatt.
„Dann baut mir doch bitte auch gleich eine neue Auspuffanlage ein.”
Großes Stirnrunzeln.
„Mein lieber Mann, wir haben zwar zehn Stück Vorschalldämpfer bekommen, aber nicht einen einzigen Hauptschalldämpfer...”
Am zweiten Oktober gossen sie endlich die Bodenplatte, am fünften legten die Maurer der bunt zusammengewürfelten Feierabendbrigade den ersten selbstgefertigten Hohlblock auf die als Sperrschicht dienende Dachpappe.
Für Feierlichkeiten und große Reden war an diesem späten Nachmittag des Baubeginns keine Zeit. Es dunkelte bereits. Noch konnte man die Zeichnung Robert Brenndörfers lesen. Große Lampen hatten wir bereitgestellt. Doch die erhellten das Baugelände nur partiell taghell.
Den betriebsfremden Handlangern und Maurern sagten wir eine Prämie zu. „Wenn Ihr den Rohbau bis zum 20. hochgezogen habt, dann...”
Löthe, wie sie ihn nannten, der Baubrigadier, maulte, „na, ja, bloß Geld...”
„Jeder bekommt zwei Kilogramm geräucherte Aale obendrauf.”
Da rief „Löthe” schallend: „Männer, rangeklotzt, es gibt was für Muttern!”
Am siebenten ging es mit voller Kraft weiter. Zum Glück war das ein Feiertag und wir hatten einen ganzen Tag vor uns. Reiner, unser Vorsitzender wuchtete und schob von früh morgens bis spät abends das Baumaterial heran. Er lief als wäre Steinekarren sein Hobby. So keimte wiederum die Hoffnung auf, dass wir es bis zum Frosteinbruch doch noch schaffen könnten.
Inzwischen stand fest, dass wir die Dachbinder der geforderten Abmaße und Norm nirgendwo erwerben könnten. „Meines Wissens hat die Tischler-PGH ‚Vorwärts’ in Neubrandenburg Beziehungen zu einer der Herstellerfirmen in Anklam und Pasewalk. Die sind zumindest im Besitz der Nagelpläne.”
Ohne weiteres erhielt ich in Anklam außer den Nagelplänen noch ein paar gute Ratschläge, doch niemand ließ sich von mir verleiten, die erforderliche Menge Latten und Bretter zu verkaufen um daraus die Brettbinder herstellen zu lassen.
Die Tischlergesellen waren bereit, eine Sonderschicht einzulegen, zumal ich unmissverständlich eine besondere Delikatesse in Aussicht stellte.
Nur konnte ich durchaus keine Bretter bekommen.
Vorsitzender Emil Tilp zuckte mit den Achseln. Er möchte, könne uns aber nicht helfen: „Material musst du mir schon anliefern!”
Sein Holzkontingent sei voll ausgelastet. „Geh zum Rat des Bezirkes, die vergeben mitunter noch freie Kapazitäten! Aber du musst dich durchsetzen.”
Jürgen Meyer, den Leiter des Bereiches Binnenfischerei, suchte ich da zuerst auf. „Wärst du doch ein Jahr früher gekommen, ich hätte dir die dreißig Festmeter Holz besorgen können.”
„Mensch, Jürgen, ich brauche sie jetzt...”
„Tut mir leid. Geh mal zu Horst.”
Horst G., der an diesem Tag in der Abteilung Forstwirtschaft seinen Dienst versah, hörte mich zwar geduldig an, schüttelte jedoch hinterher missmutig den Lockenkopf. „Dat ihr Kerle auch immer auf die letzte Minute angekleckert kommt. Bin ick die Feuerwehr?”
Leider war das bezirkliche Forstamt nicht so schnell wie die Feuerwehr, aber ich stand unter Druck wie ein erhitzter Dampfkessel über Flammen.
In meiner Naivität hatte ich zu lange geglaubt, Binder problemlos einkaufen zu können.
„Glaube macht selig, backen macht mehlig!” den Kinderreim hörte ich bis zum Verdruss. An jenem Nachmittag im Spätherbst ’78 verließ ich das weiße Gebäude am Friedrich-Engels-Ring mutlos. Weder wortreiche Überredung noch Betteln, noch meine massiven Bestechungsversuche hatten mir den ersehnten Erfolg beschert. Da trollte ich mich nun niedergeschlagen davon, besaß zwar die Nagelpläne und die Zeichnung für das planmäßig mit Eternitplatten zu deckende Dach, hatte sogar Räucherdelikatessen und konnte mit alledem nichts anfangen.
Ärgerlich rollte ich meine Papiere zusammen und fluchte, weil ich mit leeren Händen dastand.
Vor Wut hätte ich explodieren können.
In diesem Augenblick sah ich einen stattlichen, mit geflochtenen Achselstücken geschmückten Forstmann auf mich zukommen.
Der kam mir gerade recht. Wie durch ein Zielfernrohr visierte ich ihn durch meine dreiviertelmeterlange Rolle an. Als er bis auf zwei Meter herangekommen war, fuhr ich ihn an: „Euch Förster müsste man samt und sonders erschießen!” Er stutzte. Er musterte mich. „Genosse, was hast du denn für Probleme?”
Und wie mitfühlend er das sagte! „Genosse!”
Zum ersten Mal, wie mir schien, verstand mich einer und litt mit mir.
„Ich muss spätestens im November das Dach auf unser neues Wirtschaftsgebäude setzen. Wir haben nach § 5 gebaut. Niemand in deinem Haus gibt mir ein Holzkontingent. Uns wird der Winter dazwischenkommen.”
„Wo kommst du her?”
So und so!
„Komm mal mit!”
Es war mir zumute, als wäre ich in die Kindertage zurückversetzt worden und Mutter hebt mich hilfeschreienden Knirps liebevoll vom kalten, nassen Fußboden auf.
Genosse Skibbe!
Wären alle Menschen der Welt so wie der da, mit seinen dicken Achselklappen...
Ich las das Schild an seiner Tür. Nur wenige Sekunden telefonierte er, der Oberlandforstmeister Siegfried Schreib, mit irgendjemand.
„Also dreißig Festmeter Lärche oder Fichte! Die kriegst du! Für deinen Betrieb allemal.”
Das war es, was die Besten unter den ‘Kommunisten’ wollten, Solidarität. „Wann bekomme ich das Holz?”
„Eingeschlagen ist es schon... muss nur noch gerückt werden.” Es läge da und da in den Tiefen der Neustrelitzer Forsten. „Du kannst die Stämme ab übermorgen abfahren lassen!”
„Wir fahren übermorgen nach Leningrad, Betriebsausflug.”
Er schmunzelte, statt mich auszuschimpfen.
Ich lachte innerlich, das war die Sorte Leute, die ich mochte.
„Wird dir die Zeit knapp, was? Muss ja noch geschnitten werden und noch genagelt, nich?”
Ich nickte ein bisschen hilflos, vielleicht tauschen sie. Er winkte ab. „Keine Experimente! Ich lasse dir die Stämme nach Zwiedorf ins Sägewerk schaffen!” Er setzte sich an einen anderen, mit Papieren übersäten Schreibtisch, schob den Aschenbecher beiseite, nahm einen Kalender zur Hand und schrieb etwas auf. „Hier hast du den Termin für den Schnitt.”
Mit Schrecken sah ich, das war die hohe Zeit für die Nachtfischerei auf Maränen.
Meine Reaktion fiel ihm auf.
Er fragte nicht lange. Nur ein kurzer Blick.
„Ich sehe schon. Diesmal fahrt ihr in den Kaukasus. Hier hast du einen neuen Termin fürs Sägewerk.”
„Dafür gebe ich dir fünf Kilogramm Räucheraale!”
Er schüttelte den geröteten, breiten Kopf. „Deinen Aal will ich nicht. Es war mir eine Freude, dir helfen zu können.”
„Ach was.”, wehrte er bescheiden ab, als ich ihn lobte und mich bedankte: „Sieh zu, dass du das Dach draufbekommst!”
Mitte Januar, einen Tag bevor der Winter richtig zuschlug, zogen wir in unseren durch Nachtspeicheröfen herrlich beheizten Neubau ein. Es gab im Sozialismus tatsächlich noch Freude.
Das Ende einer Ära
Entsprechend der staatlichen Planvorgabe mussten wir zwischen 1978 und ’85 alljährlich mehr als 200t Fische fangen, und zwar unter ständiger Reduzierung des noch hohen Futterfischanteils.
Und das bei zunehmender Eintrübung unserer Seen.
Probleme in Hülle und Fülle. Die abfließende Gülle selbst aus kleinen und kleinsten Viehbeständen machte dem Tollensesee sehr zu schaffen. Er verträgt nur kleine Mengen solcher Düngung. Sonst explodieren die Kieselalgenpopulationen und diese ständige Verdoppelung wird erst gestoppt, wenn keine Nährstoffe mehr zur Verfügung stehen, dann aber erfolgt das Massensterben der Algen. Sie sinken faulend auf den Seegrund und wehe, wenn dort nicht genügend Sauerstoff vorhanden ist, dann klaut die verrottende Algenpampe den Fischen sozusagen die Luft. Schlimmer, es entstehen bei dem Mineralisierungsprozess Gifte, darunter der tödliche Schwefelwasserstoff. Große Areale des Seebodens wiesen bereits ab Juli jeden Jahres, nach 1980, nur noch Null Milligramm Sauerstoff aus. Alarm! Alarm!
Zudem nahte zwischen mir und Jürgen der Tag der Entscheidung zwischen seinen und meinen Anhängern. So konnte es mit uns nicht weitergehen. Reiner vermochte es nicht, die beiden Gruppen zu einigen.
Jürgen, der gelegentlich sogar phlegmatisch wirkte, gab nie nach.
Werner Hansen und ich ebenfalls nicht. Immer häufiger gerieten wir als Gruppen aneinander. Es wäre das Letztdenkbare für mich gewesen, gegenüber dem wesentlich Jüngeren, nur weil er statt der geforderten fünf Knoten, sechzehn verschiedene zu knüpfen vermochte, allzu behutsam aufzutreten. Hätte er sich nicht selber für perfekt gehalten, wäre er vielleicht, irgendwann, perfekt geworden.
Jürgen sah gut aus. Er konnte sich, seiner beachtlichen Körperkräfte wegen wie ein Ross in die Sielen legen, war vorbildlicher Familienvater, schielte offensichtlich nicht nach den Röcken anderer Frauen, handelte, wie er dachte. Eigentlich ein idealer Mann.
Nur ob er immer richtig dachte, das erwog er nicht jeden Tag aufs Neue.
Das war es. Seine Überzeugungen hielt er für hinlänglich abgerundet. Er stellte sie, wie mir schien, nur selten wiederholt in Frage.
Er war starr und stur wie ein Betonklotz.
Mit Werner Hansen hätte er längst Frieden schließen können. Aber dagegen stand der alte, nie überwundene Groll wie ein Bollwerk.
Gemeinsam rackerten sie. Und doch stießen sie einander bei der geringsten Differenz so geräuschvoll ab, als prallten zwei große Glocken gegeneinander. Uns dröhnten dann jedesmal die Ohren.
Einmal, kurz vor Weihnachten 1986 war das gewesen, mitten in einer offiziellen Zusammenkunft, gerieten sie heftig in Streit.
Um eine Nichtigkeit ging es. „Du hast den LKW ohne Erlaubnis für Privatfahrten genutzt” warf Werner Hansen ihm vor.
„Aber nur in Verbindung mit einer Dienstfahrt!”, verteidigte Jürgen sich.
„Twintig Kilometer Ümwech sünd doch beten veel!” ("Zwanzig Kilometer Umweg sind doch ein bisschen zu viel!")
Dafür hätte er die festgelegte Kilometerpauschale bezahlen müssen und: „Du, Werner Hansen, spionierst ja hinter jedem her!”
„Was? Ich?”
Beide Recken sprangen zugleich auf ihre Beine. Die Blicke wie Boxer ineinander gesenkt, rückten sie wutentbrannt gegeneinander. Gleich würde es krachen. Das fehlte uns noch. Eine Keilerei in einer Mitgliedervollversammlung. Schneller als Reiner, der die Versammlung leitete, reagierte ich und erhob mich spontan, ging dazwischen.
Da stand ich nun zwischen zwei Schwergewichtlern, die einander wie Todfeinde hassten. Von rechts oben kam etwas, von links oben nicht minder. Es fiel auf mich herunter.
Nichts war zu sehen.
Unsichtbar fuhren mir harte, kalte Hände an die Gurgel. Nie zuvor hatte ich ein vergleichbares Gefühl erlebt. Mir schien, ich stünde nackt da. Rings um meinen Körper legte sich nasse, eisige Watte. Ich glaubte plötzlich, ich sei gelähmt. Wie schwarzer Schnee fiel der Hass auf mich herunter. Erschrocken wollte ich mich zurückziehen. Ein, zwei Schritte entfernte ich mich aus dem Zentrum des Negativen. Zu spät. Meine Augen begannen außer Kontrolle zu geraten. Sie rotierten. Der kleine Raum drehte sich um mich. Sekunden später brach ich zusammen.
Erst als sie mich am Boden liegen sahen, hörten sie auf sich anzugiften.
Ein Krankenwagen musste kommen. Ich fand mich außerstande, die Bewegung meiner Beine zu koordinieren. Buchhalterin Inge und Reiner hoben mich auf die Trage. Ich spuckte, das war mir peinlich, aber was half es?
Eine altersbedingte Blockade des Stammhirns wurde diagnostiziert. Was mich niedergeworfen hatte, war überwiegend die Auswirkung der Kälte gewesen. Sie bewirkte, dass meine Gefäße sich zusammenzogen.
Noch tagelang drehte sich das Karussell in meinem Schädel weiter.
Da erkannte ich, dass es die vielleicht schlimmste Strafe wäre, Menschen der Kälte des Hasses auszusetzen. Etwas, das die Richter jeden Tag taten. Menschen müssen geheilt und nicht dem Erfrieren ausgesetzt werden.
Sechs lange Wochen dauerte es, bis ich wieder arbeiten konnte.
Kurz nach den „Volkswahlen” im Mai ’89 sprachen mich mehrere Leute an. Fast übereinstimmend beurteilten sie die Lage der SED negativ: „Diesmal sind sie noch mit einem blauen Auge davongekommen. Das wird nächstes Mal anders aussehen!”
Ich fand niemanden mehr, der die SED für kompetent hielt, die wirtschaftliche Misere zu überwinden. Sämtliche Engpässe in der Versorgung lagen offen zutage. Das sozialpolitische Programm erschien allenfalls noch den jungen Müttern als realisierbar. Die LPG erhielten schon längst nicht mehr die Technik, die sie im Zuge der laufenden Instandhaltung ihrer Maschinenparks dringend benötigten. Schon einige Jahre vorher hatte Werner Felfe, Mitglied des Politbüros der SED und zuständig für Landwirtschaft, Binnenfischerei und Forstwirtschaft während der Statutenkonferenz in Leipzig, auf Anfragen der in Wirtschaftszwänge geratenen LPG-Vorsitzenden, erklärt: Helft euch selbst, dann hilft euch der liebe Gott.
Das sagte alles. Zudem wurde seit langem der Kraftstoff für Industrie und Landwirtschaft rationiert.
Seit vielen Jahren wurden immer mehr LKW nach Irak geschickt. Dort herrschte zwischen 1980 und ’88 grausamer Krieg mit Iran, den die DDR Regierung insofern unterstützte, als sie wüstenfähige LKW des Typs W 50 lieferte und indem sie zumindest für Irak die Panzer reparierte und dafür Erdöl und Devisen erhielt.
Manchmal dachte und fragte ich mich kopfschüttelnd, ob die zuständigen Genossen wohl zu Gott beten, dass dieser Konflikt um den Grenzverlauf am fernen Schatt al Arab nie aufhören möge?
Jeder sah jahrelang die Zugtransporte mit diesen gelben LKW durch die Landschaft rollen. Viele empfanden großes Unbehagen.
Mehr und mehr Ausreiseanträge wurden gestellt. Auch Ärzte suchten das Weite.
Nicht selten klagten Chirurgen, dass technische Mängel sie nötigten die Grenzen des Vertretbaren zu unterschreiten. Düsternis lag über uns. Es herrschte eine Stimmung wie unmittelbar nach dem Krieg.
Mein Gartennachbar, der ebenfalls große Lust verspürte, in den Westen zu gehen, ein Mathelehrer und Genosse, sagte, er hätte diesmal die Wahlkabine benutzt.
„Ich auch!”, lautete mein Echo
Er habe probeweise ’mal die Hälfte der auf den Zetteln stehenden Namen gestrichen, aber bewusst nicht alle. Das behalte er sich für die nächstanstehende Wahl vor. Als wäre ich ein Papagei: „Ich genauso!”
Noch lag der dramatische August in gewisser Entfernung, doch das Ereignis warf bereits seine Schatten voraus.
Den üppigen Auslagen in Intershopläden standen nur klägliche Angebote in den HO-Geschäften gegenüber. Die Abwärtskurve im Sozialismusdiagramm hatte zusätzlich einen scharfen Knick bekommen.
Hervorgegangen aus der Gesellschaft der Arbeiter- und Bauernklasse, gab es Leute mit buchstäblich sich auszahlenden Westbeziehungen und verfügbarer Valuta. Diese Gruppe stellte sich damit, zum Ärger aller Linientreuen, effektiv als Sonderklasse dar, die zumindest bei Karl Marx noch nicht vorkam.
Nur für sie gab es Zugriff auf wenigstens dreißig Sorten Schokoladen sowie weitere zweihundert Sortimente Genussmittel. Die Minderbemittelten dagegen suchten in den beängstigend kahlen Regalen der DDR-Geschäfte vergeblich nach Artikeln, die es vor Jahren bereits gegeben hatte. Hier roch es lediglich nach Kartoffeln und Armut.
Da, im West-Shop gab es alles.
Schnaps allerdings konnte jedermann für DDR-Mark in zahllosen Varianten und überreichen Mengen kaufen. Von jeweils sechs Regaletagen waren mindestens zwei mit Spirituosen gefüllt. Aber kaum Auswahl an Süßigkeiten. Ein paar Bonbons in Plastetütchen lagen schmucklos herum. Besseres bekam man zu überhöhten Preisen, gleich nebenan im Delikatladen.
Unsere DDR-Gemüsestände wurden von denen, die ihre Onkel und Tanten in Hamburg und Lübeck besuchen durften, erst nach der Rückkehr so richtig bedauernd belächelt.
Warum können die das?
Warum ist solche Angebotskultur bei uns nicht möglich?
Was sind die wirklichen Ursachen dafür, dass wir vierzig Jahre nach Kriegsende mit zunehmender Verknappung leben müssen? Werden wir der Mangelwirtschaft denn nie entrinnen?
Das waren die kleinen, aber entscheidenden Fragen. Auch wer in seinem Portemonai kein Westgeld trug, ging gelegentlich in einen Intershop um zu sehen, was alles möglich war. Unwiderstehlich übte die Glitzerwelt der Konsumgesellschaft ihren Reiz aus. Auch wenn man sie nicht als wirklich erstrebenswert betrachtete, sie war der Ausdruck für die Verwirklichungsmöglichkeiten von Ideenvielfalt in einer liberal orientierten Gesellschaftsordnung. Andererseits bewunderten führende Genossen, was DDR-Bürger zustande bringen konnten, wenn man ihnen dafür Freiräume bot.
Binnen Wochen stampften sie ganze Laubenkolonien mitsamt ihren Kleindatschen aus dem scheinbaren Nichts. Händeringend beklagten DDR-Minister: „Hätten wir doch vollen Zugriff auf dieses Potential an Initiativvermögen!” An solchen Stellen zeigte sich, dass Freiheits- und Eigenliebe Werte sind, die Menschen sich niemals rauben lassen werden.
Das unterschätzten die Kommunisten.
Stur glaubten sie, das gesellschaftliche Sein, egal wie es hergestellt würde, müsste das gesellschaftliche Bewusstsein radikal umkrempeln. Das war der unerfüllbare Tagtraum nicht weniger marxistisch-leninistischer Ideologen und Philosophen.
Hier gab es staatliche Planauflagen, die häufig genug nichts weiter als Wunschauflagen waren. Deshalb wurden sie trotz Ach und Krach selten oder nie erfüllt. Im Westen dagegen herrschte freier
Wettbewerb, mitsamt seinen riesigen Vorteilen, aber auch versehen mit dem grässlichen Makel straflos wirkender Brutalität gegen Konkurrenten.
In einem Punkt der Bewertung waren sich im letzten Jahrzehnt des „real existierenden” Sozialismus alle DDR-Bürger einig. Die Sozialismusidee konnte weder mit Gewalt noch mit List durchgesetzt werden, sie jedoch freiwillig zu leben würde den Idealismus einer Mehrheit voraussetzen, die sich wahrscheinlich nicht finden wird, und, - würde diese Mehrheit dennoch zustande kommen, dann wäre das, was sie hervorbrächte, etwas völlig Anderes als der Sozialismus, den sich Erich Honecker und sein Freund Mielke vorstellten.
Nie wird einer hinlänglichen Zahl von Produzenten einfallen, aus blankem Staatsbewusstsein Mehr-Arbeit in die Qualitätsverbesserung ihrer Erzeugnisse zu stecken.
Partei und Regierung haben immer wieder auf diesen Gesinnungswandel gehofft, obwohl ihre Köpfe angeblich dialektisch dachten.
Es ging allen Betroffenen wie uns Fischern. Weil uns und ihnen die Mehrleistung nicht mehr vergütet wurde, unterblieb sie. Der Staat konnte diese Mehrleistung nicht honorieren, weil sich bereits viel zu viele Geldscheine in Umlauf befanden.
Für uns Binnenfischer in Neubrandenburg war die Konsumtionshöhe vom Rat des Bezirkes längst festgeschrieben worden. Gleichgültig, wie viel wir mehr produzierten. Unser Verdienstlimit lag definitiv bei einem Durchschnittsverdienst von 14.4 TDM Netto im Jahr.
Dieser Monatsverdienst von 1200,- Mark (Prämien eingerechnet) war zwar vergleichsweise beachtlich. Nur, das Wissen um diese Grenze spornte nicht an. Einmal fehlten uns exakt zehntausend Mark an der Gesamtplansumme von 480 000.
Möglicherweise hinderte uns dieses geringe Minus daran das Limit zu erreichen. Wir fischten deshalb unter Lebensgefahr in Woldegk auf nur fünf bis sechs Zentimeter starken Eis.
Es bogen sich die Kerneisflächen. Aus gewisser Entfernung bemerkte ich, wie die mit dem Zugnetz beladenen, aus Gründen der Vorsicht, weit voneinander entfernten Schlitten, die von den Männern gezogen wurden, sich ständig bergauf bewegten. Im Zentrum der Last war die gerade so tragende Eishaut mindestens einen viertel Meter eingebeult. Jeden Augenblick musste die schwache Kristalldecke bersten. Ich sah schon, wie meine Kollegen zwischen den Eissplittern um ihr Leben kämpfen würden. Man fischt nicht, bevor der Eismantel Sicherheit bietet. Erst fast an Land angekommen, brach Reiner Lüdtke durch. Zum Glück war an dieser Stelle des Ostufers des Woldegker Sees der Untergrund fest.
Wir fingen genau die Menge Fische, die den fehlenden zehntausend Mark entsprachen.
Aber als wir sie verkauft hatten, stellte sich heraus, dass sie Überplanmenge waren. Ein kleiner Fehler in der Buchhaltung.
Jürgen Kreusch, Sekretär des Kooperationsverbandes “Qualitätsfisch der Mecklenburger Seenplatte” zuständig für Konsumtion und andere Finanzen der angegliederten Betriebe, nahm weisungsgemäß den Rotstift und strich die zehntausend Mark aus der Verdienstberechnung.
Ich schaute ihn an, als wir ihm unseren Jahresabschlußbericht vorlegten. „Wir haben die zehntausend unter Lebensgefahr zusammengebracht, das muss sich doch für die Beteiligten finanziell auszahlen!”
„Nix ist!”, erwiderte er, “ ihr verdient doch genug Geld.”
Dann zuckte er mit den Achseln.
Ich wusste zwar, dass er so entsprechend den Direktiven, die er von seinen Vorgesetzten erhielt, handeln und reden musste, doch ärgerlich war ich trotzdem und verschaffte mir Luft, indem ich ihm und andern Leuten sagte, was ich dachte.
Mir wurde dennoch erlaubt, in den Westen zu reisen. Eine richtige Tante zwar, aber die ich noch nie gesehen hatte und die ich auch gar nicht sehen wollte, feierte ihren 75. Geburtstag. Das gab meinem Sohn Hartmut und mir die Gelegenheit nachzuschauen, wie es ‚drüben’ aussieht.
Gespenstisch wirkten auf uns diese Menschentransporte, die wir kurz vor dem Zusammenbruch der DDR in Berlin erlebten: Zu Dutzenden saßen die jungen Stasileute in den Bussen, um in die Bereiche gefahren zu werden, in denen ihr operativer Dienst erforderlich zu sein schien. Ich sah diese unlustigen Gesichter. Ich sah die Fragen und die Unsicherheit in den Augen der vielen Mitarbeiter des Mielke-Apparates.
Wir sahen auf dem Bahnhof Friedrichstraße die Offiziere des Sicherheitsdienstes mit ihren buchstäblich schnüffelnden Hunden durch die bereitgestellten Züge streifen und schüttelten verstohlen die Köpfe.
Was hätte Heinrich Heine geschrieben, wäre sein “Deutschland, ein Wintermärchen” erst jetzt entstanden?
Ende Oktober 1989 hatte mir der Abteilungsleiter für Land- und Forstwirtschaft vom Rat des Bezirkes eine Reise nach Sotschi zugesprochen. Erikas Anteil mussten wir selbst tragen, dennoch nahmen wir dankbar an.
Zeitgleich begannen auch in Neubrandenburg die Montagsdemonstrationen.
Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass sie zum völligen Sturz des Weltkommunismus beitragen würden. Ich gehörte zu den Zweiflern, unsere Buchhalterin Inge Schoemann dagegen zu den Aktivisten der neuen Zeit. Mir war nicht völlig klar, dass das System inwendig total zerfressen war, dass keine Machtstruktur es mehr zusammenhalten konnte, dass auch der Druck auf die rote Taste nichts mehr geändert hätte. Ich hatte mich geirrt, und das, obwohl ich doch immer wieder behauptete, dass innere Unwahrhaftigkeit den Tod jeder Sache herbeiführen muss. Das war meine eigene Inkonsequenz. Deshalb sagte ich tadelnd zu Inge Schömann: „Was soll werden, wenn ihr das Haus einreißt, in dem wir wohnen?”
Da lachte sie. „Kaputt ist es schon, reißen wir es ganz ein, bauen wir ein neues!”
Sie gehörte seit eh und je zu den Optimisten.
Dabei hatte ich bereits vier Wochen vorher, am Montagabend, den 9. Oktober 1989, im Schein meiner Taschenlampe auf dem Tollensesee, während die Motorwinden unser großes Zugnetz durch
die Tiefen zog, den “offenen Brief” Hermann Kants gelesen. Ich saß auf der wärmenden Blechhaube des Kuttermotors, den Rücken an die Kabinenwand gelehnt, schaute zu den Sternen auf, hielt diese Zeitung Nr. 237 der “Jungen Welt” in Händen und mir war ähnlich zumute wie in jenen Frühlingstagen 1956, nachdem Chrustschow mit seinen Genossen Tacheles geredet hatte.
Mir schien damals, man solle diesen Brief, den Kant an den Chefredakteur des FDJ-Blattes, Hans-Dieter Schütt, gerichtet in Goldrand fassen lassen. Da glaubte ich noch, das Gute der DDR, die Vollbeschäftigung und das, wenn auch aus der Not geborene, echte Solidargefühl, ließe sich mit dem Guten der freien Welt verbinden und vielleicht erhalten. Kants Ehrlichkeit und meine eigenen Überzeugungen ließen gar keinen anderen Schluss zu.
Da sagte dieser mutige Mann die volle Wahrheit und das zweitwichtigste Blatt der DDR-Presse brachte sie ungeschminkt!
„Eine Niederlage ist eine Niederlage, und passe sie noch so schlecht in den Vorabend eines gloriosen Feiertages. Die Züge, mit denen die deutsche Reichsbahn, die einst Lenin aus der Schweiz durch Deutschland nach Russland transportierte, nunmehr Bürger der Deutschen Demokratischen Republik via Deutsche Demokratische Republik aus Warschau nach Braunschweig verfrachtet, sind nun einmal wahrlich keine Siegeszüge. Unseres Sieges jedenfalls nicht.”
Bezugnehmend auf diese neue Flüchtlingswelle, die mit der Grenzzaunentsicherung auf ungarischer Seite im August des Jahres ’89, erst möglich wurde, fuhr Hermann Kant fort:
„Schärfsten Widerspruch lege ich ein, wenn man den Anschein erweckt, ich sei des Glaubens, meines Gegners Kraft allein veranlasse junge Frauen, ihre Kinder über Botschaftszäune zu reichen, und dieselbe Kraft bewege junge Männer, freiwillig Quartier in fremden Kasernen zu suchen...Weniger vor dem Sumpf da drüben warnen ( ja es gibt ihn, und ich weiß, und seine Beschreibung soll auch künftig nicht verboten sein), mehr an die eigene Nase fassen (Selbstkritik nannte man das vor Zeiten). Wir müssen uns an der eigenen Nase aus dem Sumpfe ziehen...”
Anfang November ‘89 sah ich ganze Scharen von Parteigruppenorganisatoren und Parteisekretären der Betriebe durch den Neubrandenburger Kulturpark zur Stadthalle eilen. Alle waren aufs Höchste erregt. Die Parole, die dort von der Bezirksleitung der SED ausgegeben wurde, lautete „Schadensbegrenzung”.
Dies war die erste, mir bekannt gewordene Versammlung, in der Parteiaktivisten geschlossen vom vorgegebenen Kurs abwichen und von ihrer Führung ‚Reisefreiheit für alle’ forderten.
Selbst wer kurzsichtig war, sah voraus, welche Folgen die Öffnung eines dermaßen komplexen, aber geschlossenen Systems haben musste. Ebenso unglaublich wie Hermanns Kants Zeilen und das Ergebnis dieser Parteikonferenz, kam mir dann die erste Montagsdemonstration vor, die ich miterlebte. Am Abend des achten November, nachdem wir die Nachtfischerei eingestellt hatten, befand ich mich eher neugierig als kämpferisch vor der Johanneskirche zwischen Hunderten und verstand die Welt nicht mehr. Da drinnen sangen sie fromme Lieder. Gebetsworte drangen über Lautsprecher nach außen. War das unser atheistisches Neubrandenburg?
Dann kamen sie. Massen drangen aus der Kirche ins Freie. Von Kerzenschein schwach erleuchtete Spruchbänder erschienen: „Die Führungsrolle der SED muss weg!”
Im Halbdunkel flimmerte es.
Wie oft hatte ich mich durch Plakate und Schrifttafeln bedrängt gefühlt. Nun las ich die direkt entgegengesetzten Texte, aber ich kann nicht sagen, dass ich gejubelt hätte. Vielleicht war ich zu alt geworden, um mich riesig zu freuen. Mir erschien das Ganze unausgewogen. Sie versprechen sich zuviel, dachte ich.
Reden wurden auf dem Karl-Marx-Platz gehalten.
Lehrerinnen entschuldigten sich für den Unfug, den sie in gesellschaftskundlichen Fächern gelehrt hatten. Ein Mann namens Dörnbrack fordert die Menschen in väterlich-pastoralem Ton auf, in der DDR zu bleiben. Wenn die SED beiseite geräumt sei, dann lohne es sich auch wieder zu leben.
Ich konnte bereits damals, vor Wochen, nicht begreifen, warum die Parteigewaltigen in Leipzig hilflos zuschauten und fürchtete andererseits, dass die scharfmacherischen Aussagen von Leitern der Kampfgruppen in buchstäbliche Gefechte umgesetzt werden könnten. Hatte Michael Gorbatschow ihnen in Anbetracht der Ereignisse vom Mai in Peking auf dem Platz des himmlischen Friedens kategorisch untersagt, Waffen einzusetzen?
Dem wahrscheinlich mächtigsten Mann der Welt stand klar vor Augen, dass er wohl den Erdball sprengen, aber nicht die Freiheitsidee aufhalten kann!
Am Dienstag, dem 05. Dezember ’89, fünf Wochen, nachdem ich nach vierzigjähriger Abstinenz wieder ins politische Leben zurückkehrte, indem ich mich der CDU anschloss, flogen wir in den Kaukasus.
In unserem sehr modernen, wunderschön am Fuße der riesigen Berge gelegenen Hotel in Dagomir waren wir von den sich überstürzenden Ereignissen in der Heimat abgeschnitten. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Nie zuvor schien mir der Empfang von Informationen und das Zeitunglesen so wichtig zu sein.
Aber jede deutschsprachige Zeitung, die wir erhalten konnten, war bereits eine Woche alt, obwohl wir nur drei Flugstunden von Berlin entfernt wohnten und fast jeden Preis für zuverlässige Nachrichten bezahlt hätten.
Wir rannten aufgeregt umher und suchten neue Anhaltspunkte wie es in der Heimat weitergeht und fanden doch nichts.
Vor unserer Haustür wälzten sich die sturmgepeitschten Wogen des Schwarzen Meeres. Kaum weniger wogten in uns die zahllosen Fragen, Bedenken, Hoffnungen und Befürchtungen.
Wir bildeten eine Gruppe von fünfzig Leuten, die der Rat des Bezirkes wegen ‚gewissenhafter Planerfüllung’ im Bereich der Nahrungsmittelproduktion sozusagen in den Sonderurlaub geschickt hatte. Am Abend des 8. oder 9. Dezember schrieb die Hotelleitung endlich eine brandaktuelle Notiz auf ihre schwarze Bekanntmachungstafel. Ich wunderte mich über die einhellig zustimmenden Äußerungen meiner Reisegefährten, die fast ausnahmslos der SED angehörten, als sie es einander vorlasen: „Der erst am 18. Oktober als Generalsekretär der SED bestätigte Egon Krenz von Hans Modrow gestürzt!”
„Halleluja!” Sie jubelten, als hätten sie gemeinsam einen großen Lottofünfer getippt. Mich freute es auch. Nur fragte ich mich ernsthaft, wer und was am Ende dieser Überraschungskette stehen wird.
Erika nahm es ganz gelassen. Für sie war wichtig, dass ich unter allen Umständen zu ihr hielt. Mitten im Botanischen Garten des sich ungeheuer ausdehnenden Kurortes Sotschi wandte ich mich an eine der beiden Dolmetscherinnen.
Ihr Bruder sei Offizier der Roten Armee und sie und er sehen dieselbe Gefahr wie ich. Instabilität wird heraufziehen.
Gorbatschow hätte den führenden Soldaten erlaubt, ihren Armeedienst zu quittieren. Die Pazifisten gingen, die Hardliner blieben und das angesichts eines Waffenpotentials, das sämtliches Leben auf diesem herrlichen Erdball dreißigmal vernichten könnte. Das war meine Sorge. Es gab weltweit zu viele unsichere Kantonisten, die ihres persönlichen Machterhaltes wegen möglicherweise alles tun und die in ihrem Wahn, sogar Atomwaffen einsetzen würden.
Ein holpriger Übergang
Noch im April 1990 hielt ich eine offene Konfrontation für denkbar.
Westdeutsche Ratgeber, die uns besuchten um uns Neupolitiker zu beruhigen und sicherlich wohlmeinend zu beeinflussen, überzeugten mich nicht. Es gibt keine Sicherheit, je mehr wir sie uns wünschen, umso weniger.
Dr. Alfred Dregger kündigte kurz vor Ostern seinen Besuch an. Sein Wunsch war, am 20. April auf dem Marktplatz in Neubrandenburg aufzutreten.
Kurz zuvor war ich zum stellvertretenden CDU-Kreisvorsitzenden gewählt worden und es gab Leute, die mich mit mancherlei Informationen versahen. Da meine Vorgesetzte, Frau Benz, in
Friedland wohnte, fiel mir die Aufgabe zu, unsere politische Arbeit in Neubrandenburg zu organisieren.
Ich erwog den ernsten Hinweis, den ich am Karfreitag erhielt, dass es zu einem Massenaufmarsch fanatischer Linker kommen könnte, falls der als ‚Rechtsaußen’ geltende Vorsitzende der CDU/CSU Bundestagsfraktion seine Rede öffentlich halten würde.
Im Geiste sah ich einen Tumult voraus.
Was dann?
Diese Vision von flatternden roten Fahnen beschäftigte mich erheblich. Im Gegensatz zu meinen Gesprächspartnern aus dem Konrad-Adenauer-Haus war ich nicht der Meinung, dass ein letztes Aufbäumen der immer noch im Lande unter Waffen stehenden NVA auszuschließen sei. Meiner Überzeugung nach gab es immer noch genügend Oberste, die ihre Machtinsignien, selbst gegen alle Vernunft, gemäß ihrem noch in Kraft stehenden Fahneneid verteidigen könnten, wenn sie ein rotes Signal dazu auffordern würde.
Ich schloss eben von mir auf andere, ein Trugschluss, wie ich nun weiß.
Wir müssen uns selbstverständlich korrigieren dürfen, in jeder Hinsicht übrigens, bis das Fundament unseres Wesens Wahrhaftigkeit ist. Aber dieses Ziel darf niemand dadurch in Frage stellen, dass er sich selber untreu wird. Gewiss ist keiner gut beraten, wenn er aufgefordert wird seine Überzeugungen einfach über Bord zu werfen. Deshalb schien mir, es sei leichtsinnig, solche Erhebung der Linken auszuschließen, zumal der 20. April Hitlers Geburtstag war. Ein Umstand, den niemand im Büro des Herrn Dr. Dregger, auch nur im Traum bedacht hatte, den jedoch ein gewiefter Propagandist durchaus in seine Argumentation, gegen unseren Gast, und damit gegen uns, hätte zur Geltung bringen können.
Mag sein, dass dies übertriebene, vielleicht sogar verrückte Vorstellungen und Befürchtungen waren.
Indessen stimmten die Mitglieder des Kreisvorstandes der CDU Neubrandenburg nach Erörterung der Problemlage meinem Antrag mehrheitlich zu, Herrn Dr. Afred Dregger nur in der Stadthalle Neubrandenburg auftreten zu lassen.
Vor allem der spätere Oberbürgermeister Neubrandenburgs, Peter Bolick, sah die Dinge ähnlich wie ich.
Im Büro Dr. Dreggers war man entsetzt. Denn ich bestand auch auf Änderung einiger Details auf den Ankündigungsplakaten.
Morgens am 20. April bat mich Dr. Dregger zu einem Vieraugengespräch. Ich verteidigte den Beschluss und meine eigenen Ansichten, sagte, was ich dachte und zu befürchten glaubte. Im Beisein seiner charmanten Sekretärin umrundeten wir vielredend die Tribünen des Sportplatzes am Badeweg.
Er war sehr beherrscht und zugleich sehr wütend auf mich. Ich ließ mich auf nichts ein, obwohl mir das schwer fiel, denn wer war ich gegen ihn? Wahrscheinlich hielt er mich für einen verkappten Roten.
Vielleicht liefen ihm bei dieser Vermutung kalte Schauer über den Rücken.
Doch obwohl ich mit einigen seiner politischen Auffassungen nicht übereinging, stand ich nicht gegen ihn. Mir war nur klar, dass ein Mann des Westens bei bestem Willen nicht nachempfinden kann, wie jemand fühlt, der sein Leben unter dem Diktat der Partei der Arbeiterklasse zugebracht hatte.
Leider oblag es mir, Herrn Dr. Dregger eine zweite Absage zu erteilen. Es war meine Pflicht, ihm den Beschluss des Rates der Neubrandenburger Geistlichkeit mitzuteilen.
Dieser Rat hatte mich eigens eingeladen und mir dringend nahe gelegt, Herrn Dr. Dregger zu übermitteln, dass er an der ‘Gedenkstätte für die Opfer der Nazibarbarei und der kommunistischen Gewaltherrschaft’ in Fünfeichen, kein Kreuz hinstellen möge, und sei es noch so klein.
Das wäre ihre Sache. Sie hätten bereits den Termin für die Ausrichtung eines Gebetsgottesdienstes festgelegt. An diesem Tag wollten sie den Platz für ein künstlerisch gestaltetes Kreuz bestimmen.
Es gibt irgendwo ein Foto, das uns gemeinsam im Bereich des Vorgartens des damaligen Neubrandenburger CDU-Hauses zeigt. Dr. Dregger lächelte in die Kamera hinein. Doch ich wusste, wie bitter seine Gefühle waren.
Denn seine bereits vorbereitete Presseerklärung musste wesentlich geändert werden, das von ihm bestellte Holzkreuz war umsonst hergestellt worden...
Anfang Juli ’90 wählten meine Fischerkollegen mich zu ihrem Geschäftsführer, unmittelbar nachdem unsere Gelder im Zuge des In-Kraft-Tretens der vereinbarten Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion beider deutscher Staaten aufgewertet wurden.
Unter der Bedingung, nur für eine zweijährige Wahlperiode zur Verfügung zu stehen, nahm ich an. Ich sagte: „Meiner Überzeugung nach setzen wir gemeinsam fort, was wir gemeinsam begonnen haben. Wir bleiben als gleichberechtigte Mitglieder in einer zu bildenden e.G. zusammen.
Zwei Drittel des Bargeldes setzen wir sofort für einen Komplexneubau ein, ein Drittel teilen wir anteilmäßig, als Entschädigung für entgangenen Lohn auf.“
Das wurde einhellig akzeptiert. Auch mein Gegenspieler Jürgen widersprach nicht. Mit den anderen ‚Damen und Herren’, wie meine Kolleginnen und Fischerkollegen seit März ’90 offiziell hießen, bestätigte auch er in namentlicher Abstimmung, dass wir zusammenhalten wollten.
„Dann dürfen wir auch daran denken, uns durch Baukreditaufnahme zu verschulden!” Reiner Lüdtke nickte, Jürgen nickte. Sicherheitshalber wiederholte ich mich: „Wir werden eine Million Mark gemeinsam abzutragen haben.”
Geplant war der Neubau längst. Architekt Robert Brenndörfer hatte ganze Arbeit geleistet und alles adaptiert. Erste Bankgespräche verliefen verheißungsvoll. Wir bestellten die Dampframme. Spannbetonpfähle lagen noch herum. Wir hatten ja bereits zu DDR-Zeiten begonnen und lediglich neue Vorstellungen einbezogen. Ein Zurück war nun unmöglich. Aber es waren ja die Zuverlässigen an meiner Seite, der treue Wolfgang Homeyer, Werner Hansen, Wolfgang Sittig, Frank Busse, Detlef Inhof, Reiner Rottmann, Dieter Giesa und natürlich Reiner und Inge Schoemann.
Auch der viel zu früh verstorbene Ulrich Johanns hätte mir beigestanden. Da aber flatterte uns am 04. Juli 1990 die erste Gewässerkündigung auf den Tisch. Der Rat der Gemeinde Knorrendorf teilte uns kurz und bündig mit, was sie für richtig hielten: „Hiermit kündigen wir Ihnen sämtliche Gewässer unseres Territoriums...”
Wenige Tage später sollten die nächsten kommen.
Wer erlaubte es sich, uns die Gewässer zu entwenden, die wir mit teuren Satzfischen versehen hatten?
Sofort legte ich schriftlichen Protest ein, verwies auf Artikel 9 des Einheitsvertrages. Da hieß es: Bis auf weiteres gelten die DDR-Bedingungen. Davon ging ich aus, dass es im Wesentlichen bleibt, wie es ist, und nahm zunächst nicht ernst, was sich da anbahnte.
Wir waren immer noch die rechtmäßigen Bewirtschafter der Wasserflächen zwischen Neustrelitz, Stavenhagen, Penzlin und Neubrandenburg, ausgestattet mit Bewirtschaftungsverträgen. Mein Finger lag auf dem Gesetzesband Einheitsvertrag.
Noch dachte ich nicht an Jürgen.
Ich wollte davon ausgehen, dass mein Dauerkontrahent ebenso gut wie ich wusste, was eine Zustimmung zur Verschuldung bedeutete. Zumindest durfte er keine Schritte gegen uns einleiten. Ein paar Tage lang ließ ich die Dinge auf sich beruhen.
Eine attraktive, junge Dame aus dem Konrad-Adenauer-Haus kreuzte in meinem Büro auf. Sie stellte mir ein paar Fragen, die Kommunalpolitik betreffend. Da gab es keine Probleme, jedenfalls keine großen. Aber als sie hörte, dass ich den übernommenen Betrieb nicht nur personell, sondern auch strukturell erhalten wolle, erschrak sie. Ihr Mund spitzte sich. Sie sagte: „Oh, o, da sehe ich Sie aber schon oft vor dem Kadi sitzen!” Ich lachte noch und verabschiedete sie mit einem Scherz.
Wir fischten selbstverständlich in den uns von den Bürgermeistereien gekündigten Gewässern.
Es gab Hinweise auf Befischung unserer Seen durch andere. Zunächst beunruhigte mich das nur wenig. In Waren und Prenzlau gab es analoge Problemfälle. Sicherheitshalber fuhr ich auf den Lindenberg, wo die Stasi gehaust hatte, da befand sich nun der Torso des ehemaligen Rates des Bezirkes Neubrandenburg. Mein Wunsch war, mit Rainer Prachtl zu reden. Er saß dort und verkörperte in seiner Stellung und in dieser Phase die höchste Autorität im Bezirk. Noch befanden wir uns rechtlich in der DDR.
Wir trugen zwar bereits das ersehnte Westgeld in den Taschen und im Kopf, doch noch hieß unser Land offiziell DDR.
„Du bist im Recht. Ich gebe es dir schriftlich!”, sagte Rainer Prachtl und ließ Jürgen Meyer kommen, den im Bezirk für Binnenfischerei zuständigen Fachmann.
„Jawohl, die alten Rechtsträgerschaften bleiben vorläufig in Kraft...”
Das gab mir Zuversicht. Deshalb blieb ich ruhig, zu ruhig wahrscheinlich, zu lange auch. So vollzog sich das Folgende zunächst, ohne mich sonderlich zu erregen.
Auszüge aus dem Betriebsprotokoll:
„Am 19.Juli 1990 wird uns per Schreiben des Bürgermeisters Herrn Schwarz, Rehberg mitgeteilt, dass die im Grundbuch in der Flur 3, Flurstück 6 eingetragene Seenfläche an eine Privatperson verpachtet sei.
Es handelt sich um den Balliner See, auch bekannt unter der Bezeichnung Rehberger See.
Die sofortige fernmündliche Erkundigung ergibt, dass Herr Jürgen N. die betreffende Privatperson ist.
Der Vorstand der Genossenschaft wartet einige Tage auf eine Erklärung von Jürgen N. unserem Genossenschaftsmitglied.
Jürgen jedoch verschweigt uns weitere Fakten, obwohl in verschiedenen Gesprächen, an denen er aktiv teilnimmt, die Frage erwogen wird, wie wir mit der marktwirtschaftlichen Herausforderung fertig werden können.
Neue Kündigungsschreiben trudeln ein.
Wir wehren uns. Doch zwischenzeitlich, am 28. Juli, erhalten wir Antwort aus Knorrendorf auf unseren Protest.
„Wir haben Ihr Schreiben vom 13. Juli erhalten. Nach Auskunft durch einen Rechtsanwalt, haben wir bestätigt bekommen, dass unsere Kündigung vom 27. Juni 1990 rechtskräftig ist und somit bestehen bleibt.”
Protokollauszug vom 28. Juli:
„Ein persönlicher Besuch des Geschäftsführers Herrn Skibbe in Knorrendorf. Das Gespräch mit der Bürgermeisterin Frau Hartwig ergibt keine Übereinstimmung.“
Ein uns gut gesonnener Anglerfreund gab mir den entscheidenden Hinweis: „Das Haupt ist Herr K., suche ihn auf.”
Der mir das riet, hatte Ahnung.
Ich fuhr umgehend hin, wünschte mit Herrn K., dem Leiter des Gemeindeverbandes Rosenow, zu reden.
Man ließ mich ein. Ich nannte meinen Namen. Er nickte nur. Er wusste Bescheid.
Da saß er, ein energischer, bärtiger Fünfziger. Hinter seinem Schreibtisch hockte er sicher. Seine Brillengläser funkelten: Ich bin ein Demokrat!
Ich konterte auf ähnliche Weise: Ich auch!
Er schaute mich durchdringend an. Ich stellte ihm mein Anliegen vor: „Wir bauen eine neue Betriebsstätte, wir haben beschlossen zusammen zu bleiben und gemeinschaftlich zu wirtschaften, nicht gegeneinander.”
Seine lapidare Antwort lautete: „Stalinistische Genossenschaften brauchen wir nicht mehr!”
„Sagten sie stalinistische?”
„Ich sagte und meinte stalinistische!”
Wie ein Fisch im schlechten Wasser schnappte ich nach Luft. Demokraten?
Weiß der Mann, was das ist?
Liberaler sei er.
„Ich bin CDU-Mann!“
„Blockflöten!” Gut, dass ich keine Pistole besaß. Sollte ich dem da erklären, dass ich am 30. Oktober 1989 in die CDU eintrat, weil sie an eben diesem Tage erklärte, sie kündige die Bündnispolitik mit der SED auf? Er beharrte, ich beharrte: „Wir werden morgen im Kastorfer See fischen”
„Ich schicke ihnen die Polizei auf den Hals. Herr Jürgen N. ist der neue Bewirtschafter!”
Hatte ich es nicht geahnt? Meine ohnmächtige Wut ließ ich mir nicht anmerken: „Tun sie, was sie nicht lassen können!”
Schnell fand ich mich vor der Tür wieder.
Unser Genossenschaftsmitglied Jürgen besaß einen gültigen Pachtvertrag, wir dagegen galten nun als Fischdiebe.
Mit meinen gelben, alten Trabant bin ich mit überhöhtem Tempo nach Hause in die Fischerei gefahren. Im Flur des Wirtschaftgebäudes traf ich Detlef Inhof. Der strohblonde Exhochseefischer wies mit dem Kopf zur Tür des Netzlagers: „Da drinnen”, wisperte er.
Mit einem Ruck stieß ich die Tür auf.
Jürgen saß da und Reiner. Zwei Umrisse wie aus Bronze gegossen, Nachdenklichkeit und Besorgnis. Reiner, zumeist gutmütig und hilfsbereit war gerade im Begriff zu erklären, dass er wenig Hoffnung habe, dass ich ihm einen Vorschuss für die fälligen Pachten geben würde... „Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? In einer Stunde ist Mitgliedervollversammlung!” Jetzt gab es kein Halten mehr. Entweder Jürgen N. oder wir. Jürgen hat ein Signal gegeben, wenn wir dem nichts entgegen setzen, dann bricht es.
Mensch Jürgen, wir haben dein Versprechen schriftlich! Es schnürte mir die Kehle zu.
Der große junge Mann mit dem ausdrucksstarken Gesicht ging in den ersten Arbeitsraum. Da setzte er sich hin und strickte eine Netzreihe herunter, als wäre nichts geschehen. Ich sprach ihn kurz an und er antwortete normal, als sei nichts passiert. In der Vollversammlung, die ich leitete, legte ich in wenigen Sätzen die Situation dar. Entweder stellt Jürgen sich auf unsere Seite oder er muss die Genossenschaft verlassen. „Die Pachtungen, die Jürgen betreibt, schließen uns von dem Recht auf Wiederfang der von uns eingesetzten Fische aus.”
Er entgegnete: „Ich will frei sein und nehme nichts zurück! Mit der Kommandowirtschaft ist es aus!”
„Dann schließen wir dich aus!” Er schaute mich an. In seinen Augen las ich die Ablehnung. Mich lehnte er ab, die Genossenschaft lehnte er ab, die meisten Männer, außer Dieter Gisa und Willi Krage widerstanden ihm längst, wegen seiner Arroganz.
„Du hast dich in namentlicher Abstimmung für den Fortbestand unseres Unternehmens ausgesprochen...”
„Na und? Ich bin im Recht!”
„Dann schneiden wir dich ab.”
Auszug aus dem Protokoll des 10. August 1990:
„Nach kurzer Bedenkzeit und folgender Diskussion stellt Herr Skibbe in der Mitgliederversammlung den Antrag auf Ausschluss von Jürgen N. aus der PGB Tollense.
Von 16 stimmberechtigten Mitgliedern, sind 14 anwesend.
3 Enthaltungen, 1 Gegenstimme, 10 Dafürstimmen; ...“ Jürgen begab sich mit seinen Freunden nach draußen. Er hielt mit ihnen Rat. Als ich sie so dastehen sah, schien mir, er würde gar nicht begreifen, was ihm widerfahren war.
„Wir sehen uns vor Gericht wieder!”, sagte er nur und ich erinnerte mich der Worte der schicken, jungen Dame aus dem Konrad-Adenauerhaus. Zunächst musste ich meine Ankündigung in Kastorf wahr machen. Am nächsten Morgen würden wir auf jeden Fall und demonstrativ im Kastorfer See fischen. „Werner (Hansen), ich komme morgen mit!” sagte ich, denn wir konnten sicher sein, dass wir auf heftigen Widerstand stoßen werden.
Werner Hansen wollte nicht, dass ich mit ihm fahre, ich hätte zu Hause genug zu tun. Aber unser gemeinsames Auftreten im Territorium Rosenow war mir wichtiger.
Wir verluden einen der leichten grünen Plastekähne, das Notstromaggregat, die Handelektrode, den Sicherheitsschalter, Minuspol, Gleichrichter, Kescher, den großen Fischbehälter und setzten uns in den Exmilitärwagen vom Typ Robur.
Hätten wir, als wir durch Knorrendorf fuhren, die Sekretärin am Briefkasten gesehen, dann wäre uns vielleicht in den Sinn gekommen, dass sie Post gegen uns einsteckt.
Wie üblich schoben wir uns vorsichtig und aufmerksam am Gelegesaum entlang. Werner, auf dem Sicherheitsschalter stehend, stieß in vier – fünf – Meter -Abständen die an einer etwa fünf Meter langen Glasfiberstange befestigte handtellergroße Elektrode ins fast glasklare Wasser bis auf den Seegrund in Klaftertiefe.
Wie üblich waren acht von zehn Versuchen umsonst. Dann kam eine kleine Quellmooswiese in Sicht. Da war es nur einen Meter tief.
„Dor sünd wek!” ("Da sind welche (Aale!") sagte er voraus.
Ich hatte oft genug elektrisch gefischt um nicht zu wissen, dass er Recht bekommen würde. Zuerst schossen die untermaßigen Aale heraus, sie wanden sich und taumelten narkotisiert zur Seite. Dann schlängelte sich ein dicker, fünf Zentimeter breiter Aalschwanz heraus. Da der Flossensaum eine verhältnismäßig große Potentialebene darstellt und wir ihm mit der Anode dicht auf den Leib gerückt waren, hielt ihn der Gleichstrom fest. Die Kraft, die von der Anode ausging, reichte jedoch nicht aus, ihn völlig aus seinem Versteck zu ziehen. Werner Hansen half nach. Er war hochrot vor Aufregung weil es sich um einen kostbaren Starkaal handelte. Von drei Aalen dieser Stärke entkommen in der Regel zwei, vor allem wenn sie sich weiter als einen Meter vom Pluspol aufgehalten haben. Sie sind zudem geschwind und enorm gewitzt. Werner hakte mit dem elektrisierten Metall in den sich
krümmenden Schwanz. In diesem Augenblick bemerkte ich, dass sich in vierhundert Schritt Entfernung eine Sandwolke auf uns zu bewegte. Ich musste mich jedoch zuerst um den Aal kümmern, der plötzlich in voller Länge auftauchte. Mit Mühe gelang es mir, dem kräftigen Fisch den Kescher vor das breite Maul zu halten. Gemeinsam erwischten wir ihn und ich kescherte den sich wild wehrenden Dreipfünder heraus und schüttete ihn ins wassergefüllte Schweff. Da tobte er eine Weile umher.
Die kleinen Aale dagegen flohen wie üblich.
Sobald der Stromkreis unterbrochen wird, machen sie sich davon.
Augenblicklich erwachen sie aus der Narkose und schwimmen binnen ein, zwei Sekunden davon, um eine wichtige Erfahrung reicher.
Wenn sie je wieder das Geräusch des im Rhythmus des dröhnenden Notstromaggregates schwingenden Fischerkahnes vernehmen, flüchten sie rechtzeitig und es dauert Wochen und manchmal Monate, bis der Handelektrodenfischer sie wieder sieht.
Mitunter liegen die knapp einhundertfünfzig Gramm schweren Satz- und Mittelaale so dicht beieinander, dass man fünfzig, sechzig mit einem Schlag erwischt. Schade, weil sich unter ihnen auch die fangreifen Männchen befinden, die nur etwa einhundertundachtzig Gramm schwer werden. Man nennt sie, wie die großen, geschlechtsreifen Weibchen, Blankaale. Aale die nicht mehr wachsen.
Das Aussortieren nimmt dann viel Zeit in Anspruch.
Ich stieß Werner Hansen an und wies mit dem Kopf hinüber. Da erschien ein roter Wartburg. Er hatte die Staubwolke hinter sich her gezogen. Für Sekunden entschwand er noch einmal aus unserem Blickfeld. Den Mann am Steuer schien ungeheure Wut zu treiben. Wie ein Wahnsinniger war er auf der Sandpiste entlang gesaust.
Den breiten Rücken durchdrückend wandte Werner sich zu mir, sein volles bartstoppliges Gesicht verzog sich. Es war ein etwas schräges Lächeln, das sich um seine blutvollen Lippen legte. Werner nannte einen Namen, den ich nicht verstand.
Uns war bewusst, dass der Besuch mir vor allem galt. Wir machten weiter und gewahrten vom neuen Standpunkt aus, dass der Wartburg sich nun direkt vor unseren Robur befand. Er hatte uns blockiert. Aber wir konnten von dem Fahrer nichts entdecken.
„De is int Dörp gohn, hei holt de Pulezei!” ("Der ist ins Dorf gegangen und holt die Polizei!") Richtig. Wir waren festgenagelt worden. Zur Linken unseres Robur befand sich ein anderthalb Meter hoher Schotterberg, zur Rechten der See. Vor uns der Wartburg, hinter uns der Kahnhänger auf dem wir unser Boot transportierten und dahinter ein Graben.
Fast wortlos einigten wir uns, es nicht auf eine Konfrontation mit der Polizei ankommen zu lassen. Wenn man uns das Schreiben desBürgermeisters vorweisen würde, könnten sie uns zwingen, die Fische in den See zurückzuschütten.
So wie das unseren Männern bereits andernorts ergangen war. Vierzehn Tage zuvor hatte ich auf dem Polizeirevier in Stavenhagen zwanzig Minuten aufwenden müssen, um meinen geharnischten Protest zu Papier zu bringen und um zu erreichen, dass die von den Polizisten am Ivenacker See beschlagnahmten Fanggeräte wieder herausgegeben wurden, was denn auch umgehend geschah. Sie wunderten sich auf dem Revier nur, wegen der vielen Worte und Sätze die in so kurzer Zeit entstanden. Allerdings die Zander, die sie ins Wasser zurücksetzten, blieben verloren.
Ärgerlich nur, dass unsere Kunden, die sich die Fische bei uns bestellt hatten, später unbefriedigt nach Hause gehen mussten.
Ziemlich eifrig, als wären wir Fischdiebe, verluden wir das Geschirr und die Fische, schoben unser Boot auf den Kahnhänger, banden es fest. Wir hatten keine Wahl. Entweder entkamen wir unseren Gegnern oder wir waren blamiert.
Blamiert? lachte Werner. Er hatte es wieder im Kreuz und ging schief.
Ich bräuchte ihn nicht einweisen, der Robur sei ein Geländewagen und würde den Schutthaufen ohne weiteres erklimmen.
Ohne weiteres?
Umkippen kann uns die Fuhre.
Das war Werner Hansen. Er äugte kurz, startete, schob einen halben Meter zurück, kurvte bis hart vor den roten Kotflügel des Wartburgs, schob noch einmal, das Lenkrad scharf herum reißend, zurück. Jetzt wieder vorwärts. Noch war von dem PKW-Fahrer nichts zu sehen. Jeden Augenblick konnte sich das jedoch ändern.
‚Dass sie fliehen wollten, lässt sich ja wohl nicht leugnen. Dass niemand flieht, der unschuldig ist, liegt wohl auf der Hand!’ So hörte ich sie schon höhnen. Nun erklomm unser braver LKW tatsächlich den kleinen steilen Berg. Er rutschte ein wenig nach links, dann nach rechts. Der Kahnhänger folgte uns. Das Wasser im kubikmetergroßen Fischbehälter schwappte, doch es ging voran. Wir glitten und rollten und bremsten den kleinen Abhang hinunter.
Nicht die Spur eines Kratzers am Wartburg, das war nun wieder das Wichtigste. „Dat Wüchtigste is, dat se uns nich kriegen!” ("DasWichtigste ist, dass sie uns nicht fassen!") erwiderte Werner und schlug einen Weg ein, den ich noch nie gesehen hatte. Querfeldein ging die Fahrt über Stock und Stein, vorbei an Viehkoppeln und Maisstauden.
Banditen!
Nur dieser eine Begriff bemächtigte sich meiner Gedanken.
Ich und er waren unter die Räuber gegangen. Mindestens drei Anzeigen wegen Fischwilderei führten mich wiederholt vor den Kadi. Dabei hatten wir nie in anderen, als in den uns zur Bewirtschaftung offiziell übertragenen Gewässern gefischt.
Einmal bekam ich Recht, zweimal Jürgen N. Noch jedoch war nichts endgültig entschieden. Der Krieg mit Jürgen ging weiter.
Er stellte Netze, wir gerieten mit unseren Zugnetzen dazwischen.
Er pochte auf seine Verträge, wir auf unser Gewohnheits- und Bewirtschaftungsrecht, das uns die DDR gegeben hatte.
Ich ging in Berufung.
Aber es gab auch großen Krieg.
In eben diesen Tagen, Anfang August 1990, waren irakische Truppen in Kuwait einmarschiert. Der große Irak erklärte den kleinen Staat Kuwait zur 19. irakischen Provinz.
Die entmachteten Scheiche schrieen so laut um Hilfe, dass auch wir es vernehmen mussten.
Am 29. November fasste die UNO einen Beschluss, der die gewaltsame Vertreibung Iraks aus dem freien Land Kuwait androhte.
Wie eine düstere Ahnung, dass dies das Vorspiel zum dritten Weltkrieg sein könnte, lag die alte Beklemmung wieder auf allen.
Meine Notiz zur Tagebucheintragung, geschrieben am 6. Dezember, lautete: „Was wird uns 1991 bringen? Unter dem Druck der Zuspitzung der Kuwaitkrise leidet jeder. Jeder weiß, wie leicht Kriege, in die Supermächte verwickelt sind, ausufern können. Wir sehen die vielen anderen Probleme, auch die wirtschaftlichen, rings um uns herum, ...”
Dunkle Geschäfte
Statt Scheine von radikal abnehmendem Wert besaßen wir seit dem ersten Juli Geld. Wir fühlten uns wie Geburtstageskinder, die sich freuen sollten und es doch nicht so recht konnten. In den Lebensmittelgeschäften sah es paradiesisch farbig aus, aber in unseren Seelen immer noch grau. Vorausblickend fanden wir, dass auf dem Wege vor uns kaum überwindliche Hindernisse liegen würden. In einem handelten die meisten Ex-DDR-Bürger logisch richtig. Jetzt drehte jeder den aufgewerteten Groschen dreimal um, ehe er ihn einmal hergab. Bereits zu DDR-Zeiten war es zunehmend schwierig geworden, selbst wertvolle Fische, wie Kleine Maränen, wenn sie in Massen angelandet wurden, en block abzusetzen. Auch die Disponenten und Leiter der Fischauslieferungslager mussten längst wirtschaftlich rechnen und ihr Risiko klein halten. Ihre Prämien hingen von ihrem eigenen Geschick ab. Jetzt, nach der Wende, oblag uns die Fische nicht nur zu fangen, sondern sie auch eigenhändig, Stück für Stück, zu veräußern. Im Spätherbst fingen unsere Männer auf der Lieps wieder einmal große Mengen Brassen, alles stattliche Exemplare. Werner Hansen kam mit seinem Trabant angesaust, um mich zu informieren. Meine Kollegen hofften, dass ich aus zehn Tonnen Bleie mehr als zehntausend Mark erlösen könnte. Werner, immer höchst agil und dabei nicht selten angriffslustig, sah mich scheel an, weil ich mit den Achseln gezuckt und kritisch fragend angemerkt hatte, wer im neuen Konsumentenwunderland noch Bleie kaufen würde? „De Russen!”, konterte er scharf und schaute mich vorwurfsvoll von der Seite an. Manchmal schielte er ein wenig. Auf diese Idee hätte ich von alleine kommen müssen. Auf jeden Fall fahre er jetzt mit einem LKW Kisten zur Fahrgastschiff-Anlegestelle in Prillwitz. Das könne ja nicht falsch sein. Die nächsten Russen saßen in Neustrelitz. Deren Bedarf jedoch wurde meines Wissens von den Prenzlauer und Neustrelitzer Fischern gedeckt. Noch dachte ich nicht in den modernen Kategorien. Dieses Denken: „Zuerst komme ich!” erschien mir noch als unmoralisch.
Da ich verpflichtet war, den Betrieb durchzubringen, blieb mir allerdings nichts weiter übrig, als mich über meine Bedenken hinwegzusetzen. Es war bereits vierzehn Uhr geworden. Schnell. Ich telefonierte, Dolmetscher Herbert Fischer war einverstanden. Er stünde mir zur Verfügung.
“Gleich?”
“Na, ja, sagen wir in einer Stunde!” Exoberstleutnant Herbert bereits seit vier Jahrzehnten im Umgang mit Offizieren der Roten Armee geübt, bat fernmündlich um ein persönliches Gespräch mit dem Chef der rückwärtigen Dienste der Neustrelitzer Panzerdivision. “Kommen Sie, wann immer Sie wollen!”
“Wir sind in einer halben Stunde bei ihnen.”
Ein schneidiger Unterleutnant mit Glacehandschuhen, der wie ein Eleve des Tanzensembles des Bolschoitheaters ging und auftrat, holte uns von der Torwache ab. Oberst Berlett lasse bitten. Es war, glaube ich, dasselbe Tor, das ich erstmalig 1946 gesehen hatte. Es standen da, wie mir schien, immer noch dieselben Worte, die sich um die an die Wand gemalten Panzer und Waffenbrüder rankten: Ruhm und Ehre. Slawa i tschest.
Seit damals ging hier kein normaler Sterblicher mehr ein und aus. In diesem Stadtteil mochten früher vielleicht sechs- oder achthundert Neustrelitzer in ihren Einfamilienhäusern gelebt haben.
Das Tageslicht unter dem wolkenverhangenen Himmel nahm bereits merklich ab. Deshalb erschien uns das Haus, in dem der Oberst sitzen sollte so düster.
Er erhob sich, als wir eintraten, reichte uns die Hand, zeigte seine Goldzähne und gleich seine ganze Freundlichkeit.
Schon die vielen auf dem Flur herumstehenden und diskutierenden Offiziere waren mir angenehm aufgefallen. Solche Russen hatte ich bisher nur selten gesehen. Ich kannte fast nur eckige Gesichter und die überwiegend groben Ausdrücke im Aussehen und in der Sprache.
Kaum, dass Berlett uns angehört hatte, nickte er ermutigend. Er müsse nur noch mit seinem Vorgesetzten reden. Das geschah.
Herbert Fischer flüsterte, der Oberst versuche seinen Chef zu überzeugen, dass sie gemeinsam dringend zehn Tonnen Bleie benötigten.
„Wie teuer?”
In meinem Kopf existierte die Wunschgröße 1.75. „Knapp zwei Mark je Kilogramm Frischfische!”, dolmetschte Herbert generös. So trat er gelegentlich auch auf.
Berlett strahlte. „Zwei Mark sind ein guter Preis. Wann können Sie liefern?”
„Fünf Tonnen sofort. Den Rest morgen.”
Er zog zweifelnd die Stirn hoch.
Aber ich wusste es ja. Fünf Tonnen sind eine glatte Kutterladung und diese Menge ziemlich schnell ein- und auszukeschern war für unsere Männer kein Problem. Ich schaute auf die Uhr. Anderthalbe Stunden bis zum Laden, eine weitere höchstens für den Umschlag, eine halbe für den Transport. „Zwischen acht und neun Uhr!”
Und wenn ich mit hundert Sachen nach Prillwitz rasen müsste. Denn da standen an diesem frühen Abend meine ungeduldigen Fischer und warteten nur auf das ersehnte Zeichen. Als wir kurz vor neun mit der ersten Fuhre auf dem ‚Russenspeicher’ ankamen, machten sich die uniformierten Jungs umständlichst ans Abwiegen. Eine halbe Stunde lang sah ich mir das Theater an und sagte schließlich: „Ihr seid wohl nicht recht bei Troste!”
Was Herbert übersetzte, kann ich nicht sagen. Sie stutzten jedenfalls. „Da sind in jeder Fischkiste mindestens zweiunddreißig Kilogramm Ware und auf dem Lieferschein stehen dreißig!”
Bei dem Schneckentempo, das sie beim Abwiegen vorlegten und bei dieser Menge, hätten wir die Zeit bis zum Morgengrauen gebraucht und ich war todmüde.
Natürlich konnte nur die Gesamtmasse stimmen. „Lass sie mal.”, beruhigte Herbert Fischer mich, er sei ja auch die Ruhe in Person. Sein Zuspruch tat mir gut. Nun, da die DDR endgültig kaputt war, konnte einer wie er alles ganz gelassen sehen. Sogar die Uhren liefen für ihn anders. Ich dachte an unser Gespräch zurück.
Den Zusammenbruch habe er bereits seit einem Jahrzehnt kommen sehen, sagte Herbert Fischer, als wäre das so selbstverständlich, wie der Blätterfall im Herbst. Der Kommunismus konnte nicht siegen. Gründlich hatte er mir das auf der Herfahrt vorgerechnet.
Alleine die Wartung der komplizierten Waffensysteme sei zu kostspielig geworden und dann diese Zweiklassengesellschaft. Am meisten hätte ihn aufgeregt, dass die Hirsche den Privilegierten unter den führenden Genossen vorbehalten blieben, während Leute wie er, nur Heger statt Jäger sein sollten.
Ungeschönt habe er das seinen großen Militärs des Öfteren an den Kopf geschmettert: „Die Jagd dem Volke, die Hirsche dem Politbüro!” Höhern Ortes hätten sie ihm das ziemlich verübelt.
In ihrer Gunst sei er nur geblieben, weil sie seine Fähigkeit schätzten auch dann simultan zu dolmetschen, wenn sie durcheinander und schnell redeten. Immer auf diesen kasachischen Raketenübungsplätzen sei er mit beiden Seiten gut ausgekommen, weil er sie eigentlich mochte, diese raubeinigen Typen auf sowjetischer und die etwas großmäuligen auf der eigenen Seite.
Herbert meinte, die Lagerverwalter der Garnison würden sich nächstes Mal leichter überzeugen lassen, wenn sie sehen würden, dass wir sie nicht gleich beim ersten Versuch betrügen wollten. Ich wandte mich ab.
Das war die Höhe.
Meine Fische hatte noch keiner nachgewogen. Wir gaben immer ein reichliches Plus, außer bei Aalen. Während ich nun ärgerlich und hundemüde am dunklen Ende der langen Verladerampe stehe und in den matten Lichtkreis hineinstarre, indem sich zehn Mann traumhaft langsam bewegen, berührt mich jemand von hinten. Ich wende mich um und sehe den Blitz in den Augen eines Mannes und gleichzeitig das Aufblinken seines Bajonettes. Dieses Seitengewehres Spitze ragte einen halben Meter über den mehr als zur Hälfte verdeckten Kopf. „Fifthy, fifthy!”, raunte mir der in einem großen sibirischen Pelzmantel steckende Wachposten zu. Er machte einladende Gesten, zog mich mit sich, noch tiefer ins Dunkel hinein, die kleine Holztreppe hinab. „Da, da! Kaufen!” Er nahm seine Kalaschnikow, die er geschultert getragen hatte und hielt sie mir hin. Dabei streckte er die andere Hand unmissverständlich vor.
„Njet, njet”, wehrte ich, hilflos vor soviel Großmut, ab.
Er redete von Munition wie ich von kleinen Fischen und alles nur für sechzig Mark. Für die Maschinenpistole fünfzig und den Rest für die ‚Murmeln’.
Ich machte ein großes Fragezeichen.
Wir befanden uns doch nicht an der tadshikisch-afghanischen Grenze.
Als ich mich von dem munteren Jungen abwandte und ihm den Rücken zukehrte, hatte ich das Gefühl, dass er mir einen riesengroßen Vogel zeigte. Wie kann man nur so dumm sein? Eine Kalaschnikow ist doch mehr als zehnmal soviel wert.
Begeistert waren die immer noch mit dem Abwiegen beschäftigten Männer nicht, als ich erklärte, sie möchten mir nur den Erhalt der Fische quittieren, ich würde jetzt nach Hause fahren.
„Wie denn? Fünf Tonnen?”
„Ja, genau, und falls sich ein Minus herausstellt, liefern wir das Doppelte der Fehlmenge nach.”
Herbert Fischer redete auf sie ein. Auch er hatte es inzwischen satt, bloß dazustehen und immerzu nur die sich stereotyp wiederholenden Schattenspiele zu betrachten. Es ging immer langsamer und wie mir schien im Zeitlupentempo voran. Lag es nun daran, dass Herberts gutturales Säuseln sie noch schläfriger machte oder interessierte sie gar nichts? Sie ließen sich aber auch nicht bewegen die Unterschrift zu leisten. Plötzlich kam ein Offizier an.
Ratsch hatte ich die Unterschrift und batsch den Stempel.
Wir möchten bitte noch einmal zu Oberst Berlett reinschauen.
Es war spät geworden. Oberst Berlett saß immer noch, die Beine von sich gestreckt, wie wir ihn verlassen hatten, im Halblicht seiner beiseite gedrehten Schreibtischlampe und schrieb. Er hätte gehört, dass unsere Fische taufrisch und groß wären. Er lächelte. Er möchte mit uns in Kontakt bleiben und unser Kunde werden. „Aber du musst nach Berlin gehen und mit Co-Impex einen Vertrag machen!”
Oberst Berlett, ein vornehmer Typ mit leicht gewelltem dunklen Haar und exakt gezogenem Scheitel, hätte mich nie ohne weiteres
geduzt. Das machte die Fischerübersetzung. Co-Impex gab mir einen Termin. Zwei Tage später ging ich, mit gemischten Gefühlen, in dieses blauweiße Gebäude in der Nähe der Friedrichstraße in Berlin und saß bald darauf einem Mann gegenüber, der anfangs vierzig sein mochte und etwa einsachtzig groß war. Wie mir auf den ersten Blick schien, war der da einer, der wusste, wie man das Leben genießt. Blitzsauberes, hellblaues Oberhemd, dezenter Schlips. Mir fiel in seinem glattrasierten Gesicht auf, wie gut sein Bartansatz verteilt war. Er lächelte verbindlich. Du warst ein Stasioffizier, dachte ich.
Er war mir aber keineswegs unsympathisch, obwohl ich den Unterdrückungsapparat der DDR aus gutem Grunde gefürchtet und gehasst hatte. Dieser da, wenn meine Vermutung stimmte, hatte sicherlich zu den Großen gehört und wahrscheinlich seinen Teil dazu beigetragen, dass Demokratie für Leute wie mich, vier lange Jahrzehnte ein unerfüllbarer Wunschtraum geblieben war.
Dennoch differenzierte ich zwischen Programmen und Menschen, obwohl sie in der Politik oft genug eine Einheit darstellten. Ich wollte beides voneinander trennen und nur auf die Sache der Diktatur einschlagen.
Ich glaubte manchmal, dass mir dieser eine Satz, den ich so oft dachte, ins Gesicht geschrieben stand. Das Recht sich frei entscheiden zu dürfen, ist wichtiger als das Recht zu leben. Der auffallend gut Gekleidete fragte: „Könnten sie sechzig bis achtzig Tonnen pro Quartal liefern, zu diesem Preis und in dieser Qualität?” Ich denke, dass es mir gelang meine Miene zu wahren. Denn ich war schockiert. Mein Hochziel lag bei höchstens einem Sechstel dieser Summe, die er mir genannt hatte. Ich beeilte mich zu erklären: „Ja, wir können.” Doch ehrlich gesagt, wusste ich noch nicht, wie das in die Praxis umgesetzt werden könnte. Berlett muss mit ihm gesprochen haben! Berlett war also zufrieden, er hat uns gelobt!
In mir steckte noch dieser Gedanke an Zusammenarbeit (schließlich waren wir nordöstlichen Binnenfischer der ehemaligen DDR, ob wir wollten oder nicht, im Zweckverband ‚Qualitätsfisch der
Mecklenburger Seenplatte’ zu einer großen Wirtschaftseinheit zusammengebunden worden.) Doch das war nun vorbei. Jetzt war sich jeder selbst der Nächste. Binnen weniger Sekunden hatte ich mir ausgerechnet, dass die Warener und die Prenzlauer Kollegen wie wir, über Unmengen Tolstolob verfügten, Silberkarpfen, die kein Deutscher mochte. Sie würden sicherlich zuschlagen, wenn ich ihnen einsvierzig aufs Kilo bieten würde, und wir hätten ohne einen Finger krumm zu machen, sechshundert Mark je Tonne verdient. Das wären ja knapp einhundertundfünfzigtausend Mark pro Jahr Nebeneinnahmen. Mensch, Helmut Kohl, lass’ bloß die Russen noch ein paar Jahre in Deutschland. Wir Fischer würden liebend gern helfen, sie auf deine Kosten, zu ernähren.
Silberkarpfen, diese fernöstlichen Algenfresser, die bis zu zwei Meter hoch in die Lüfte springen können - und dabei gelegentlich ins Boot eines ahnungslosen Anglers- hatten wir auf Beschluss von Partei und Regierung in unsere Gewässer einsetzen müssen. Müssen! Jawohl.
Mir wurde warm ums Herz, als mein Gesprächspartner bestätigend nickte: „Bleie und Tolstolob sind ok.”
Er wusste also, wovon die Rede war.
Ich sah diese Unmengen Großfische vor mir, die häufig je Stück mehr als zehn Kilogramm wogen und niemand wusste, wer uns diese hunderte Tonnen abnehmen sollte.
„Was haben sie uns noch anzubieten?”
„Rotaugen.”
Er nickte abermals und schrieb: Silberkarpfen sowie Bleie, größer 500 Gramm je Stück und Plötzen aller Größen.
Saß ich im Vorgarten des Paradieses?
Die scharfen Augen meines Gegenüber musterten mich, ehe er behutsam fragte: „Aber was machen wir, falls die Sowjets Sonderwünsche haben sollten? ... natürlich in geringem Umfang.”
„Kein Problem, wenn es innerhalb eines, sagen wir, Fünfprozentrahmens bleibt.”
Er winkte ab, war’s zufrieden. Details interessierten ihn offensichtlich nicht. Die gepflegten, langen Finger aneinander legend schloss der kompetente Vertreter von Co-Impex das Gespräch ab: „Gut, Sie liefern auf Zuruf jede Woche zunächst fünf Tonnen nach Neustrelitz.”
Hoffnungsvoll setzte ich hinzu: “Vertraglich gebunden.” Er schmunzelte. Ich sorgte mich. Vertrauenerweckend setzte mein Partner hinzu: „Eine mündliche Zusage ist ein Vertrag.” Wie gerne hätte ich ein Stückchen Papier gehabt, auf dem, was wir ausgehandelt hatten, niedergeschrieben stand.
Es gab also noch eine Hürde.
Die Frage, was das sein könnte, quälte mich.
Acht Wochen lang lieferten wir kontinuierlich aus eigenem Aufkommen. Sogar Heiligabend fischten wir, aber sehr erfolgreich.
Oberst Berlett hatte bis dahin lediglich zweimal bescheidene Sonderwünsche geäußert. Beim ersten Mal ließ er uns mitteilen, dass sein General aus Karlshorst käme. Er würde sich freuen, wenn wir ihm einen Hummer beschafften.
Ich wäre notfalls bis Kiel gefahren, um ihm den Wunsch zu erfüllen. Bescheidener als Berlett konnte man nicht sein.
Wir schickten ihm zwei Kilo Hummer und legten drei goldgelbe Räucheraale obendrauf.
Beim zweiten Mal wollte er, für einen ähnlichen Anlass, einen Karpfen haben. Wir boten ihm an, künftig statt sechs Prozent Plus nur vier zu geben, aber dafür jedesmal dreißig Kilo Feinfische.
Von da an nannten die Verpflegungsoffiziere mich “Väterchen Fisch”.
Berlett wurde plötzlich unterrichtet, er sei zurück in die Heimat versetzt worden. Darüber war er unglücklich.
In Neustrelitz wusste er ein heiles Dach über seinem Kopf. In Russland wartete auf seine Familie und ihn wahrscheinlich nur eine Scheune. Sein Nachfolger den er noch einarbeiten sollte, war ein vierschrötiger Kerl, ein Oberstleutnant mit dem Gesicht einer Bulldogge. Sofort überzog der Mann seine Kompetenzen. Berlett hätte keine Ahnung. Statt fünf Tonnen sollten wir in der kommenden Woche zehn liefern. Die erste Sendung am Dienstag, und die zweite am Freitag. Mir war gleich unwohl zumute. Ich ahnte es. Das geht schief.
Doch der Neue setzte mich unter Druck. Was sollten wir machen? Oberst Berlett befand sich auf Reisen. Um mir den neuen Mann geneigt zu machen bot ich ihm mehrere Kilogramm Hummer an und eine kleine Kiste Räucheraale. Mit bissiger Miene senkte der Oberstleutnant sein Löwenhaupt und knurrte. War ihm das noch zu wenig?
Bei der darauf folgenden Lieferung winkte er mir mitzukommen. Da schlug mir schon von weitem ein ekelhafter Geruch entgegen. Unsere bereits vor einer Woche eingelagerte Ware stand schwarz und unangetastet in Kisten auf der Leichtkühlfläche. Mir stockte der Atem. Er hatte einhundert Zentner Speisefische verfaulen lassen. Warum?
Selbst dem unfähigsten Lagerverwalter darf das nicht passieren. Eher verschenkt man die Fische.
Seine breiten Schultern zuckend zog er über Berlett her. Ich biss mir auf die Zunge.
Vorläufig, wie ich nun selber gesehen hätte, benötige er keine Fische. Damit drehte er sich von mir ab und tapste schwerfällig davon.
Sogleich als ich alleine war, redete der Adjutant des Neuen auf mich ein. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff: Es ginge ihm um ein Gegengeschäft.
„Wir verkaufen dir einen Waggon Mehl.”
„Mehl?”
„Was soll ich mit dem Mehl?”
„Na, für die Brotfabrik!”
Die beiden hielten mich ganz selbstverständlich für einen Banditen.
Sollte ich das Berlett petzen?
Was musste ich tun, um wieder zum normalen Handel zurückzukehren? Für uns war es überlebenswichtig geworden seiner Einheit, in den verbleibenden anderthalb Jahren, mindestens sechzig Tonnen Tolstolob, Plötzen und Bleie zu verkaufen. Wir verfügten über Kredite und die mussten mit rund zehn Prozent Zinsen getilgt werden.
„An deiner Stelle würde ich Co-Impex informieren.”, riet Herbert Fischer mir, als ich ihn aufsuchte um mich zu vergewissern, dass uns kein Übermittlungsfehler unterlaufen war. Er kratzte seinen Kopf, weil er keinen bessern Rat wusste. Nächstes Mal ließe er mich nicht wieder allein fahren.
Fernmündlich erteilte Co-Impex mir folgende Auskunft: „Es gibt einen Strukturwandel. Jetzt schreiben wir Sommer ‘91. Wenden sie sich bitte an ‘Fischexport-import’ in Steglitz. Vielleicht wäre es besser, sie verhandeln erst mit Wünsdorf. Wir bedauern sehr. Auch uns sind die Hände momentan gebunden” In Wünsdorf kamen wir nicht weit. Wie Schulbengel standen wir vor den schwarzen, eisengeschmiedeten Eingangspforten zum Park der Allmächtigen. Links das große gelbe Gutshaus, in das wir nicht gelangen konnten, rechts die Straße, auf der die Muschkoten entlang paradierten. Ein höherer Sowjetoffizier kam angeradelt. Auf seinen Wortschwall hin zuckte Herbert mit den Achseln.
„Morgen sollst du nach Berlin-Dahlem gehen.”
„Morgen?”
„Morgen!”
Noch einmal müsste ich, allerdings aus zwingenden Gründen, auf seine Dolmetscherdienste verzichten, aber die dort sitzenden Leute verstünden Deutsch.
Dieses Wort ‚Morgen’ war der ganze Ertrag einer Tagesreise von fast dreihundert Kilometern.
Anderntags, im Bereich Berlin-Dahlem, als ich das schlichte Schild am versteckt liegenden weißen Haus las, bedrückte mich bereits die bloße Tatsache seiner Existenz. Es umdüsterte meinen Traum vom großen Geschäft. Trotzdem ging ich mutig hinein. In einem kleinen Wartezimmer nahm ich Platz. Ich sah diese harten und bleichen Gesichter nobel gekleideter russischer Zivilisten, die geschäftig an mir vorbeieilten. Wortfetzen drangen zu mir. Im Büro des unsichtbaren Dirigenten der Fisch- und Geldströme ging es um tausende Tonnen.
Ich wurde schließlich hereingebeten. Ein untersetzter, kahlköpfiger Herr mit weißer Weste, der tatsächlich gut Deutsch sprach, saß halb in sich zusammengesunken in einem schwarzen Ledersessel.
„Was haben Sie uns anzubieten?”
Ich erklärte es.
Von meinen Tolstolob und Plötzen war nicht lange die Rede. Ein Blick hin, ein Blick her: „Achtzig Tonnen im Quartal?”
Keine Größenordnung für ihn. Tiefgefrostet könnte man die Dinger quer durch sein großes Land schicken. „Eine Mark aufs Kilogramm.”
Er wedelte eine Fliege weg.
Ich schluckte.
Meine Betroffenheit übersah er geflissentlich.
Seine schwarzen Kugelaugen erstarrten, während er die für ihn wesentlichste Frage stellte: „Wie viel Räucherlachse?”
Er lächelte, während ich spürte, dass ich langsam errötete.
Mit seiner Geiernase roch er meinen Widerwillen.
Mühsam mich selbst beherrschend überlegte ich. Doch ich war unfähig auszurechnen, wie viele Räucherlachse ich ihm maximal bieten könnte. Was würden die Warener, was die Prenzlauer sagen, wenn ich ihnen nur sechzig, oder achtzig Pfennige biete? Immerhin mussten sie aufwendige Fischerei betreiben. Wir selbst hatten unsere Tolstolobbestände bereits ausgedünnt, rechtzeitig.
Mit welchem Faktor durfte ich noch rechnen, wenn der da so rigoros den Preis halbierte?
Ich müsste erst mit den Leitern unserer Nachbarfischereien reden und einen zweiten Termin vereinbaren. Andererseits musste ich ihm jetzt und hier eine nennenswerte Menge Gratisfische anbieten. Immerhin nahm er uns dreihundertundzwanzig Tonnen Silberkarpfen oder Rotaugen ab. Es ging, wenn wir andere schwer absetzbare Arten einbringen könnten um ein erweiterungsfähiges Geschäft von zunächst einer drittel bis maximal einer dreiviertel Million Mark Umsatz.
Wenn er zurückzog, dann brachte ich allein unser kleines Unternehmen um die direkte Einnahme von fünfzig- bis achtzigtausend Mark, - und um wie viel indirekt?
Zuerst musste ich das andere ausrechnen.
„Acht bis zehn Kilo jede Woche?” Das wäre im Verlaufe eines Jahres eine halbe Tonne Räuchlachse, die erst erworben sein wollten.
Über sein fettglänzendes Gesicht huschte ein kleines, leicht verächtliches Zucken.
Kalte Wut kam in mir hoch. Du willst jede Woche mindestens dreißig Kilo Räucherforellen haben?
Du nicht! dachte ich. Mit Gangstern mache ich keine Geschäfte.
„Mehr habe ich nicht!”, sagte ich laut und bereute schon wieder, dass mich Emotionen verleitet hatten. Hätte ich nicht sagen sollen, das muss ich erst überdenken?
Mir schien, dass er dachte: Du Leichtgewicht!
„Hm”, machte er nur, wog den runden Kopf und schüttelte ihn, wie die Russen zu tun pflegten, wenn sie ablehnten.
Ich stand auf oder besser gesagt, der Ärger erhob mich. Ich hätte am liebsten die Glastür hinter mir zugeschmettert. Um einhundertsechzigtausend Mark hatte er mich schon geprellt, bevor von seinen dämlichen Lachsforellen die Rede war.
Wir hörten nie wieder voneinander, noch sah ich jemals den lieblichen Schuppen im Russenmagazin zu Neustrelitz wieder.
Ein unvorhersehbarer Schluss
Eintrag in den Merkkalender am 5. September 1991: “Der Krieg zwischen Jürgen N. der Genossenschaft und mir ist zu Ende!”
Das Bezirksgericht Neubrandenburg hatte endgültig gegen ihn, für uns entschieden.
Meine Frau sagte mir am nächsten Tag: „Ich glaube, Jürgen war hier.” Sie meinte, sie habe gesehen, wie er vor der Haustür gestanden, geklingelt und dann davon gegangen sei, noch bevor er sie oder sie ihn hätte ansprechen können.
Am Abend des folgenden Tages klopfte es an meine Wohnungstür.
Er war es.
Hoch aufragend stand er vor mir. Ich blickte ihn entgeistert an. Er wäre gekommen, um mir zu meinem Sieg zu gratulieren.
Jürgen streckte mir seine riesige Hand entgegen.
Du kannst mir doch nicht zu deiner Niederlage gratulieren! Ich dachte: Was für ein Riesenunsinn.
Allein die Idee fand ich absurd, geschweige denn die Verwirklichung.
Wie Kopfjäger hatten wir uns bekriegt und er kommt um zu gratulieren, weil er unterlag.
„Tritt ein!”
Tief atmend nahm Jürgen im Sessel Platz. Ich starrte auf seinen Mund. Wie oft mochte er diese Szene in den letzten sechzig Stunden durchlitten haben? Ein Mann wie er, der nichts tat, ohne es gründlich erwogen zu haben.
Härteste Brocken hatten wir uns gegenseitig in den Weg gelegt.
Ich sei ein Lügner!
Er ein Ehrabschneider.
Dass ich vor Jahrzehnten in Prenzlau dreißig Berufsschüler in die FDJ hineingepresst hätte.
Komisch, was die Leute alles wussten.
Tatsächlich war ich nach den 3. Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Berlin so angetan gewesen vom Kommunismus, dass ich mich eine Weile auf dem Weg zu Josef Stalin befand.
Natürlich habe ich in meiner Begeisterung 25 Aufnahmeanträge von der FDJ Kreisleitung geholt und sie jedem meiner jüngeren Mitschüler auf die Klassenbank gelegt und danach eine kurze Rede gehalten. Sogar ein Stalinbild pinnte ich an die Klassenwand, war drauf und dran gewesen, in die SED einzutreten. Aber ich tat es schließlich doch nicht, sondern bin bereits Weihnachten 1952 umgekehrt, aus meinen Gründen. Und das kostete mich die von mir angestrebte Laufbahn als Berufsschullehrer.
Jürgen schaute sich aus den Augenwinkeln blickend in unserer Wohnung um. Da gab es, wahrscheinlich zu seiner Verwunderung, keine Anzeichen von Bigotterie, was er meiner bekannten Glaubensansichten wegen sicherlich erwartet hatte.
377
Ich hätte viel darum gegeben, wenn es mir in diesem Augenblick möglich gewesen wäre, seine Gedanken zu lesen.
„Musste das sein?” fragte ich ihn.
Nur einmal zuvor, weit zurückliegend, als er tief in einer Klemme steckte, habe ich seine grauen Augen so bescheiden, so bittend gesehen.
Wie damals rührte es mich auch diesmal wieder an.
Ich an seiner Stelle wäre nicht zu meinem Feind gegangen. Aber da saß er nun.
„Ich wollte...”, begann er stockend.
Da wusste ich alles.
Sein Freiheitsdrang war stärker gewesen, als seine Vernunft. Den politischen Umsturz habe er als seine große Möglichkeit betrachtet, endlich wegzukommen von den Zwängen, die ein Leben in einem Arbeitskollektiv oder in einem Team notwendigerweise mit sich brachten. Er war nicht geboren worden, um Befehle oder Weisungen entgegen zu nehmen, sondern um sie zu geben.
Immer stand, bis dahin, einer über ihm, und darüber noch einer und so fort. Frei sein wollen und nicht frei und unabhängig sein können, das war sein Problem.
Er hatte den Kampf aufgenommen, jedes Mittel eingesetzt, auch die untauglichen. Jürgen breitete seine großen Hände aus, die ich wohl gebunden sah, die jedoch nur unterstrichen, was seine hellen, unruhigen Augen widerspiegelten. Sie baten darum, dass wir ihm vergeben möchten. Ich sah, wie tief er bereute, mit dem Schädel gegen die Wand gerannt zu sein. Ich sah diesen Hoffnungsblink. Jürgen war unbequem und halsstarrig, groß im Hass und groß genug, sich selbst zu beugen.
Weich kamen die Formulierungen aus dem Kindermund, der mir nicht selten hart und kalt wie Kieselstein erschienen war.
Lange Jahre hatte er vor mir und nicht nur vor mir eine Mauer errichtet. Die stand sehr fest. Sie war hoch und breit.
Deshalb war sie unüberwindlich geworden. Lange Jahre hatte er vorgeben wollen, dass sein Schild und Rüstung, die er sich zugelegt, sein angewachsener und natürlicher Panzer sei. Dieses
selbstgefertigte Ungetüm hing nun als Ballast an ihm.
Ja, ich habe ihn manchmal wiedergehasst. Es war mir nicht leicht gefallen, diese Gefühle niederzuringen. Auch die andern Männer hegten starke Abneigung. „Nimmst du mich wieder?” Einen Augenblick lang wusste ich nichts zu sagen. Hätte ich Nein sagen können?
Aber über das Ja entschied ich nicht allein.
Die neue Genossenschaft war von uns so strukturiert worden, dass alle Mitglieder dieselben Rechte wie vorher besaßen, sogar mehr als zu alten Zeiten. Unsagbar schwer würde es werden, die Fischer davon zu überzeugen, dass er von nun an friedlicher und freundlicher mit ihnen umgehen wolle.
Wie ein aus einem bösen Traum erwachender Mann schaute er daher, als ich offen ansprach, was er angerichtet hat.
Er stellte dieselbe Frage, vielleicht weil er annahm, ich hätte sie überhört: „Nimmst du mich wieder?”
Mann für Mann wolle er aufsuchen, zum zweiten Mal, ja, auch das sei richtig, aber diesmal wirklich geläutert, bekehrt durch großen Schmerz.
Ich kannte ihn. Er würde genauso verbohrt, genau so verbissen, wie er bisher gegen uns gewütet hatte, diesen unerhörten Anlauf solange wiederholen, bis die versteifte Wand fiel, und sei es erst beim hundertsten Versuch.
Er konnte gegen alle Logik der Welt anrennen.
Er wollte an das Unmögliche glauben, anders war für ihn kein Leben möglich. Entschlossen allen Hohn und jeden Spott auf sich zu nehmen, war er zu mir gekommen, allen Zweifel, jedes Bedenken überwindend.
Seiner Frau wegen, die er mehr liebte als sich selbst, der Zukunft seiner Kinder wegen. Er musste es tun. Nicht eine Minute lang, nachdem seine Niederlage besiegelt worden war, habe er eine andere Möglichkeit erwogen. Da musste er durch. Er bitte um Vergebung.
Selbst wenn ich es nicht von Herzen gewollt hätte, nach diesen Worten musste ich ihm die Hand zur Versöhnung reichen.
Mir war sonderbar zumute, als seine große Hand meine Finger umschloss.
Er wagte ein kleines Lächeln. „Wenn du zu mir hältst, dann wird das auch was.”
Am drittnächsten Tag wollten wir beraten, was ich für ihn bei den härtesten seiner Widersacher tun, wen wir für ihn gewinnen könnten.
Um seinen Wunsch zu erfüllen, benötigten wir neun Ja-Stimmen.
Es gab diesen dritten Tag nicht, nicht für ihn.
Nachdem er von mir weggegangen war, sprach er viele Stunden lang mit seiner Frau. Jede Einzelheit seines langen Gespräches mit mir erfuhr sie. Danach legte er sich zum letzten Mal in seinem noch jungen Leben zu Bett.
Denn anderntags verunfallte Jürgen im Verkehr auf der Landstraße tödlich.
Ich hätte es mir nie verziehen, wenn ich seine dargebotene Hand ausgeschlagen hätte. Noch nie habe ich auf einer Beerdigung, einen Schlager, gespielt von einem Orgelorganisten, gehört, aber auch noch nie so beeindruckend eine schlichte Melodie empfunden wie dieses Lied: „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt.”
Ich sah ihn die Netze ausfahren und plötzlich mich als Dreizehnjährigen auf der Ducht des Segelbootes unseres Nachbarn Janzen sitzen, sah das korngelbe, gebauschte Segel und wie die rote Sonne versank und erinnerte mich der darauf folgenden Nacht der Schrecken, - der Bombardierung Peenemündes - die aber nicht das Ende bedeuteten, sondern mir die wunderbare Einsicht gaben, zu begreifen wie wertvoll jeder Tag ist, an dem wir leben dürfen, um nach düsteren Stunden wieder und wieder die aufgehende Sonne zu sehen ...
Erst am 6. Januar 1994 wurde mir amtlich mitgeteilt, dass die Staatanwaltschaft Neubrandenburg das gegen mich geführte Ermittlungsverfahren wegen Fischwilderei gemäß § 154 d 3 StPO eingestellt hat.
Abkürzungsverzeichnis
AE Arbeitseinheit, Tagesnorm
EVP Endverbraucherpreis, staatlich festgelegter
HO Handels-Organisation
KVP Kasernierte Volkspolizei
LPG Landwirtschaftliche Produktions-Genossenschaft
M v vorgestreckte Maräne
ND “Neues Deutschland“, Organ der SED
NVA Nationale Volksarmee
RWN Reparaturwerk Neubrandenburg
Im Text nicht erwähnte, aber bemerkenswerte Fischzüge auf dem Tollensesee:
Ende Februar 1973 “Zuckertoch” mehr als 36 000.- kg Rotaugen/Plötzen
in Sortierungen II und I, Stückgewichte über 100g.
Mitte September 1982, ebenfalls Zuckertoch, als Tagesfang, 1400.-kg Aale, Sorte I, Durchschnittsgewicht 320 g.





Aufgrund meiner schlechten Bonität war ich so frustriert über meine finanzielle Situation, dass ich einige sogenannte Hacker online traf, die behaupteten, mir zu helfen, aber alles verschlechterten? Ich musste meine Punktzahl erhöhen. Es hat sich letztendlich ausgezahlt, als ich einen Hacker über eine Online-Referenz getroffen habe. Ihre Arbeitsgeschwindigkeit und Professionalität sind erstklassig. Sie erhöhten meine Punktzahl und entfernten die negativen Punkte in meinem Bericht innerhalb von (2 Arbeitstagen), was mir schließlich die Hypothek für mein neues Haus und auch mehrere Darlehen einbrachte. Sie können sie alle über {PETERHEYMANNLOANOFFER@GMAIL.COM kontaktieren
AntwortenLöschenSchlechte Gutschrift, okay !! 100% Akzeptanz für Sofortdarlehen,
AntwortenLöschenAngebot innerhalb von 24 Stunden
Holen Sie sich ein persönliches Darlehen von (£) 10.000 bis (£)
80.000.000 USD, 3,0%
Zinssatz Unsere Kredite sind gut versichert und maximale Sicherheit haben wir
Priorität, sind Sie finanziell angeschlagen?
Suchen Sie nach Mitteln, um Kredite und Schulden zurückzuzahlen?
Suchen Sie eine Finanzierung, um ein eigenes Unternehmen zu gründen?
Benötigen Sie Privat- oder Firmenkredite für verschiedene Zwecke?
Suchen Sie Kredite für große Projekte?
Suchen Sie Ressourcen für verschiedene andere Prozesse?
Hinweis: Wir bieten Privatpersonen folgende Kredite an
* Gewerbliche Kredite.
* Persönliche Darlehen.
* Business-Darlehen.
* Investitionsdarlehen.
* Entwicklungskredite.
* Kredite zum Verkauf.
* Baukredite.
* Kredite für Unternehmen und viele andere:
und vieles mehr bei einem Zinssatz von 3%;
E-Mail: Wie bewerbe ich mich?
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Mrfrankpoterloanoffer@gmail.com
Brauchen Sie einen Kredit? Wir bieten kleine, mittlere und große Kredite mit einer Schnellschlussgarantie zu einem Zinssatz von 3% pro Jahr an. interessierte personen sollten mich für weitere informationen und anmeldungen über financierlibertycapital@gmail.com oder whats-app +1 (325) 244-7901 kontaktieren
AntwortenLöschenDer Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
AntwortenLöschenBenötigen Sie dringend einen Kredit, einen Geschäftskredit, einen Privatkredit, einen Investitionskredit, einen Wohnungskredit, einen Autokredit und vieles mehr? Wir bieten kleine, mittlere und große Kredite mit Tagesgenehmigung und einer Kurz- und Langzeitgarantie in Höhe von 2% pro Jahr an. Interessenten wenden sich für weitere Informationen und Bewerbungen bitte an
AntwortenLöschenE-Mail: contact@firstheritageloanfirm.com
firstheritageloannfirm@gmail.com
Tel .: +1 {480} 582-4571
WhatsApp: +1 {480} 582-4571
Freundliche Grüße!
Jimmy Faltersack